Am vergangenen Wochenende fand in Leipzig der „Gedenkkongress 2015“ statt. Vorrangig wurde über das Thema, wie sich ein Gedenken nach rechtsmotivierten Taten gestalten könnte, diskutiert. Einfache Antworten auf den Umgang mit der Problematik konnte und wollte kein Vertreter des Podiums am Samstagabend im Conne Island geben. Bundesweite Initiativen und Mitglieder aus den NSU-Untersuchungsausschüssen diskutierten über die Konsequenzen für die Erinnerungsarbeit, die man infolge der Mordserie ziehen müsste.
Kurz nach der Aufdeckung des NSU-Komplexes entstanden in mehreren Landesparlamenten Untersuchungsausschüsse. „Die sächsische Regierung hat von Anfang an gesagt, dass der NSU kein sächsisches Problem ist sondern ein thüringisches“, schilderte Miro Jennerjahn die ursprüngliche Haltung in Sachsen. Er war bis 2014 Landtagsabgeordneter in Sachsen und Mitglied im NSU-Untersuchungsausschuss.
Die Sichtweise der Regierung schlug sich im Abschlussbericht nieder und verortete die Schuld am Behördenversagen bei den Nachbarn. Tiefgreifende Veränderungen waren nicht notwendig, so die Einschätzung.
Bereits das Zustandekommen des Ausschusses verlief unter keinem guten Vorzeichen. Nur als Mittel der Opposition konnte die Kontrollinstanz durchgesetzt werden, ganz im Gegensatz zu Thüringen, wo es eine breite Zustimmung über die Oppositionsgrenzen hinaus gab. „Daraus hat sich eine Kampfstellung ergeben. Es hat die Arbeit unheimlich schwierig gemacht“, beschrieb Jennerjahn den Ausschuss. „Es war ein sehr zähes Ringen.“
„Dass das Fazit des Berichts so aussieht, verwundert nicht“, sagte Jennerjahn und verwies auf einen Minderheitenbericht, der von SPD, Grünen und Linken herausgegeben wurde. Darin kamen die Herausgeber auf eine vollkommen andere Wertung: Sächsische Behörden hatten massiv versagt. „Das Minderheitenvotum ist das erste ernstzunehmende Dokument aus Sachsen“, schätzte der Grüne ein.

Eine Konsequenz aus dem amtlichen Verhalten ist für den ehemaligen Parlamentarier klar. „Eine zentrale Forderung war, den Verfassungsschutz abzuschaffen, weil er nicht mehr reformierbar ist.“ 187 Mitarbeiter mit einem Budget von 13,5 Millionen Euro würden zu keinen nennenswerten Ergebnissen führen und die Mittel seien an einer anderen Stellen besser untergebracht. „Wir brauchen mehr Gelder für staatsunabhängige Forschungen.“
Katharina König sah dies ganz ähnlich. Sie selbst sitzt im thüringischen Parlament und mittlerweile im zweiten NSU-Untersuchungsausschuss. „Es geht weiter“, merkte sie zum aktuellen Stand an.
„Leider war es nicht möglich, den Verfassungsschutz abzuschaffen“, bedauerte sie die Umsetzbarkeit ihrer Forderungen im Hintergrund der vergangenen Koalitionsverhandlungen. In Thüringen konnten jedoch aufgrund der rot-rot-grünen Regierung andere Dinge durchgesetzt werden, hob König hervor. Der Verfassungsschutz als eigenständige Behörde wurde aufgelöst und dem Innenministerium untergliedert, zudem wurden ihm 400.000 Euro entzogen. „Eine ständige kontinuierliche Geldkürzung“ werde vollzogen.
Ebenfalls an den Kragen ging es der umstrittenen V-Mann-Praxis. Dabei werden beispielsweise Neonazis aktiv von den Verfassungsschutzämtern angesprochen und für Informationen bezahlt. „Es gibt vier V-Leute in Thüringen“, schilderte sie die veränderte Praxis. Für jeden neuen V-Mann müsse nun der Ministerpräsident eingebunden werden. „Ich hoffe da auf die eigene Erfahrung aus 20 Jahren Beobachtung.“ Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke) konnte erst mit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts den Verfassungsschutz dazu zwingen, ihn nicht mehr überwachen.
König kommt zu demselben Schluss wie Jennerjahn. „Man kann den Verfassungsschutz nicht kontrollieren, es ist ein Widerspruch in sich.“
Auf die Betroffenen wird nicht gehört
Ebenfalls schossen nach der NSU-Aufdeckung Initiativen aus dem Boden, die Erinnerungsarbeit leisten und den betroffenen Familien helfen wollten. Ein großes Problem sei jedoch dabei, dass diese Arbeit mitunter komplett an den Wünschen der Angehörigen vorbeiging, drückten mehrere Vertreter des Podiums aus.
Aische aus Kassel vom Bündnis „NSU-Komplex auslösen“ schilderte beispielhaft das Verhalten der Stadt am Fall von Halit Yozgat. 2006 wurde der Internetcafé-Betreiber in der Holländischen Straße mit der gleichen Tatwaffe des Typs Česká ermordet, wie bei acht weiteren Mordfällen, die dem NSU zugeschrieben werden.
„Nach dem Auffliegen des NSU kam ganz schnell die Forderung der Familie nach der Umbenennung der Straße“, so Aische. Ein vormals namenloser Platz wurde durch die Stadt Kassel in Halit-Platz umbenannt, dies entsprach allerdings nicht dem Wunsch der Angehörigen.
Auch Katharina König hielt nicht viel von solchen Aktionen, bei denen die Angehörigen nicht gefragt werden und sah hierbei eher einen Akt der Selbstvergewisserung als eine sinnvolle Art der Erinnerungsarbeit. „Bitte lasst die Instrumentalisierung der Betroffenen. Ich finde es ganz schwierig“, so König und forderte: „Es darf nicht ohne die Betroffenen stattfinden, das kann es nicht sein.“
Verwunderlich zeigte sich Aische über die Uneinsichtigkeit der Behörden gegenüber Vermutungen der betroffenen Familie. 2006 fand in Kassel ein Schweigemarsch mit 4.000 Teilnehmern statt, die fast ausschließlich migrantisch geprägt war. Damals forderten die Teilnehmer kein zehntes Todesopfer, fünf Jahre vor der offiziellen Aufdeckung. Antirassistische Initiativen griffen dies damals nicht auf.
Doch nicht nur der NSU sorgte für Opfer. Kamal K. wurde 2010 in der Nähe des Hauptbahnhofs Leipzig durch einen Neonazi niedergestochen. Die Kampagne „Rassismus tötet“ thematisierte dies unter anderem im engen Kontakt mit der Familie von K.
Mario von „Rassismus tötet“ aus Leipzig spiegelte dabei die Bandbreite der verschiedenen Ansätze wider. „Es gibt Gruppierungen, die sich Jahre später mit rechten Morden beschäftigen und ein Bewusstsein dazu herstellen.“ Andere Initiativen betreuen die Betroffenen und helfen beispielsweise bei Amtsgängen. „So etwas wie einen rote Leitfaden gibt es nicht“, so der Leipziger.
„Es endet nicht mit einer Gedenkveranstaltung oder einem Prozess“, gab Mario zu bedenken. „Es ist ein verdammt einschneidendes Erlebnis.“
Leipzig als Tatort und Ort der Verständigung
„Wie können wir den Betroffenen gedenken und in die Gesellschaft intervenieren“, kam der Vertreter aus Leipzig auf die drängende Frage des Wochenendes. Im Rahmen der bundesweiten Kampagne von „Rassismus tötet“ habe man oft festgestellt, dass es ähnliche Probleme gebe, deshalb habe man sich auch für diesen Kongress entschlossen. „Es braucht diesen Austausch, es gibt ihn viel zu selten.“
Die Wahl auf Leipzig fiel dabei nicht ganz zufällig. „Es gibt ein massives Problem in Sachsen“, verwies er auf die rassistischen Ausschreitungen in den letzten Monaten. „Die letzten Wochen geben den Anwesenden hier Recht“, so Mario. Bereits zu Beginn begrüßte ein Transparent mit der Aufschrift „Heidenau 2015. Sachsen. Du mieses Stück Scheiße“ die Besucher.
Ein weiteres Problemfeld schnitt Mario nur an: Gewalt gegenüber Obdachlosen. Die Gruppe ordnet solchen Übergriffen ein sozialdarwinistisches Motiv zu, das heißt, den Tätern würde es darum gehen, vermeintlich unnütze Personen aus der Gesellschaft zu tilgen. Entsprechende Motive werden bei Strafverfahren relativ selten untersucht. Die Gruppe von Obdachlosen gilt als eine der vernachlässigten Opfergruppen rechter Gewalt. Der RAA Sachsen hat 2014 vier Fälle registriert, eine größere Dunkelziffer wird angenommen.
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:


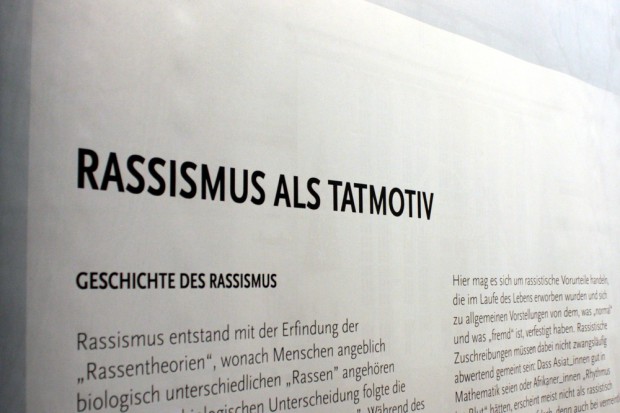









Keine Kommentare bisher