Der Mensch ist wahrscheinlich das einzige Lebewesen auf der Erde, das sich ein Bild vom eigenen Denken machen kann. Das sich überhaupt Gedanken darüber macht, wie das eigene Denken eigentlich funktioniert. Und eine aktuelle Veröffentlichung, an der auch Leipziger Kognitionsforscher beteiligt sind, deutet darauf hin, dass wir uns das Ganze wie eine große, dreidimensionale, interaktive Karte vorstellen können.
Denn gespeichert wird alles, was wir wahrnehmen, in unterschiedlichen Gehirnregionen. Und schon ein wenig Nachdenken drängt einem die Frage auf: Wie viel Speicherplatz braucht das eigentlich alles, wenn wir permanent neue Reize aufnehmen und neue Informationen ein- und zuordnen müssen?
Dass das von außen – mit den Messgeräten der Forscher beobachtet – wie ein permanentes Feuerwerk aussieht, bei dem fortwährend ganze Reizladungen in die unterschiedlichsten Hirnregionen hineinzischen, ist zumindest eine äußere Wahrnehmung dieser Prozesse, die wir von innen her ja als ständigen Fluss von Bildern, Reizen, Emotionen und Gedanken erleben.
Was dann zu der fundamentalen Frage führt: Wie funktioniert das menschliche Denken?
Bisher gibt es darauf keine schlüssige Antwort. Die liefert auch die jetzt vorgelegte Co-Produktion nur zum Teil. Aber zu einem wichtigen. Denn sie versucht in ein Bild zu fassen, wie sich die Informationen in unserem Gehirn eigentlich strukturieren. Denn das alles ist ja nicht als digitale Datei abgelegt, nicht als Bibliothek oder Akte im Aktenschrank, wo wir dann nach Stichworten suchen, wenn mal ein Thema dran ist.
Susi zum Beispiel, die wir von irgendwo kennen. Aber woher nur?
Meistens fällt uns gar nicht auf, wie unser Gehirn die wahrgenommenen Muster erkennt und zuordnet. Eher nur dann, wenn uns jemand verflixt bekannt vorkommt, wir denjenigen aber partout nicht zuordnen können. Oder besser: jetzt nicht zuordnen können. Denn oft fehlt uns nur die eine kleine Information, die das Bild mit den gespeicherten Informationen in Deckung bringt.
Etwas, was unser Gehirn normalerweise in Sekundenbruchteilen kann. Denn es muss nicht erst suchen. Der Prozess des Speicherns und Abrufens ist viel einfacher. Denn unser Gehirn hat „gelernt“, wie man die komplexen Informationen zu einer Person, einem Gegenstand, einem Ort auseinandernimmt, aufs Wesentliche reduziert und verwandten Grundmustern zuordnet.
Und daraus entsteht dann das, was die Forscher jetzt „kognitive Räume nennen“ – eine Art dreidimensionaler Weltkarte im Kopf.
Das Navigationssystem in unserem Gehirn
An der Studie beteiligt waren Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und des Kavli-Instituts für Systemische Neurowissenschaften in Trondheim, Norwegen, darunter auch Nobelpreisträger Edvard I. Moser. Sie haben nun die bislang vorhandenen Puzzleteile zu einem Gesamtbild zusammengesetzt und schlagen, gemeinsam mit Peter Gärdenfors von der Lund Universität in Schweden, einen neuen Ansatz vor: Unser Denken funktioniert über das Navigationssystem unseres Gehirns.
Und sie erklären den Vorgang so:
Wenn wir uns in unserer Umgebung orientieren, geschieht das vor allem durch die Arbeit zweier Zelltypen in unserem Gehirn. Die Ortszellen im Hippocampus und die Rasterzellen in einem benachbarten Hirnareal, dem entorhinalen Kortex. Gemeinsam bilden sie einen Schaltkreis im Gehirn zur räumlichen Orientierung. Ein Team aus Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) in Leipzig und des Kavli-Instituts für Systemische Neurowissenschaften in Trondheim geht nun davon aus, dass dieses innere Orientierungssystem jedoch für weit mehr zuständig ist: Die Forscher vermuten, dass darin der Schlüssel zu unseren generellen Denkprozessen liegt – und dass dementsprechend unsere Erfahrungen und unser Wissen räumlich organisiert sind.
„Wir nehmen an, dass das Gehirn alle Informationen, die wir aus der Umgebung aufnehmen, in sogenannten kognitiven Räumen speichert. Das betrifft nicht nur rein geographische Daten, sondern vor allem auch solche über Zusammenhänge zwischen Objekten und Erfahrungen“, erklärt Christian Doeller, Letztautor des zugrundeliegenden Fachartikels und neuer Direktor am Leipziger Max-Planck-Institut.
Wie funktionieren kognitive Räume?
Als kognitive Räume werden dabei innere Karten bezeichnet, in denen wir mental die komplexe Realität vereinfacht anordnen und abspeichern. Jedes Objekt, egal ob Personen oder Gegenstände, trägt verschiedene Eigenschaften, die sich entlang von Skalen einordnen lassen.
„Wenn ich etwa an ein Auto denke, dann kann ich es gedanklich entlang der Stärke seines Motors und entlang seines Gewichts einstufen. So ergeben sich Rennwagen mit hoher Leistung und geringem Gewicht genauso wie Wohnmobile mit geringer Leistung und hohem Gewicht – und alle dazwischenliegenden Variationen“, so Doeller weiter.
Ähnliches würde geschehen, wenn wir an Freunde oder Verwandte denken, die wir ebenfalls entlang von Größenachsen ordnen, etwa entlang ihrer Körpergröße, ihres Humors oder auch ihres Einkommens, sodass wir sie dann als eher groß oder klein, humorvoll oder humorlos, mehr oder weniger wohlhabend abspeichern. Dann liegt je nach Merkmal der eine gedanklich nah oder weit von einem selbst entfernt.
Wenn der Raum zum Muster wird
Zu diesen Erkenntnissen gelangten Doeller und sein Team anhand einzelner Befunde der vergangenen Jahre, die sie zu einem Modell des menschlichen Denkens kombinierten. Ausgangspunkt waren dabei zwei später mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Entdeckungen aus den Jahren 1971 und 2005 zur Rolle der Orts- und Rasterzellen im Gehirn von Nagetieren während der Orientierung.
Sie zeigen jeweils ein einzigartiges Aktivitätsmuster, je nachdem wo sich das Tier gerade in einem Raum aufhält, während es nach Futter sucht. So entsteht für jeden Ort, den das Tier einmal betreten hat, ein einzigartiges Muster an aktiven Zellen im Gehirn, das es als eine Art Karte speichert und abruft, sobald es wieder an diese Stelle gelangt.
Diese sehr regelmäßigen Aktivitätsmuster der Rasterzellen zeigen sich auch beim Menschen – und zwar nicht nur, wenn er durch geografische Räume navigiert, sondern auch während er sich geistige Konzepte erschließt. Das zeigte 2016 eine Studie, in der die Teilnehmer lernen sollten, neue gedankliche Zusammenhänge zu bilden. Konkret wurden ihnen Bilder von Vögeln gezeigt, die sich in der Länge ihres Halses und ihrer Beine unterschieden.
Parallel dazu wurden verschiedene Symbole eingeblendet, etwa ein Baum oder eine Glocke. Ein Vogel mit langem Hals und kurzen Beinen sollte so gedanklich mit dem Baum, ein Vogel mit kurzem Hals und langen Beinen mit der Glocke verknüpft werden. Eine bestimmte Kombination der beiden körperlichen Eigenschaften repräsentierte also ein Symbol.
Das Interessante dabei: Als die Teilnehmer anschließend im MRT in einem Gedächtnistest angeben sollten, welches Symbol jeweils zu dem eingeblendeten Vogel einer bestimmten Hals- und Beinlänge gehört, zeigte ihr entorhinaler Kortex die gleichen Aktivitätsmuster wie beim Orientieren in einer echten Umgebung – eine Art Koordinatensystem durch unsere Gedanken.
„Indem wir alle bisherigen Erkenntnisse zusammenbringen, gehen wir nun davon aus, dass das Gehirn eine mentale Karte speichert, egal ob es sich um einen gedanklichen oder einen realen Raum handelt. Unsere Gedankengänge würden demnach wie Pfade durch einen Raum und entlang von geistigen Achsen verarbeitet werden“, erklärt Jacob Bellmund, Erstautor des aktuellen Fachartikels.
Wie wir Neues einordnen
„Diese Prozesse dienen uns vermutlich insbesondere dazu, neue Objekte und Situationen zu erschließen, selbst wenn wir sie zuvor nie erlebt haben“, so der Neurowissenschaftler weiter.
Mit Hilfe der bereits vorhandenen mentalen Karten könnten wir einschätzen, wie ähnlich das Neue dem bereits Bekannten ist, sodass wir es dann in Relation dazu entlang der existierenden Achsen einordnen können. Kennen wir etwa Tiger, Löwen oder Panther, haben aber noch nie einen Leoparden gesehen, dann würden wir ihn wegen seines Aussehens an eine ähnliche Position in unserem kognitiven Raum setzen wie die anderen Raubkatzen. Durch unser Wissen über das Konzept „Raubkatze“, das wir bereits in unserer mentalen Karte abgespeichert haben, könnten wir dann auch auf den Leoparden entsprechend reagieren.
„Wir können so zu Generalisierungen gelangen, sodass wir in jeder neuen Situation, in der wir uns ja ständig befinden, letztlich abschätzen, wie wir uns zu verhalten haben“, erklärt Bellmund.
Originalpublikation: Jacob L.S. Bellmund, Peter Gärdenfors, Edvard I. Moser, Christian F. Doeller (2018) „Navigating Cognition: Spatial Codes for Human Thinking“
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
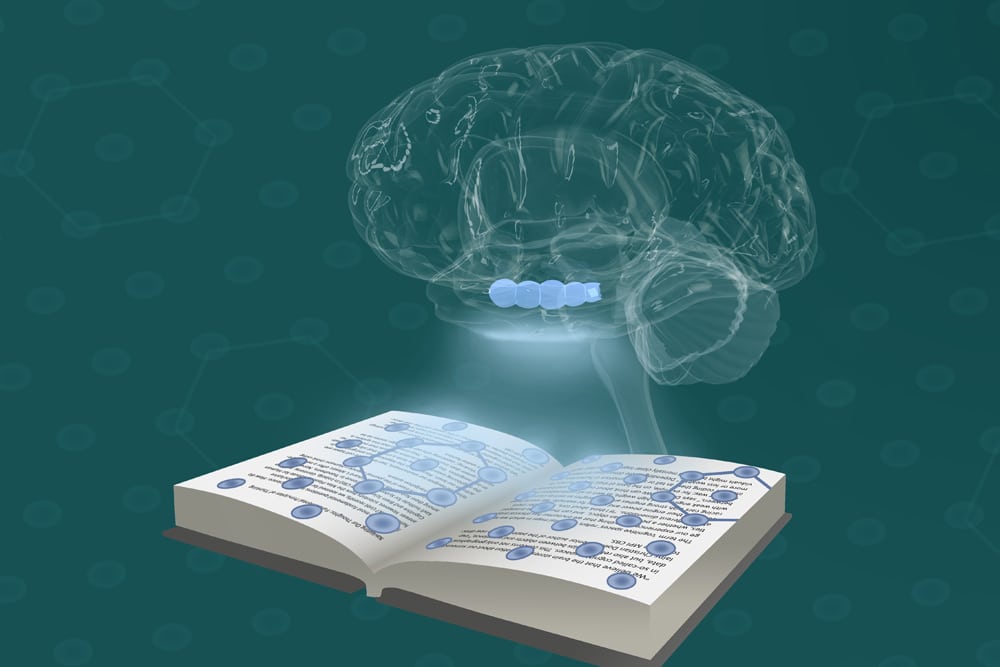



Keine Kommentare bisher