Von vier Schüssen durchlöchert präsentiert sich das jüngste Buch von Benjamin Fredrich, den meisten bekannt als Katapult-Gründer, studierter Politikwissenschaftler. Und hier zeigt er mal an einem brennend aktuellen Thema, was Politikwissenschaftler zu einem Thema wie „Krieg“ zu sagen haben. Und wie sie die Kriege der vergangenen 225 Jahren ausgewertet und einsortiert haben. Es sind mehr als 100 Friedensfälle aus 100 Jahren Kriegsgeschichte, wie es im Untertitel steht. Die Menge kann einen schon vom Hocker reißen.
Als wären Menschen zu blöd, friedlich miteinander umzugehen. Als könnten sie es nur miteinander aushalten, wenn sie sich gegenseitig die Schädel einschlagen und die Dörfer der anderen Menschen verwüsten. Dabei ist das schon seit Jahrtausenden so. Und Fredrich kann einige der großen Denker von Heraklit und Aristoteles über Augustinus von Hippo bis Kant, Rousseau und Hobbes zitieren, die alle ganz unterschiedliche Vorstellungen entwickelt haben, warum Kriege passieren.
Für den einen ist Krieg „der Vater aller Dinge“ (Heraklit), für andere nur ein Zeichen für schlechte Regierungsführung (Platon), für manch Modernen die „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ (Clausewitz). Die einen hielten den Krieg für den Urzustand der Menschheit (Hobbes), die nächsten für ein Produkt der Zivilisation (Rousseau). Und zumindest denken die klügeren Menschen seit Immanuel Kant und seinem Buch „Zum ewigen Frieden“ darüber nach, wie man Kriege vermeiden kann und Konflikte so löst, dass man nicht die jungen Männer in wilden Gemetzeln verheizt.
Männerdomäne Krieg
Das ist schwer, denn das setzt Kompromissfähigkeit voraus, die Fähigkeit, den anderen zu respektieren und die Gründe für Konflikte zu verstehen. Und eine Fähigkeit, die viele nicht mal in ihrer Kinderstube gelernt haben: zurückzustecken und Konflikte nicht auszureizen, „bis jemand heult“. Das fällt Männern statistisch schwerer als Frauen. Mit dem Ergebnis, dass fast alle Kriege auch auf das Konto von Männern gehen. Ausnahmen sind ein paar englische Königinnen und Regierungschefinnen wie Indira Gandhi und Margaret Thatcher. Was auch schon wissenschaftlich untersucht ist. Aber noch nicht komplett.
Denn das Thema, das Fredrich natürlich ausspart, weil es ein wirklich dickes Buch füllen würde, ist die Frage: Wer drängt eigentlich zur Macht? Und warum landen immer wieder Kerle an den Schalthebeln, die am Ende auch zu den gröbsten Mitteln der Politik greifen, um ihren Willen durchzusetzen? Denn wenn man die Macht-Frage stellt, kommt man der Frage, warum Kriege überhaupt entfesselt werden, näher. Denn sie entstehen nicht einfach so. Sie sind auch kein Naturgesetz.
Weshalb man sie auch nicht berechnen kann. Bestenfalls statistisch erfassen und dann sortieren – wie es Fredrich mit Verweis auf mehrere Studien zum Thema tut – in die Arten der Kriegsbeendigung etwa. Mit dem Ergebnis, dass nicht mal die Hälfte der von Fredrich untersuchten Kriege seit dem Jahr 1800 durch totalen Sieg (also in der Regel die Unterwerfung des Gegners) beendet wurde, ein wachsender Anteil durch Kompromisslösungen, einige auch durch den Eingriff von Drittstaaten.
Und ein ziemlich großer Anteil von Kriegen ist lediglich eingefroren, kann also jederzeit wieder aufflammen, weil mal wieder die eine oder andere Seite meint, es sei mal wieder Zeit für blutige Taten. So wie im seit 1949 schwelenden Israel-Palästina-Konflikt.
Kein Jahr ohne Krieg
293 Kriege hat Fredrich untersucht. Das klingt nach viel, ist aber garantiert nicht alles, was da seit dem Jahr 1800 mal ohne, mal mit viel Öffentlichkeit ausgetobt wurde. Einige wichtige Kriege fehlen ganz offensichtlich. Den Ersten Weltkrieg erwähnt Fredrich zwar mitsamt dessen fatalem Finale im Versailler Vertrag, in dem schon der Kern des nächsten Krieges steckte.
Auch die Jugoslawienkriege nennt er kurz als Beispiel für eine moderne Intervention von Drittstaaten, die die Kriegsparteien zum Verhandeln zwangen. Allein hier stecken fünf verschiedene Kriege drin. Und auch den legendären Winterkrieg vermisst man, in dem Stalins Sowjetunion 1939/1940 eine verheerende Niederlage gegen Finnland erlebte. Und auch den sowjetisch-polnischen Krieg von 191 /1920 vermisst man, über den ja bekanntlich Isaac Babel seinen Roman „Die Reiterarmee“ schrieb. Und genauso darf man den Irischen Unabhängigkeitskrieg von 1919 bis 1921 vermissen.
Man kommt also locker auf mindestens 300 Kriege, die seit dem Jahr 1900 angezettelt wurden. Manche als Befreiungskriege, manche als koloniale Eroberungskriege (die besonders im 19. Jahrhundert dominieren), manche als Stellvertreterkriege, als Kriege um Bodenschätze und Landgewinn. Manche einfach auch zur Stabilisierung von Macht. Statistisch führen zwar demokratische Staaten wenige Kriege, weil ihre Regierungen immer einem Wahlvolk verpflichtet sind und bei der nächsten Wahl abgestraft werden können.
Aber Fredrich erwähnt nicht ohne Grund auch Machiavelli, der den Krieb als durchaus rationales Instrument in der Machtpolitik feudaler Fürsten definierte. Was dann Fürsten aller Art immer wieder dazu veranlasste, sich an diesen Ratschlag auch zu halten und ein paar Kriege zu führen. Bekanntester Vertreter dieser gelehrigen Schülerschaft: Friedrich II. von Preußen.
Aber all diese Verweise zeigen natürlich, dass man es bei Kriegen weniger mit Logik zu tun hat, als mit Männern und ihren oft instabilen Machtgefügen. Denn den Clausewitz-Satz kann man auch völlig anders interpretieren: Krieg wird dann zur Option, wenn die Herren am Steuerpult mit friedlicher Politik nicht mehr weiter wissen. Krieg lenkt dann auch von den Problemen im eigenen Land ab.
Die Mühsal von Friedensarbeit
Aber Fredrich hat natürlich einen ganz aktuellen Anlass, über Krieg und Kriegsbeendigung nachzudenken – nämlich den russischen Krieg gegen die Ukraine, der jetzt schon mehr als drei Jahre dauert und der auch in deutschen Wahlen zunehmend eine Rolle spielt, weil einige Parteien sich regelrecht zu Stellvertretern russischer Politik gemacht haben und neben einem sofortigen Waffenstillstand auch noch die Beendigung von Waffenlieferungen an die Ukraine fordern. Also letztlich ihre totale Unterwerfung, genau das, was der Kriegsherr im Kreml will.
Ganz offenkundig zieht das auch bei vielen Wählern, die glauben, dass man so tatsächlich einen Krieg beenden kann. Man opfert eben das überfallene Land. Ist doch eh wurst. Ist es aber nicht. Die Leichtigkeit trügt. Wovon ja auch der mittlerweile zum Parteivorsitzenden der Linken gewählte Jan van Aken in seinem Buch „Worte statt Waffen“ schrieb.
Er weiß nur zu genau, was für eine zähe Arbeit es ist, Kriegsparteien überhaupt an einen Tisch zu bekommen und dann in langwierigen Verhandlungen überhaupt zu klären, wie beide aus diesem Krieg herausgehen können, ohne das Gefühl einer dauerhaften Demütigung zu erfahren. Denn solche Demütigungen sind in der Regel genau der Anlass, der den nächsten Krieg provoziert.
Und dazu kommt das, was in den vergangenen Jahren mühsam aufgebaut wurde: ein System von Sicherheitsarchitekturen, in denen das Gespenst der alten nationalistischen Kriege gebannt wurde. Das beste Beispiel für so ein Friedensprojekt ist die EU. Und da merkt man schon, warum ein Wladimir Putin und seine Anhänger im Westen die EU zerschlagen wollen. Gern aufgepeppt mit der verlogenen Forderung nach Frieden. Wer wieder die alten Kategorien von egoistischen Nationalstaaten feiert, der holt den Krieg, den die Europäer so mühsam gebannt haben, durch die Hintertür wieder ins Haus.
Wenn einer überhaupt nicht verhandeln will
Natürlich überlegt Fredrich auch, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden könnte und zählt auch drei mögliche Szenarien auf, die unter den Politikwissenschaftlern diskutiert werden. Alle drei klingen nicht besonders gut. Und alle derzeit von diversen politischen Akteuren propagierten Forderungen, es solle sofort einen Waffenstillstand geben und es solle (endlich) verhandelt werden, leiden schlichtweg an Ignoranz. Fredrich zählt dutzende Versuche seit 2014 auf, Verhandlungen auf den Weg zu bringen. Doch einer ist schlichtweg nicht bereit, tatsächlich an den Verhandlungstisch zu kommen und von seinen Maximalforderungen abzurücken: Wladimir Putin.
Womit man wieder bei den Gründen wäre, warum Kriege tatsächlich enden. Fast immer spielt dabei eine Rolle, dass eine – oder beide – Kriegsparteien nicht mehr können, ihnen die Waffen ausgehen oder die Wirtschaft in die Knie geht oder das Volk nicht mehr mitspielt. Sie werden also in der Regel durch ganz reale Gegebenheiten gezwungen, über ein Kriegsende nachzudenken. Was zumindest die Fähigkeit voraussetzt, die eigene Haltung ändern zu können.
Was aber leider Autokraten zumeist abgeht. Sie können sich Niederlagen oder nur halbgewonnene Kriege nicht leisten. Und machen – siehe Hitler und Napoleon – immer weiter und spekulieren noch auf den Endsieg, wenn sie den alliierten Gegnern nichts mehr entgegenzusetzen haben.
Und so macht Fredrich im Grunde mehrere Dinge deutlich. Das eine ist die schlichte, aber von einigen politischen Akteuren einfach negierte Tatsache, dass man so einen Krieg, wie ihn Russland gegen die Ukraine führt, nicht einfach von heute auf morgen am Verhandlungstisch lösen könnte, sondern dass das wohl eher eine langwierige und zähe Angelegenheit wird, bei der die Ukrainer eine Menge mitzureden haben.
Und eine andere ist, dass auch ein schneller Friedensschluss das Problem nicht löst, weil er den Grund für den Überfall Russlands auf die Ukraine nicht aus dem Weg räumt – das imperialistische Denken, mit dem Russland alle seine Nachbarstaaten dominieren will. Ein Denken aus der Klamottenkiste der Geschichte.
Da kommt dann nämlich das Volk ins Spiel, der große Lümmel, die Menschen in der Ukraine ganz konkret, die nach drei Jahren Krieg erst recht keine Lust haben, sich wieder unter die Knute Russlands zu begeben. Sie bevorzugen eindeutig das westliche Modell der Demokratie, orientieren sich deshalb nach Europa.
Die Angst der Autokraten vor der Demokratie
Eine Perspektive, die vielleicht bei der Untersuchung der Kriege der jüngsten Zeit etwas mehr Klarheit schaffen könnte, denn etliche dieser Kriege sind die von Autokraten, die jede demokratische Regung in ihrem Land in Blut ertränken. Dafür steht auch der syrische Bürgerkrieg, dafür steht der Bürgerkrieg in Myanmar, dafür steht der Krieg Russlands gegen Georgien. Man hat es also nicht nur mit Staatsmännern zu tun, die an ihrem Kabinettstisch entscheiden, jetzt mal Krieg zu führen.
Man hat es auch mit einer Welt von Männern zu tun, denen jedes Mittel recht ist, jede Veränderung hin zu einer demokratischen Welt zu unterdrücken. Und immer dann, wenn es dem einen Autokraten gelingt, fühlen sich andere Autokraten animiert, es ihnen nachzumachen.
Und so lautet eine von neun Thesen, die Fredrich am Ende aufstellt: „Wie ein Krieg endet, ist entscheidend für einen langfristigen Frieden.“ Und das ist – auch bei aller von ihm geäußerten Skepsis – auch auf den Krieg in der Ukraine gemünzt. Denn ein überstürzter Waffenstillstand, gar ein schnelles Kriegsende, wie es sich ein chaotisch agierender Donald Trump denkt, würden den Konflikt nicht wirklich lösen.
Friedenslösungen sind komplex, sind aber letztlich unmöglich, wenn sich eine Kriegspartei überhaupt nicht bewegen will, weil sie glaubt, dass sie langfristig doch total gewinnen kann.
Ein Buch, das so manchen Friedenswilligen durchaus zum Nachdenken bringen könnte darüber, ob ein einziger Ruf nach Frieden eigentlich genügt, wenn man keine Lösungswege für einen wirklich dauerhaften Frieden im Angebot hat. Wer da lauter Friedenstauben auf seine Wahlplakate malt, aber keine Lösungen bieten kann, belügt seine Wähler. Anders kann man das nicht formulieren.
Benjamin Fredrich „Wie Kriege enden“ Katapult Verlag, Greifswald 2025, 15 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
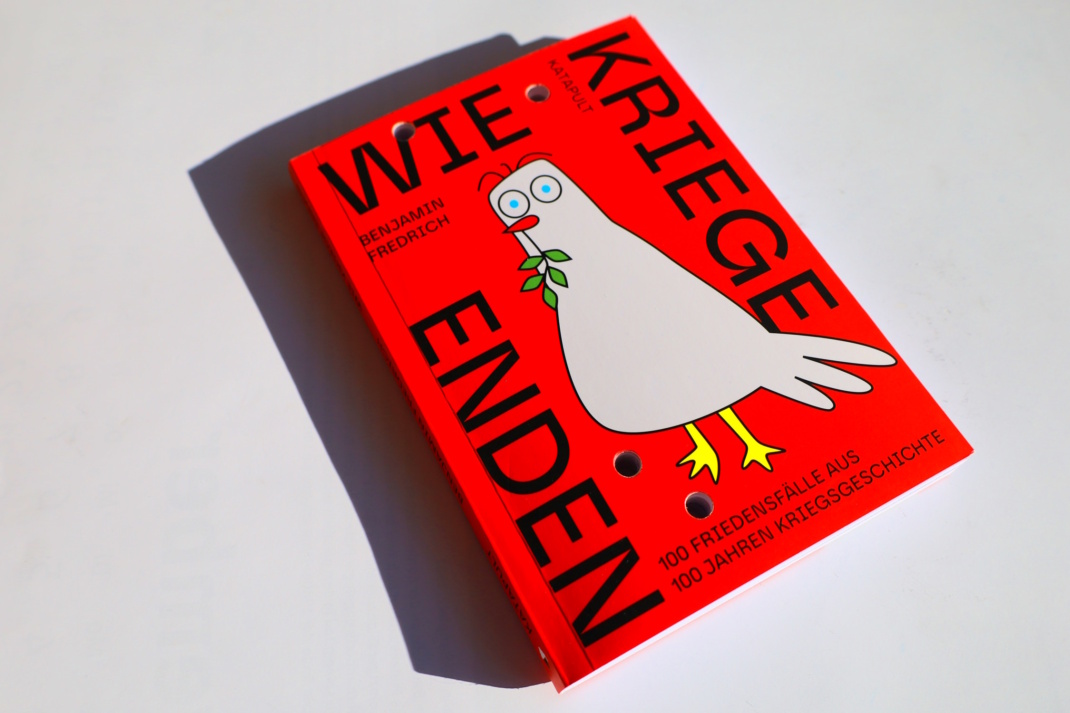




















Keine Kommentare bisher