Der Titel dieses Buches der Professorin für klinische Psychologie an der University of Texas in Austin klingt so, als ginge es hier tatsächlich um das Grundverständnis zur Funktionsweise unserer Gene. Denn Fakt ist: Die meisten Menschen wissen darüber praktisch nichts. Aber der Untertitel der amerikanischen Ausgabe macht deutlicher, worum es Kathryn Paige Harden tatsächlich geht: „Why DNA matters für Social Equality“. Das ist eine Nummer schärfer als „Wie Gene uns beeinflussen“.
Denn Harden geht es um die gesellschaftliche Dimension, um die Rolle der genetischen Forschung in dieser Gesellschaft und um die Frage, warum falsche Vorstellungen von Gleichheit tatsächlich die Menschen in der Vielfalt ihrer genetischen Voraussetzungen nicht nur unfair behandeln, sondern auch diskriminieren. Denn Menschen sind nicht gleich. Sie werden allesamt jeder für sich mit einem völlig unverwechselbaren Strauß genetischer Voraussetzungen geboren.
Das ist der eine Teil der Gen-Lotterie. Niemand kann diese zufälligen Kombinationen, mit denen er ins Leben tritt, beeinflussen. Sie sind genauso unbeeinflussbar wie die Familie, in die man hineingeboren wird, das Land und die Zeit.
Und das heißt eben auch: Sie haben nicht alle dieselben Chancen. Auch wenn es das große Mantra einer freiheitlichen Gesellschaft ist, dass jeder nach seiner Leistung honoriert wird und jeder sich nur genug anstrengen muss, dann wird auch er zum Gewinner. Aber das war schon immer eine Behauptung, die nicht stimmte. Denn welche Chancen ein Mensch in unserer Gesellschaft verwirklichen kann, hängt nicht nur von seinen genetischen Voraussetzungen ab, sondern auch von Armut und Reichtum, von Stand und Klasse also.
Und es gibt mehr als eine Studie dazu, die Harden zitieren und grafisch sichtbar machen kann, wie diese doppelten Voraussetzungen – genetische und soziale Startbedingungen für jeden von uns – zur Lotterie werden.
Eine komplexe Angelegenheit
Sie hat zwar vor allem die USA im Blick, wo die Illusionen über gleiche Chancen für alle und die Belohnung von Leistung noch viel größer sind als in Deutschland. Aber so weit weg sind auch wir nicht von diesen etablierten – und falschen – Vorstellungen von Gleichheit und Gerechtigkeit. Auch wir haben ein standardisiertes Bildungssystem, das – auch statistisch signifikant – vor allem Kinder aus gut verdienenden Haushalten der Oberschicht bevorteilt.
Wie das funktioniert, beleuchtet Harden immer wieder. Sie will wirklich, dass ihre Leser und Leserinnen verstehen, was an unserem Denken über Gleichheit, Wertschätzung und Leistungsgerechtigkeit so falsch ist. Und was das – auch – mit den völlig unterschiedlichen genetischen Voraussetzungen zu tun hat, die jeder mitbringt.
Wobei sie die soziale Dimension nicht ausblendet, die in Teilen selbst wieder durch genetische Voraussetzungen geprägt ist. Denn auch die Eltern der Kinder, die heute ins Leben und ins standardisierte Bildungssystem eintreten, haben ja selbst wieder genetische Voraussetzungen mitbekommen, die ihrerseits das Umfeld prägen, in dem Kinder aufwachsen.
Logisch, dass Harden davor immer wieder warnt, die verschiedenen inzwischen vorliegenden Ergebnisse der Gen-Forschung nur eindimensional zu interpretieren. Dazu ist das alles zu komplex. In den Köpfen vieler Leute existiert ja auch die simplifizierte Vorstellung, dass es zu jeder einzelnen Eigenschaft, die uns prägt, auch ein jeweils genau zu definierendes Gen – oder einen entsprechenden Gen-Defekt – gibt. Was bei einzelnen genetisch bedingten Krankheiten tatsächlich der Fall ist.
Aber schon bei phänotypischen Erscheinungen wie Größe, Augenfarbe, Hautfarbe usw. ist das nicht mehr der Fall, hat die Forschung längst gezeigt, dass für scheinbar konkrete Dinge oft mehrere unterschiedliche Genabschnite „zuständig“ sind, was sich – etwa bei der Körpergröße – auch kumulieren kann.
Erbe ist nicht gleich Erbe
Aber auch viele kognitive Eigenschaften und nicht-kognitive Eigenschaften (wie Lernbereitschaft, Wissbegier, Konzentrationsfähigkeit, Selbstkontrolle usw.) sind genetisch bedingt. Zahlreiche Studien haben sich mit der Frage beschäftigt, ob die Fähigkeiten, im standardisierten modernen Bildungssystem erfolgreich zu sein, eigentlich sämtlich in der Familie angelegt sind, also Ergebnis der frühkindlichen Sozialisation. Doch sie wiesen fast alle darauf hin, dass diese Eigenschaften direkt mit den genetischen Voraussetzungen des Kindes zusammenhängen.
Wobei Harden ein Wort besonders der Kritik unterzieht: Heritage. Also Erbe oder Vererbung. Denn auch das steckt tief in den Köpfen vieler Leute, dass besondere genetische Merkmale einfach vererbt seien und man z. B. eine Gesellschaft in ihrem „Erbgut“ einfach verbessern könnte, indem man Menschen regelrecht aussortiert. Oder auch klont.
Harden ist sehr bewusst, wie schnell so eine Denkweise direkt zur Eugenik führt, deren fatale Entwicklungsgeschichte sie natürlich auch nachzeichnet. Denn das eugenische Denken ist noch längst nicht verschwunden. Eugeniker melden sich nach wie vor mit reißerischen Buchtiteln zu Wort, machen – gerade in den USA – politisch Stimmung und beeinflussen sogar Gesetze.
Denn wenn dieses Denken erst einmal in den Köpfen ist, ist es bis zum Bewerten von Menschen nicht mehr weit. Zum Rassismus, Antisemitismus und zum Überlegenheitsdünkel einer Elite, die permanent von der Belohnung von Leistung redet, aber regelrecht blind ist für die Bevorteilungen, mit denen Kinder aus sowieso privilegierten Familien ihren Lebensweg starten. Sie nehmen gar nicht mehr wahr, wie sehr gesellschaftliche Barrieren und „gläserne Decken“ Menschen aus ärmeren und minderprivilegierten Familien daran hindern, ihre Potenziale zu entfalten.
Wie Bildung aussortiert
Aber was „erbt“ man eigentlich von seinen Eltern in der Gen-Lotterie? Ein ziemlich zufälliges neu zusammengestelltes Gemisch von DNA, in dem die Gene der Eltern jedes Mal völlig neu und zufällig zusammengesetzt werden. Da können sich die unterschiedlichen Gene der Eltern verstärken – oder auch völlig neue Eigenschaften sichtbar machen. Und wie unberechenbar diese Lotterie ist, belegen gerade jene Studien, in denen Mütter von vielen Kindern zur Verteilung von diversen Eigenschaften in der menschlichen Gesellschaft befragt werden.
Sie liegen der tatsächlichen Verteilungskurve jedes Mal näher, als es Menschen ohne oder nur mit wenigen Kindern tun. Denn sie sehen an ihren eigenen Kindern, wie verschieden sie jedes Mal werden, obwohl die Rahmenbedingungen dieselben bleiben. Vom Phänotyp bis hin zu den Eigenschaften, die am Ende den Charakter des Menschen ausmachen.
Aber Harden stellt eben auch fest, dass „Erfolg“ in unserer vom Leistungsdenken besessenen Gesellschaft direkt verbunden ist mit einem möglichst hohen Bildungsabschluss an einer möglichst renommierten Hochschule. Das heißt: Unser Bildungssystem bestimmt, wer am Ende in gut bezahlten Spitzenpositionen landet – und wer nicht. Was übrigens zwei Seiten hat: Nicht nur das Bildungssystem bestimmt „Erfolg“. Es ist auch so standardisiert, dass es ganz bestimmte Eigenschaften präferiert. Es sorgt dafür, dass Menschen, die zum Leistungskanon unserer elitären Gesellschaft am besten passen, in diesem System ausgewählt und gefördert werden.
Und da – in den USA ganz besonders – Geld bestimmt, wer überhaupt welche Stufe der Bildungsleiter erklimmen kann, bestimmen eben auch Voraussetzungen den Bildungserfolg, die von vornherein nicht gerecht verteilt sind. In Deutschland ist das zwar schwächer ausgeprägt. Aber der jämmerliche Kampf ums Bafög zeigt gerade wieder sehr eindeutig, dass auch wir unsere „Leistungs“-Eliten haben, denen überhaupt nicht daran gelegen ist, wirkliche Chancengleichheit herzustellen.
Im Gegenteil: Hinter dem ganzen Gerede von „Leistungsgerechtigkeit“ steckt die Ignoranz einer reichen Oberschicht, die ihre – ererbten – Privilegien für natürlich und selbstverständlich hält und tatsächlich Stereotype der Abwertung vertritt.
Und damit verbunden auch falsche Vorstellungen von nötigen Bildungsreformen. Statt die unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder zu akzeptieren, wird weiterhin so getan, als müssten sich die Kinder nur an das starre Leistungssystem unserer Schulen anpassen und sich nur genug anstrengen.
Blind für Privilegien
Aber wenn das dann einmal statistisch untersucht wird, wie es etwa begabten Kindern aus ärmeren Familien in diesem Bildungssystem ergeht, dann kommt so etwas heraus: „Kinder mit hohen polygenische Indizes und Eltern mit dem niedrigsten sozioökonomischen Status ging es im Erwachsenenalter im Durchschnitt schlechter als Kindern, die niedrige polygenische Indizes hatten, aber wohlhabende Eltern.“
Polygenisch heißt in diesem Fall: Die Kinder besitzen mehrere Genabschnitte, die eigentlich die Voraussetzung für Intelligenz und Bildungserfolg sind. Nur können sich ihre Eltern die höheren Schulen für diese Kinder nicht leisten. Sie scheitern also in ihrer Bildungskarriere früh, landen in Jobs, die sie überhaupt nicht befriedigen – und sind damit auch stärker in Gefahr, im Leben zu scheitern.
Dass sie öfter scheitern, wird dann von den eigentlich Profitierenden gern als Argument genutzt, dass sie schlichtweg die (genetischen) Voraussetzungen nicht haben, um im Land der Erfolgreichen und Privilegierten selbst Erfolg zu haben.
Womit auch sichtbar wird, dass das eugenische Denken letztlich ein Herrschaftsdenken ist – die Sichtweise einer privilegierten Elite, die sich der (ererbten) Vorteile des eigenen Status gar nicht mehr bewusst ist und das Scheitern für Kinder aus armen Familien für „selbstverschuldet“ oder gar durch „schlechte Gene“ bedingt betrachtet.
Logisch, dass Harden viele Seiten darauf verwendet, nicht nur das falsche Denken der Eugenik auseinander zu nehmen, sondern auch zu zeigen, wie sehr dieses Denken noch heute in den westlichen Gesellschaften verankert ist und sogar zur politischen Keule wird, wenn diese Leute Wahlprogramme und Gesetze beeinflussen.
Ignorieren ist der falsche Weg
Und am Ende wird sie auch deutlich, wenn sie die Nicht-Wahrnehmung der genetischen Voraussetzungen anspricht, die meist gerade liberale Akteure praktizieren, die bei Genforschung sofort an die finstersten Zeiten der Eugenik erinnert sind. Aber Weggucken und Ignorieren sind das falsche Rezept. Denn damit verschwindet das menschenverachtende Denken der Eugeniker ja nicht. Im Gegenteil: Es wird zum Kampfmittel populistischer und rassistischer Bewegungen.
Was es braucht, ist eine Anti-Eugenik, wie Harden schreibt. Denn nur wenn wir wahrnehmen, dass wirklich alle Menschen mit verschiedenen genetischen Voraussetzungen ins Leben treten und in die Schule kommen – und damit auch mit unterschiedlichsten Startchancen, in diesem standardisierten Bildungssystem erfolgreich zu bestehen, kann man auch wirklich sinnvolle Reformen entwickeln, die aus diesem zwar gleichen, aber unfairen Bildungsystem ein gerechteres Bildungssystem machen.
Denn wenn alle Menschen bei ihrem Eintritt in die Schule die gleichen Bedingungen bekommen, hat das mit Gerechtigkeit nichts zu tun. Gerecht ist, wenn alle Schulkinder jeweils die Förderung bekommen, die ihnen die größtmögliche Entfaltung ihrer Fähigkeiten ermöglicht.
Das würde nämlich auch einen ganz zentralen Glaubenssatz der Eugeniker aushebeln: dass es sich „bei den aktuellen Determinanten von Ungleichheit ‚in Wirklichkeit‘ um nicht überprüfte genetische Unterschiede handelt“. Denn genau das behaupten moderne Eugeniker und Leute, die diese Ansichten unbedacht selbst reproduzieren, nur zu gern: Dass Armut und Misserfolg im Leben genetisch bedingt sind und nicht durch soziale Ausgangslagen bedingt. Doch genau das ist der Fall: Nicht Erfolglosigkeit wird vererbt, sondern Armut. Und die hat nichts mit den Genen zu tun.
Wer definiert eigentlich „Erfolg“?
Dass selbst das Leistungsdenken, das dahinter steckt, willkürlich und ignorant ist, klingt immer wieder an. Denn um in der westlichen Gesellschaft reich und „erfolgreich“ zu werden, braucht man ein ganzes Bündel charakterlicher Eigenschaften, die nicht wirklich zu den guten und hilfreichen sozialen Kompetenzen gehören. Trotzdem prägen sie – bis in die Werbung hinein – das Bild vom Erfolg-haben-Müssen. Wer nicht rücksichtslos genug ist, hat keinen „Erfolg“.
Das schwingt mit, wenn Harden schreibt: „Die Einschätzung der Rolle der Gene und wie diese mit Erfolgen in puncto Bildung und Wohlstand zusammenhängen führt dazu, dass Menschen nicht mehr so häufig kritisiert werden, weil sie nicht genug ‚erreicht‘ haben, und sie könnte auch die Umverteilung der Ressourcen zugunsten von mehr Gleichberechtigung zur Folge haben.“
Was wir aber erleben, ist die Stigmatisierung genau jener Menschen, „die nicht gut ausgebildet sind und Schwierigkeiten haben, in einem Wirtschaftssystem, in dem sich nur ‚gut ausgebildete‘ Arbeitnehmer/-innen behaupten.“ Wobei sich „gut ausgebildet“ hier nur auf höhere Bildungsabschlüsse bezieht – nicht auf die gute Ausbildung etwa von Handwerkern und Dienstleistern, welche diese Gesellschaft auch dann am Laufen halten, wenn sie miserabel bezahlt und in belastenden Schichtdiensten eingesetzt werden.
Selbst dann, wenn sie in ihrem Beruf mehr können als der Jurist, der Manager oder der Bankangestellte, die ihnen – wenn das Leben mal aus dem Gleis läuft – klarmachen, dass sie leider nicht reich genug sind für eine Gesellschaft, die Meritokratie als Summe auf dem Gehaltszettel definiert.
Den „Erfolg“ kann man sich in so einer vom Geld definierten Gesellschaft kaufen. Auch für die Kinder. Das Ergebnis ist dann eine elitäre Oberschicht, die sich ihrer Abgehobenheit nicht einmal mehr bewusst ist. Und die auch nicht sieht, wie sie die sozialen Sicherungssysteme der Gesellschaft so konstruiert, dass die Leute mit wenig Geld wieder benachteiligt oder ausgeschlossen werden. Für die USA sehr typisch. Aber auch für die politische Debatte in Deutschland nicht ganz fremd – egal, ob es um ein ungerechtes Steuersystem geht, falsche Krankenkassenfinanzierung, ein desolates Pflegesystem oder eben ein Bildungssystem, das eben nicht begabte Kinder fördert, sondern Kinder aus wohlhabenden Familien.
Eben auch, weil die genetische Unterschiedlichkeit der Menschen völlig ignoriert wird und sich meistens gerade diejenigen die Hilfe nicht leisten können, die sie am dringendsten benötigen.
Die Verwechslung von Ursache und Korrelation
Und da wird dann oft genug mit dem Wort Chancengleichheit bemäntelt. „Chancengleichheit kann in der Tat unterschiedlich definiert werden“, schreibt Harden, „aber die einfachste Definition ist die, dass alle gleichbehandelt werden.“ Wenn aber alle gleichbehandelt werden, werden alle, die nicht ins Leistungsschema passen, benachteiligt. Oder bewusst behindert und diskriminiert. Oft selbst unterlegt mit scheinbar seriösen Studien, die etwa zeigen, dass schlechter Bildungserfolg mit mehr Kriminalität, Sucht und gescheiterten Partnerschaften einhergeht.
Dass da selbst seriöse Politiker in der Regel nicht unterscheiden können, was tatsächlich Ursache ist und was nur statistische Korrelation, ist bei fast jeder Debatte über soziale Fragen zu beobachten. An den politischen Entscheidungen sowieso – man denke nur an die katastrophalen Folgen von „Hartz IV“, das für alle Menschen, die im Unterbau der Gesellschaft sowieso schon immer von Arbeitslosigkeit bedroht waren, nicht nur eine Ohrfeige war, sondern das Manifest einer Elite, die vom prekären Leben der Menschen „ganz unten“ keine Ahnung hat.
In der Rentenpolitik geht das genauso weiter wie in der Gesundheits- und Pflegepolitik. Und die Vertreter dieser Elite lassen sich tatsächlich keine Gelegenheit entgehen, auch noch nachzutreten.
Wertschätzung statt Bewertung
Wenn man die Streiflichter wahrnimmt, merkt man, wie sehr Hardens Buch eigentlich den Kern unserer Leistungsgesellschaft meint, in der abwertendes Denken über Menschen, die nicht ins Erfolgsraster passen, üblich und akzeptiert ist. Wie sehr das Wort „abwerten“ zutrifft, sieht jeder, der sich in seinem Lebenslauf nur einmal vergegenwärtigt, wie oft er sich Bewertungen gefallen lassen musste. Von der Schule mit ihrem starren Prüf- und Zensurensystem bis hin zu Einstellungsgesprächen und betriebsinternen Leistungsbewertungen.
Das hat mit Wertschätzung des konkreten Menschen nichts mehr zu tun, aber viel mit Standardisierung, Hierarchisierung und Klassifizierung. Da ist kein Platz mehr für die Wahrnehmung des konkreten Menschen mit seinen ganz persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Und damit eben auch nicht für die Vielfalt und den Reichtum einer Gesellschaft, die auch aus ihrem genetischen Reichtum erwachsen.
Und das wurde selbst Harden direkt vor Augen geführt, als sie dieses Buch 2020 mitten in der ersten Corona-Welle schrieb und regelrecht zuschauen konnte, wie das an den Menschen noch nicht angepasste Virus genau unter jenen Menschengruppen seine Opfer fand, deren Gefährdung am größen war, weil sie vorerkrankt, alt oder schlichtweg arm waren – und damit ungeschützt.
Und da wurde auch für Harden noch deutlicher, welche Fragen sich eine Gesellschaft wirklich stellen müsste: „Während das bedrohliche Corona-Virus durch die Vereinigten Staaten und die Welt geistert und Schulen und Geschäfte schließen, fragen sich Menschen, die sich für andere verantwortlich fühlen: Was muss ich tun, um in meiner Community die am stärksten gefährdeten Menschen zu schützen?“
Auf einmal steht nicht der Bonus für die sowieso Erfolgreichen zur Debatte, sondern die Aufgabe der Gesellschaft, ihre schwächeren Mitglieder zu unterstützen und ihnen wirkliche Wertschätzung zu zeigen.
Das wäre eine andere, solidarischere Gesellschaft. Mit anderen Prämissen, die eben auch das berücksichtigen, was meist negiert wird: Die unterschiedlichen genetischen Voraussetzungen aller Menschen, die man – so wie es jetzt geschieht – ignorieren oder gar bestrafen kann, durch Aussieben und Klassifizieren.
Oder akzeptieren kann, um damit jeden Menschen so zu fördern, wie es seinen ganz persönlichen Fähigkeiten entspricht.
Kathryn Paige Harden „Die Gen-Lotterie. Wie Gene uns beeinflussen“, Hogrefe, Bern 2023, 34,95 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
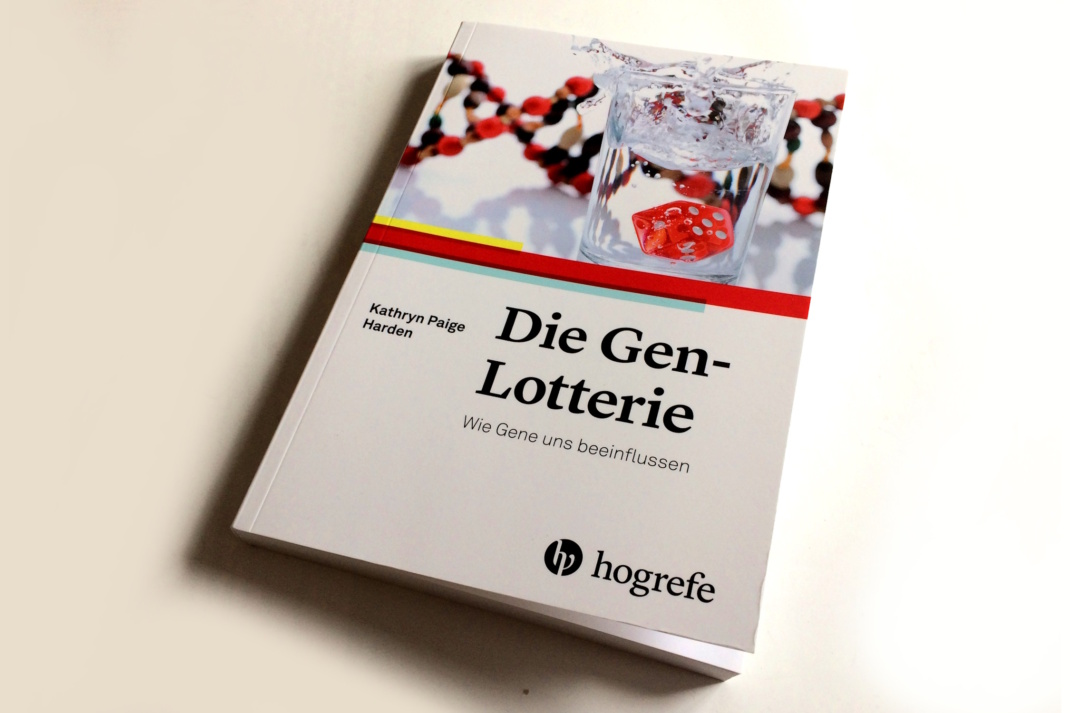






















Keine Kommentare bisher