Manchmal ist man ja richtig froh, das man die verkorksten Leben anderer Leute nicht leben muss. Das geht einem oft nach Woody-Allen-Filmen so. Von amerikanischen Vorabendserien ganz zu schweigen. Vielleicht erinnert sich die eine oder der andere auch noch an Robert Altmans Film „Short Cuts“ von 1993, gedreht nach Raymond Carvers Kurzgeschichten. In Angelika Arends Erzählungen fühlt man sich am Ende meist genauso. Wie ausgespuckt.
Als wäre das Leben einfach ausgelaufen. Und einige der Held/-innen in diesen Geschichten stehen am Ende tatsächlich mit leeren Händen da. Haben sich für ihre Kinder oder ihre Lebensabschnittsgefährten völlig aufgeopfert, Haus und Geld drangegeben. Aber es wird ihnen nicht vergolten. Mal sind es die Erben, die alles an sich raffen, mal schlucken es die Partner/-innen, die sich irgendwann als die falschen erweisen. Und dabei sind es doch eigentlich Geschichten aus der großen, weiten Welt, die Angelika Arend erzählt.Sie wurde 1942 in Leipzig geboren, wanderte 1968 erst nach England, dann nach Kanada aus, arbeitete als Lehrerin, Lektorin und als Professorin für Germanistik. Nach ihrer Emeritierung kehrte sie nach Deutschland zurück und lebt heute bei Potsdam. Wobei auch die Rückkehr so ihre Tücken hatte, zumindest, wenn man die letzte Geschichte in diesem Buch „Im Land der Paragraphen“ so interpretieren kann.
Aber so manche Geschichte liest sich eben doch wie selbst erlebt, miterlebt oder gehört. Und diese seltsame Begegnung mit der deutschen Einreisebürokratie klingt nur zu vertraut. Den Ton kennt man ja selbst aus den paar noch verbliebenen Recherchesendungen im deutschen Fernsehen, wenn die Kommentatoren im Off irgendwie versuchen zu verstehen, warum Ämter und Behörden derart auf staubige Paragraphen fixiert agieren, den größten Blödsinn genehmigen, aber das konkrete Leben der Menschen mit allen Mitteln erschweren und zum Albtraum machen.
Natürlich ahnt man, warum sie es in diesem Fall tun. Denn Paragraphen werden ja von Politikern gemacht. Meist genau von den Politikern, die immerzu herumposaunen, die Bürokratie müsste endlich abgebaut werden. Aber damit meinen sie nie den Ärger, den sie für die Menschen erst schaffen, die sie per Gesetz bevormunden und gängeln, sondern nur die Regeln, mit denen reiche Leute daran gehindert werden, das Land zu plündern.
Was die Menschen unten in der richtigen Welt betrifft, denen bringen die Paragraphen dann ganz schnell bei, dass Politiker, die immer von „Freiheit“ reden, stets das Gegenteil meinen und auch die Macht der Paragraphen dazu nutzen, Menschen das Überqueren von Grenzen, die Arbeitsaufnahme in anderen Ländern, das Studieren und Heiraten zu erschweren oder gar unmöglich machen.
Ihre Wähler merken meist gar nicht, wie schizophren das ist, wie diese Freiheit immer gleich mit Mauern und Stacheldraht ausgeliefert wird. Und dass die Regierenden der sogenannten freien Welt eigentlich über das Denken in Grenzen und Abschottung nie hinausgekommen sind.
Aber war das jenseits des Atlantiks nicht anders?
Anfangs scheint da in diesen Geschichten – allein schon aufgrund der schieren Größe des Landes – einiges anders zu laufen im schönen Kanada, das natürlich in vielen dieser kurzen Geschichten eine zentrale Rolle spielt. Aber wenn wir ehrlich sind, haben wir das Zeitalter der Nationalismen noch lange nicht verlassen. Im Gegenteil: Seit 1990 wurde noch nie so sehr in Grenzen, Abschottung und Ausgrenzung gedacht und gehandelt.
Uralte Verhaltensmuster kommen wieder zum Vorschein, auch solche, wie sie die beiden Liebenden in der ersten Geschichte „Es waren zwei Flüchtlingskinder“ erleben. Denn nicht einmal die Flüchtlinge dieser Welt verlassen in Wirklichkeit ihr Land, ihre Kultur und die Normen ihrer Welt.
Sie nehmen sie überall hin mit. Und das betrifft nicht nur die Menschen aus den islamischen Kulturkreisen, auch wenn das in dieser Geschichte geradezu zum unüberbrückbaren Wasser wird und sich die Liebenden quasi nur mit klug eingesetzten deutschen Sprichwörtern und Gedichtzeilen verständigen können. So wird es tatsächlich fast zu einer Liebesgeschichte, in der diese altvertrauten Zeilen ihre ganze blitzende Schönheit wieder zeigen. Aber es hilft alles nichts, wenn die Eltern noch immer in ihren alten Traditionen stecken.
Traditionen, von denen die meisten nicht mal ahnen, dass sie eigentlich genauso blind und gefühllos funktionieren wie deutsche Bürokratien.
Aber der Umschlagtext deutet ja schon an, dass es Angelika Arend eigentlich um das Wichtigere geht, um „Liebe? Erfüllung? Gerechtigkeit?“ Alles mit Fragezeichen, denn die Heldinnen und Helden ihrer Geschichte finden dergleichen fast alle nicht. Als wären sie blind dafür oder gäbe es so etwas in ihrer Welt nicht. Einer Welt, die tatsächlich frappierend an die Welt Raymond Carvers erinnert.
Eine Welt, in der Menschen zwar fertigbringen, ihren Wohnsitz um hunderte oder tausende Kilometer zu verlegen, auch aufbrechen in das große Abenteuer, so wie der junge Mann aus Deutschland, der gegen die Erwartungen seiner Eltern rebelliert und lieber Pfarrer in einer kanadischen Gemeinde wird, wo er aber trotzdem scheitert, weil die dortige deutsche Gemeinde lieber einen deutschen Pastor vom alten Schrot und Korn wünscht. Man kann auch in der Diaspora alle Borniertheiten der alten Heimat behalten. Kein Problem.
Aber das ist in diesem Fall gar nicht Kern der Geschichte. Das sind eher die verschiedenen Partnerschaften dieses Mannes, der durch sein Leben jagt, sich immer wieder neu erfindet und am Ende auch noch als Bauunternehmer reüssiert. Aber das eigentliche Scheitern steckt in seinen Partnerschaften.
Und damit ist er in diesem Buch nicht der Einzige, dem das so geht, der am Ende auf ein Leben zurückschaut, in dem die Frauen eigentlich eher wie ungeliebte Flugbegleiterinnen wirken, noch immer fremd, als wäre man nie vertraut gewesen miteinander und einander auch nie so nah, dass einen die Trennung wirklich geschmerzt hätte.
Und wer Carver gelesen hat, hat sich sowieso viele Gedanken darüber gemacht, was Menschen eigentlich unter Liebe und Partnerschaft verstehen, oder ob sie sich mit Äußerlichkeiten (Geld, Aussehen, Status, Haus, Auto) zufriedengeben und eine Partnerschaft tatsächlich nur als Zweckgemeinschaft verstehen, in der jeder seine Aufgaben hat. Und wer diese (oft stillschweigend vorausgesetzten) Aufgaben nicht erfüllt, kann wieder gehen.
Wobei natürlich auch der Gedanke mitschwingt: Sind das nicht die Vorstellungen älterer Generationen? So wie in „Herr Mann und seine Frau“, in der dieser in Kanada Karriere machende Professor seine Frau behandelt wie eine Angestellte, die bitteschön nicht zu flennen, aber zu funktionieren hat?
Ist es heute anders?
Eine Generation, in der Frauen so etwas noch mit sich machen ließen. Sind Angelika Arends Geschichten tatsächlich Geschichten aus einer vergangenen Zeit, einer Zeit, die heute selbst in Filmen so verklemmt und patriarchisch wirkt, dass man die Handelnden eigentlich nur noch bedauern kann? Wahrscheinlich nicht. Denn wenn man genauer hinschaut, handeln auch die jüngeren Generationen nicht viel anders, sind Job, Karriere und Image wichtiger, als diese ganze mühsame Aufmerksamkeit für die Mitmenschen.
Man lebt aneinander vorbei, was Arend in der Geschichte „Postum“ erzählt, in der der Sohn erst aus dem hinterlassenen Brief der Mutter an die Enkel erfährt, wie sehr man sich die ganze Zeit missverstanden hat, lieber seine Abwehr und seine Vermutungen gepflegt hat, als zu versuchen, einander tatsächlich zuzuhören. Übrigens beidseitig. Es nutzt ja nichts, wenn nur eine Generation spricht und die andere so tut, als wäre alles selbstverständlich.
Besonders frappierend wird dieser Egoismus in der Geschichte „Luftpost“, die eigentlich nur aus lauter Liebesbriefen besteht, in denen sich der Schreiber regelrecht aufplustert in seiner Fähigkeit, toll ziselierte Liebesbriefe zu schreiben. Nur um am Ende regelrecht vorwurfsvoll zu schreiben, dass er im richtigen Leben zu feige ist, seine Gefühle zu zeigen. Was soll das? Oh ja, es ist eine Geschichte, da möchte man am Ende aufspringen und einen alten Narren übers Knie legen.
Im Grunde kreisen viele dieser Geschichten um die Frage, warum so wenige Menschen wirklich ihren Gefühlen vertrauen und tatsächlich ihrer Liebe folgen. Denn wäre es anders, müsste die Heldin in „Noch einmal“ sich nicht die seltsame Frage stellen: „Muss ich denn immer an so einen Kerl geraten? Oder sind die alle so? Liegt es an mir?“
Die Erzählerin hat sich hier mal wieder an einen „Kerl“ gehängt, der ihr irgendsoetwas wie Liebe vormacht, obwohl er sie eigentlich nur als bessere Haushälterin ausnutzt, sie auch noch Miete zahlen lässt, sodass selbst die Kinder am Ende bezweifeln, dass die beiden wirklich ein Paar waren, sie bestenfalls eine seiner Geliebtem. Denn eine andere alte Flamme hat er sich ja auch noch gegönnt in der Zeit, aber immer so getan, als müsste er das nur noch klären, dann wäre er endlich frei. Oder was auch immer.
Als würden die eigentlichen Heldinnen und Helden in diesen Geschichten nie dazu kommen, ihr eigenes Leben zu leben, sich nie all diese Zumutungen verbitten und auch nie ihrem Herzen folgen. Das tut nicht mal der emeritierte Professor, der sogar seine Schriften und Bücher entsorgt, als wäre sein Beruf nie sein Leben gewesen. Und nun wundert er sich, dass er auch keine stabile Partnerschaft (mehr) findet.
Noch so eine Frage: Wie viele Leute besetzen eigentlich einfach Posten und Professuren, ohne irgendein tieferes Interesse für das, was sie tun? Als wäre in dieser Welt jeder Job eigentlich nur dazu da, um eine Zeitlang Geld zu verdienen, irgendeinen Titel zu tragen und in der Welt herumzudozieren. In diesem Fall über Goethe und Heine, was einem sowieso seltsam vorkommt. Stecken die Gemanistik-Lehrstühle in Kanada tatsächlich noch bei Goethe und Heine fest? Ist da nicht mehr? Arme Germanistik.
Nichts als Talmi
Aber auch das ähnelt den Lesegefühlen nach Carver-Geschichten: So rechtes Bedauern mit all diesen Leuten mag nicht aufkommen. Obwohl man zuweilen das Gefühl bekommt, dass man diese Leute eigentlich schon mal getroffen hat. Denn sie erzählen ja so wahnsinnig gern von ihrem Leben und ihren abgelegten Partnern, all den Bitterkeiten, die sich irgendwann ansammeln, wenn eine oder einer sich ein Leben lang bemüht hat, irgendeine Rolle zu spielen.
Und hinterher für den Rest des Lebens beleidigt ist, weil das nicht honoriert wurde. Oder gar so schäbig ausgeht, weil die Kinder … Aber Kinder werden so, weil ihre Eltern so waren. Und weil die Gesellschaft so ist. Eine Gesellschaft, die sich auf einmal verflixt ähnelt, so über den Großen Teich hinweg betrachtet. Denn diese ganzen so auf ihr Image versessenen amerikanischen Mittelstandsfamilien ähneln im Habitus und der ewigen Vorwurfshaltung ans „ungerechte“ Leben den Mittelstandsmenschen hierzulande. Es sind dieselben Vorstellungen von Erfolg und Reichtum, die sie teilen, dieselbe Angst vor Nähe und Verständnis. Dasselbe Verständnis davon, wie die Dinge zu sein haben.
Diese Leute prägen mit ihren Vorstellungen vom „Erfolg“ im Leben die ganze Gesellschaft, drücken rücksichtslos ihre kleinen, einfältigen Interessen durch. Und merken meist erst ganz am Ende, dass all das, was sie immer als Erfolg verkauft haben, nichts als Talmi ist – das ganze falsche Gold, mit dem man ruhmredig versucht, die genauso bornierte Nachbarschaft zu beeindrucken, während am Küchentisch längst das Schweigen eingezogen ist und eigentlich jeder nur noch davon träumt, die Koffer zu packen und irgendwohin ganz weit wegzuziehen, weg von diesem immer beleidigten und unzufriedenen Besserwisser am Tisch.
Also alles in allem keine romantischen Geschichten aus den schönen Weiten Kanadas, sondern eher lauter Geschichten über das immer neue Scheitern von Liebe, Nähe und Gerechtigkeit in einer Mittelstandswelt, in der eine notariell beglaubige Besitzurkunde immer wichtiger ist als diese ganze schöne Zeit vor dem Tod, in der man hätte ehrlich und liebevoll zueinander sein können.
Und wenn sich einige Leute nach Lesen dieser kurzen Geschichten entschließen sollten, schleunigst die Scheidung einzureichen, würde mich das auch nicht wundern. Denn an dieser Stelle stimmt der alte Adorno-Satz nun einmal: „Es gibt kein richtiges Leben im falschen.“ Wer sein Leben an den Sicherheits- und Erfolgsvorstellungen dieser auf Geld, Besitz und Status fixierten Gesellschaft ausrichtet, landet genau in jener Hölle des nicht mehr Sagbaren, die Carver so eindrucksvoll in kurze Geschichten gepackt hat.
Normalerweise hält das ein Mensch nicht aus. Und mit Liebe oder Erfüllung hat das auch alles nichts zu tun. Aber sehr viel mit genau den riesigen Distanzen, die sich die dem Gelde und dem Erfolg Nachjagenden anlegen in Beziehung auf andere Menschen. Nur ja nicht nahekommen lassen. Nur ja nicht zulassen, dass man sich wirklich versteht und auch die Verletzlichkeiten des anderen zulässt.
Die kommen so gar nicht vor in den Geschichten von Angelika Arend, die eher auf eine sehr nachdrückliche Art davon erzählt, wie viele Menschen sich einander verkaufen und dann selbst das Gemeinsame über den Besitz definieren. So wie in „Goldene Fessel“, in der der männliche Part der Geschichte seine Partnerin fortwährend mit teuren Schmuckstücken beschenkt, die auf seltsame Weise immer wieder abhandenkommen. Abhängigkeit durch teures Beschenktwerden.
Manchmal fragt man sich wirklich, warum nicht fortwährend Leute schreiend aus den Häusern laufen, weil sie diese Art Partnerschaften nicht mehr aushalten. Wahrscheinlich ist es sogar ein Märchen, dass die meisten Menschen Liebe suchen. Die meisten versuchen nur ein Leben lang, die Erwartungen anderer zu erfüllen und dabei möglichst gut dazustehen.
Und natürlich auch anderen Leuten solche Erwartungen einzureden, angefangen bei den eigenen Kindern. Aber freilich auch bis in die Werbung hinein, an der sich ja seit 1993 nichts wirklich geändert hat. Es werden noch immer dieselben Talmi-Vorstellungen vom „richtigen“ Leben beworben. Was Liebe ist, erfährt man nämlich erst, wenn man diesen ganzen Schrott hinter sich lässt und auf die Suche geht nach Menschen, die einen wirklich berühren.
In diesem Buch tauchen sie erst ganz am Ende auf, wo sie sich dann freilich mit der deutschen Bürokratie herumschlagen. Aber das passt dann auch irgendwie wieder. Eine solche Bürokratie braucht man in einer Welt der blasierten Wertvorstellungen und Talmi-Gefühle.
Angelika Arend Der Himmel aber ist immer blau, Mitteldeutscher Verlag, Halle 2021, 12 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
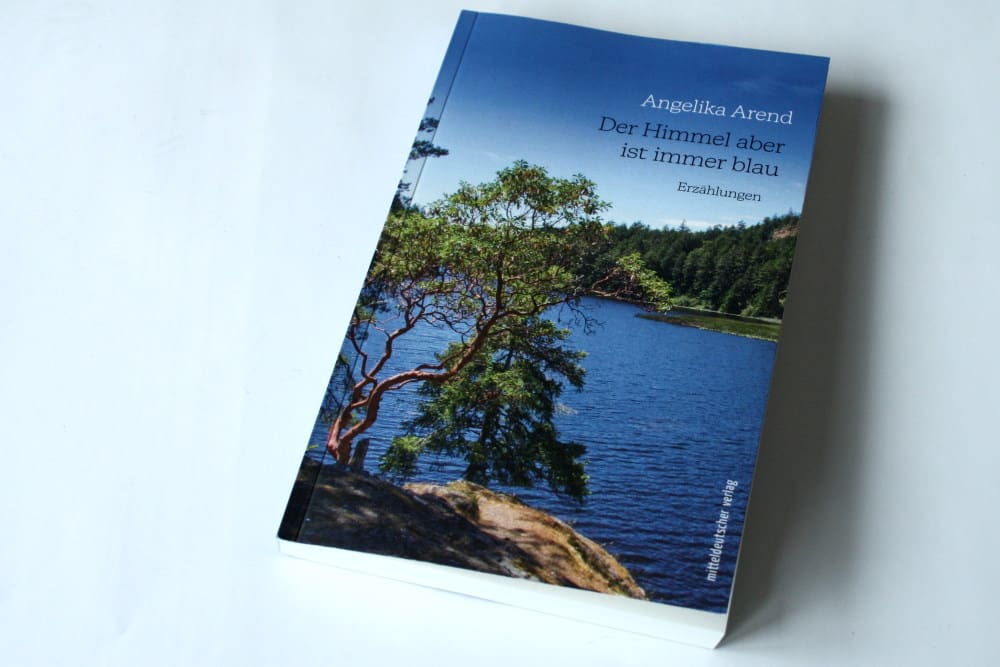





















Keine Kommentare bisher