Im Angesicht der aktuellen Weltprobleme sind die deutsch-deutschen Befindlichkeiten natürlich eher nur eine Fußnote, ein winziger Nebenschauplatz mit viel Gekränktheit. Aber das (teilweise) Misslingen der Deutschen Einheit erzählt eben auch vom Misslingen der europäischen Einheit. Und das wird sogar sichtbar, wenn Michael Hametner nur die zwei Felder untersucht, auf denen er journalistisch tätig ist: Literatur und bildende Kunst.
Die europäische Ebene berührt er nur an wenigen Stellen, an denen er fast beiläufig bemerkt, wie sehr das vereinigte Deutschland davon profitiert hat, dass mit seinem östlichen Teil eine Menge Ost-Kompetenz, auch in Bezug auf den gesamten europäischen Osten, in die Einheit kam, im politischen genauso wie im wirtschaftlichen Sinn.
Weshalb Deutschland bis heute auch fast der einzige Kommunikator ist, der überhaupt noch einigermaßen vermittelt zwischen den renitenten osteuropäischen Staaten und dem Westen der EU. Und dasselbe mit Russland.
Das große Schweigen nach dem Streit der Neunziger
Aber wie gesagt: Das ist nur ein kleiner Aspekt, den Hametner nur erwähnt, der seit den frühen 1990er Jahren das Ressort Literatur bei MDR Hörfunk betreute und sich nach seinem Ausscheiden intensiver mit der ostdeutschen Kunst beschäftigt hat. Im Mitteldeutschen Verlag hat er ja mittlerweile ein halbes Dutzend Bücher veröffentlicht, in denen er sich vor allem mit markanten Leipziger Malern über das Kunstschaffen, die Kreativität, aber auch den Kunstmarkt und die Probleme beschäftigt, die es heute immer noch im deutsch-deutschen Kunst-Diskurs gibt.
Der eigentlich kein Diskurs ist, sondern eher ein großes Schweigen nach dem Riesenrabatz der 1990er Jahre, als das große deutsche Feuilleton im Grunde die bissige Haltung von Georg Baselitz übernahm, der die Kunst in der ehemaligen DDR nicht nur als Staatsmalerei verdammte, sondern ostdeutschen Malern überhaupt die Fähigkeit zum Malen absprach.
Kunstschaffende in der DDR: Es gibt nicht nur schwarz und weiß
Wobei ein Georg Baselitz nicht das Problem war. In seiner Haltung können durchaus alte Verletzungen eine Rolle spielen, stellt Hametner fest. Denn 1990 war ja nicht nur der west-ostdeutsche Dialog überfällig, der vorher 40 Jahre lang nicht stattfinden konnte, sondern auch der ostdeutsch-ostdeutsche Dialog (der genauso wenig hatte stattfinden dürfen). Denn die Kunst des Ostens war ja noch viel stärker zerrissen als die zwischen Ost und West. Und es gab sie ja tatsächlich, die Künstler, die der alleinseligmachenden Partei die Propagandakunst anfertigten, die diese sich wünschte.
Es gab freilich auch die Künstler, die bei aller Abhängigkeit von Amt und Ehren trotzdem eine eigene Kunst- und Bildsprache suchten und fanden. Dafür steht zum Beispiel die Leipziger Schule um Tübke, Heisig, Mattheuer und ihre Schüler. Dann waren da aber auch die vielen marginalisierten Künstler/-innen im Land, die die ganze Breite der Kunststile der Moderne (und Vormoderne) pflegten und deshalb nicht ins Schema der Parteioberen passten und deshalb nicht nur bei Staatspreisen, Aufträgen und Posten ignoriert wurden, sondern auch bei Ausstellungen und in Besprechungen.
Hunderte anregender Künstler/-innen, die mit dem propagierten „sozialistischen Realismus“ nichts am Hut hatten, die aber 1990 noch einmal erlebten, was sowieso schon ihre Lebenserfahrung war: Denn da sie keine Preise und Titel hatten, waren sie im Westen erst recht nicht bekannt und wurden ignoriert – oft bis heute.
Die Kunst und der Markt
Und nicht zu vergessen die streitbarste Gruppe: die Künstler aus dem Osten, die in den Westen gegangen waren – von Penck über Baselitz bis zu Grimmling. Und zu Recht geht Hametner auf die letztlich fragwürdige Rolle des großen (west-)deutschen Feuilletons ein, das diesen Streit nur zu gern aufgriff und fortan als Keule benutzte. Vielleicht auch aus Unwissen und Ignoranz. Die Frage muss auch Hametner offen lassen.
Denn wenn die entsprechenden Redakteure in den großen westdeutschen Magazinen und Sendern allesamt nur im Westen sozialisiert sind und auch nur westdeutsche Hochschulen besucht haben, kann man nicht unbedingt damit rechnen, dass sie die Kunst aus dem Osten überhaupt kennen. Wobei Hametner durchaus auch anmerkt, dass Kunstkritik auch blind werden kann, wenn sie seit Jahrzehnten gewohnt ist, dass eigentlich der Markt Künstler „macht“ und jene Künstler doch die ausschlaggebenden sein müssen, die die höchsten Preise am Kunstmarkt erzielen.
Künstlich aufgebaute Unzugänglichkeit
Da fehlt nicht nur Hametner der professionelle Blick dieser Wortführer auf Marktmechanismen. Und auf die nur leise diskutierte Tatsache, dass sich die westdeutsche Moderne schon kurz nach Beuys totgelaufen hatte. Sozusagen totvermarktet. Es kam nichts mehr nach, was irgendwie spannend gewesen wäre. Anders als im Osten, an dem sich das westdeutsche Feuilleton auch deshalb so rieb, weil dort bis heute jede Menge gegenständlicher Kunst geschaffen wird.
Das, was im Westen als erledigt und von vorgestern betrachtet wurde. Was Ausstellungsbesucher meist anders sehen. Denn wenn Kunstwerke erst noch einen langen Erklärtext brauchen, damit man übehaupt was damit anfangen kann, darf man das mit gutem Recht eine Barriere nennen. Eine künstlich aufgebaute Unzugänglichkeit von Kunst.
Professionalität und Offenheit sind kein Widerspruch
Davon erzählt ja bekanntlich auch der Erfolg der Neuen Leipziger Schule, die eine hohe handwerkliche Professionalität mit dem Willen zur Lesbarkeit verband. Und verbindet. Man sollte Kunstkritikern niemals glauben, die irgendeine Stilrichtung für tot erklären. Das ist selten mehr als die Eitelkeit eines Mannes, der glaubt, richten zu können wie ein König.
Das tun etliche nach wie vor. Und haben es auch als Museumsdirektoren und Kuratoren immer wieder getan in den vergangenen Jahren. Woraus sich dann auch schon ein veritabler Kampf um die Deutungshoheit auf Wikipedia entwickeln kann. Denn als Hametner den Wikipedia-Artikel zu Achim Preiß aufrief, war dort mal wieder kein Wort zu der von ihm kuratierten Ausstellung „Aufstieg und Fall der Moderne“ 1999 in Weimar zu finden.
Inzwischen findet man den Hinweis wieder samt einer Verlinkung zum „Weimarer Bilderstreit“, der zumindest ahnen lässt, welche Gräben diese Ausstellung damals aufriss. Dafür fehlt der Hinweis heute im Artikel zu „Gauforum Weimar“, wo diese kunstwissenschaftlich völlig missratene Gleichsetzung von NS-Kunst und ostdeutscher Kunst stattfand.
Es war nicht alles Staatskunst
Hametner nennt noch mehrere Ausstellungen in diesen vergangenen 30 Jahren, in denen der Spagat gründlich misslang, weil sich die zumeist westdeutschen Kuratoren in der Kunst Ostdeutschlands einfach nicht auskannten und immer wieder die primitiven Schablonen des westdeutschen Feuilletons übernahmen, die letztlich auch der Versuch einer Marktbereinigung waren, wie Hametner feststellt.
Wer alles, was im Osten entstanden war, in die Mülltonne „Staatskunst“ stecken kann, muss sich mit der lebendigen Kunstszene zwischen Ostsee und Erzgebirge nicht beschäftigen, nicht mit ihrer Vielfalt und auch nicht mit den vielen Künstler/-innen, die vorher schon keine Lobby hatten.
Wo ist sie, die deutsch-deutsche Kunstgeschichte?
Und das hat den Effekt, den Hametner im zweiten Teil des Buches sehr genau herausarbeitet, dass es bis heute nicht mal den Versuch gibt, die Kunstentwicklungen in beiden deutschen Teilen in einer großen, gemeinsamen Kunstgeschichte zu vereinen und das Gemeinsame und Parallele sichtbar zu machen. Was ja auch voraussetzen würde, dass man ostdeutschen Künstler/-innen zugesteht, eigenständig und selbstbewusst Kunst geschaffen zu haben.
Denn genau darum geht es. Und Hametner nennt es auch beim Namen: Bis heute dominiert nicht die Kunstkritik, sondern die Gesinnungskritik. Obwohl die so wertenden Autoren meistens gar nichts wissen über die Künstler, über die sie urteilen.
Die Demontage ostdeutscher Literaten
Und dasselbe gilt – so sieht es Hametner – auch in der Literatur, wo er nach 1990 gleich mehrere Kampagnen aufzählen kann, in denen bislang gefeierte und geachtete ostdeutsche Autor/-innen regelrecht desavouiert und demontiert wurden. Natürlich ging es da von Anfang an um Deutungshoheit. „Sie klammerten sich an die Deutungshoheit über das literarische Erbe der DDR.
Die Feuilletonisten der Leitmedien wollten es sich um keinen Preis entgehen lassen. Das hatte einen einleuchtenden Grund. Ulrich Greiners Meinung ist vollkommen zuzustimmen: ‚Wer bestimmt, was gewesen ist, der bestimmt auch, was sein wird. Der Streit um die Vergangenheit ist ein Streit um die Zukunft.‘“
Das hat Folgen bis heute. Und warum das so ist, steckt für Hametner in einer Ansage, die der wirkmächtigste westdeutsche Literaturkritiker, Marcel Reich-Ranicki, schon am 30. November 1989 im Literarischen Quartett gemacht hatte: „In Deutschland hat eine Revolution stattgefunden. Und wann immer auf dieser Erde eine Revolution stattfindet, erzählen die Schriftsteller gern, sie, die Schriftsteller, hätten dazu wesentlich beigetragen. Wie ist das, haben eigentlich in der DDR die Schriftsteller gesiegt oder versagt?“
Breites Desinteresse für ostdeutsche Autoren
Das war schon damals gequirlter Käse und erzählte eigentlich damals auch schon davon, dass selbst ein MRR die Rolle von Literatur nicht verstanden hat. Und auch nicht die der Wirksamkeit der Bücher in der DDR. Denn auch dort musste man sich die hohen Auflagen erst einmal erschreiben und das Herz der Leser/-innen erobern. Die Auflagen gab es nicht geschenkt und schon gar nicht den Ruf, dass Titel von Hein, Heym oder Wolf nur „unterm Ladentisch“ zu bekommen waren.
Doch die Macht, den Ruf von Autoren zu zerstören, hatten damals und haben heute ausschließlich die großen westdeutschen Medien. Darüber haben wir uns ja im März sogar mit einem freundlichen Leipziger Kollegen zerstritten, der unsere Analyse seiner für die Otto-Brenner-Stiftung erstellten Studie „30 Jahre staatliche Einheit – 30 Jahre mediale Spaltung“ für völlig daneben hielt.
Aber Michael Hametner hat selbst beim MDR dieselben Erfahrungen gemacht wie wir mit der Leipziger Internet Zeitung: Das, was bei uns geschrieben steht oder gesendet wird, selbst beim scheinbar großen MDR, interessiert in den großen deutschen Leitmedien nicht. Selbst wenn wir uns bemühen, richtig guten ostdeutschen Autor/-innen Sichtbarkeit zu verschaffen, interessiert das nicht.
Die Revolution gab es allein in der DDR
Was wichtig und richtig ist, wird in westdeutschen Redaktionsstuben entschieden. Und dort denkt nicht mal einer drüber nach, dass die deutsche Einheit gerade auf der Ebene von Kunst, Literatur und Medien bis heute nicht vollzogen ist. Genau dort, wo bis heute immer wieder die heftigen Schlachten ausgetragen werden und gut bezahlte Redakteure ihre Urteile fällen über einen Landesteil, den sie überhaupt nicht kennen und der sie auch nie interessiert hat.
Denn auch Hametner kann konstatieren: Im Osten musste sich alles ändern, auch für Autoren und Künstler, im Westen nichts. Deswegen war Marcel Reich-Ranickis Behauptung auch falsch: Nein, in Deutschland hat keine Revolution stattgefunden, jedenfalls in jenem Deutschland nicht, das westdeutsche Redakteure heute nach wie vor gern als das maßstabgebende Deutschland behaupten, von dem Ostdeutschland immer noch als nicht-dazugehörend abgegrenzt wird.
Die Revolution hatte nur in der DDR stattgefunden. Und mündete eben leider in vielen Bereichen in eine neue Bevormundung, in der sich viele Ostdeutsche einfach nicht respektiert sehen. Was – so taucht es als These am Ende des Buches auf – auch in jene Trotzreaktion führt, die man heute gerade in der ostdeutschen Provinz mit ihren seltsamen chauvinistischen und nationalistischen Tönen findet.
Wenn man sich als Bürger 2. Klasse fühlt
Auch das ist ein – sehr schräger – Versuch, irgendwie doch noch seine Dazugehörigkeit zu behaupten, indem man sich quasi zum besonders deutschen Deutschen macht und den hellblauen Nationalisten sein Kreuzchen gibt. Irgendwo muss ja das Selbstbewusstsein herkommen, wenn man schon im sonstigen Leben immer das Gefühl hat, nur „Bürger 2. Klasse“ zu sein.
Was wieder aber damit zu tun hat, dass es einen wirklich ernsthaften deutsch-deutschen Dialog nie gegeben hat. Selbst der Zustandsbericht zur deutschen Einheit wurde erst Wochen nach den Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit veröffentlicht. Warum nur, fragt Hametner. Die Antwort könnte in der Zustandsbeschreibung liegen. Die Risse sind so tief wie seit 30 Jahren nicht.
Auch ZEIT im Osten ist keine Lösung des Problems
Wobei es gar nicht so sehr um die ökonomischen Unterschiede geht (auch wenn darin jede Menge Brüskierungen und Ungerechtigkeiten stecken, über die ebenfalls nicht diskutiert wird), sondern um das immer wieder neu aufgefrischte Gefühl, nicht dazuzugehören. Und das ist ein mediales Problem. Und zu Recht stellt Hametner fest, dass ein Projekt wie „ZEIT im Osten“ dieses Dilemma nicht löst.
Das ist dann auch eher wieder der Versuch, den Osten irgendwie besonders zu behätscheln, ohne dass das im Westen jemanden stört. Der Osten hört so nie auf, das Außer-Ordentliche zu sein, das seltsame Land da hinten, in dem seltsame Menschen wohnen. Er wird nicht wirklich als selbstverständlicher Teil des Ganzen gesehen.
Eines Ganzen, von dem bislang vor allem Ostdeutsche spüren, dass es nicht ganz ist. Denn sie sind es ja, die vor verschlossenen Türen stehen oder die Ablehnungen bekommen, weil sie die falsche Biografie und lauter zerstückelte Lebensläufe haben. Auch das ist ein Grund dafür, warum 80 Prozent der Leitungsfunktionen im Osten bis heute von Westdeutschen besetzt sind.
Versäumnisse des Einigungsprozesses: Die Zeit ist reif
Nein, es sind nicht die Ostdeutschen, die sich diese Jobs nicht zutrauen. Aber sie fliegen meist schon in der Vorauswahl aus dem Rennen: falscher Stallgeruch oder – schlimmer – gar keiner. Fehlende Bonuspunkte, weil das Geld für Auslandspraktika oder gar Studienaufenthalte an Top-Unis in England oder den USA fehlte. Zu lange gebraucht bis zum Master oder zum Doktortitel, weil sie nebenbei jobben mussten? Pech gehabt. Lauter Minuspunkte, die auch davon erzählen, dass im Osten bis heute das Geld fehlt und sich wohlhabende Eliten West immer wieder aus wohlhabenden Eliten West rekrutieren.
Was Hametner nur andeutet. Aber sein Buch macht deutlich, dass die Zeit überreif ist, endlich mal über all die Versäumnisse der Wiedervereinigung zu reden, die die Trennung bis heute zementieren. Denn dass der Riss noch immer da ist, hat auch mit einer Verweigerung West zu tun: der Verweigerung, sich mit dem Osten überhaupt respektvoll beschäftigen zu wollen. Denn dazu hätte man auch die alte Haltung aufgeben müssen, das allein der Westen der Maßstab für alles ist und der Osten sich bestenfalls anpassen muss. Was eben auch heißt: sich aufgeben sollte.
Einseitige Fixierung auf Westliches
Hametner bringt es im Fall der Kunstdebatte auf den Punkt, wenn er schreibt: „Sie haben keine Bilder, sie haben kein Wissen, sie haben keinen Platz.“
Der Westen wäre so gesehen immer schon fertig, nichts mehr hinzuzufügen. Normsetzend. Und Hametner sucht vergebens nach den großen westdeutschen Museen und Sammlungen (die Sammlung Ludwig ausgenommen), die konsequenterweise ab 1990 auch gleichwertigen Platz für die ostdeutsche Kunstszene geschaffen haben.
Die großen Museen sind vollgestopft mit den Werken der (westlichen) Moderne. Und an den Hochschulen wird augenscheinlich noch immer so abgeschottet vermittelt wie vor 1989, gibt es bis heute keinen Ansatz, die deutsche Kunstlandschaft ab 1945 als etwas Gemeinsames zu sehen, das auch gemeinsam Teil der Weltkunstentwicklung ist.
Warum die ostdeutsche Kunstlandschaft spannender sein kann
Wobei Hametner eben auch kenntnisreich darauf hinweist, dass die ostdeutsche Kunstlandschaft möglicherweise viel spannender und aufregender ist als die zeitgleiche westdeutsche, weil sie eben nicht dem Marktdiktat unterworfen war, sondern „nur“ einer Diktatur, die letztlich viele Künstler/-innen geradezu zur inhaltlichen Auseinandersetzung mit den unaushaltbaren Bedingungen zwang.
Das fasziniert bis heute in jeder Ausstellung von Kunst aus der DDR, diese unübersehbare Auseinandersetzung mit der Rolle des vom Fliegen träumenden Menschen mit einer Gesellschaft, die sichtlich zugemauert und demotiviert war. Nur der Traum war noch da, der sich oft in mythischen Gestalten wie Sisyphos und Ikarus wiederfindet. Wer durch so eine Ausstellung geht, sieht den ringenden Menschen, der um seine Selbstbehauptung in einer Welt kämpft, die das Individuum bevormundet und einengt.
Eine Freiheit, um die westdeutsche Künstler nie kämpfen mussten.
Deutungshoheit in westdeutschen Redaktionsstuben
Und dasselbe Phänomen entdeckt Hametner auch in all den ostdeutschen Romanen, die seinerzeit nicht nur ostdeutsche Leser/-innen in ihren Bann schlugen – von „Spur der Steine“ über „Franziska Linkerhand“ bis zum „Wundertäter“. Eine „Ostpoetik“, die Hametner auch in vielen Büchern ostdeutscher Autor/-innen findet, die nach 1990 erschienen und das Publikum begeisterten. Und die bis heute immer wieder zeigen, wie wichtig ostdeutschen Autor/-innen die Schaffung dichter und markanter Held/-innen ist, die ihren Weg zur Selbstbehauptung suchen und ihren gültigen Platz in der Welt. Da ist also eine ganze Menge, was der Osten eingebracht hat und einbringt in das große Gemeinsame.
Nur gibt es nirgendwo einen sichtbaren Dialog über das Gemeinsame. Denn es ist bis heute so: Die medialen Deutungen über Deutschland und den Osten passieren in westdeutschen Redaktionsstuben, wo man nicht mal ansatzweise eine Vision davon hat, was das Gemeinsame eigentlich sein könnte. Dazu müsste man nämlich die Tür öffnen, die Augen sowieso. Und natürlich auch mal die Bücher dieser Ostdeutschen lesen und ihre Debatten als berechtigt aufgreifen.
Aber natürlich taucht da auch die Frage auf, die man nach 30 Jahren Ignoranz auch stellen darf: Mit wem aus dem Osten müsste eigentlich geredet werden, wenn nicht mal die Intellektuellen wirklich Zugang zu großen Medien haben? Das Ergebnis ist ein riesiges Fragezeichen: „Eine ostdeutsche Elite, die widersprechen könnte, gibt es nicht mehr oder noch nicht wieder. Ihre Reste haben in den seltensten Fällen Zugang zu den Medien.“
Der Pyrrhussieg der Feuilletons
Zu den eher regionalen ostdeutschen Medien schon eher. Aber schon im Fall MDR kann ja Hametner feststellen, dass das, was dort aufgegriffen wird, westwärts niemanden in den ausschlaggebenden Medien interessiert. So kann natürlich keine deutsch-deutsche Debatte entstehen.
Es ist ein Pyrrhussieg, den die Wortführer der großen westdeutschen Feuilletons da in den 1990er Jahren errungen haben: Sie haben ihre alleinige Deutungshoheit, was dazugehört und was nicht, behauptet. Aber damit haben sie das gemeinsame Gespräch für mindestens 30 Jahre verhindert.
Ostdeutsche Kunst kann sich sehen lassen
Logisch, dass sich das heute als Riss bemerkbar macht, der tiefer ist als noch 1991. Bis in die Literatur und die bildende Kunst hinein. Vielleicht ist es jetzt wirklich an der Zeit, endlich darüber zu reden. Nicht nur immer aus der Chefetage über diese unzufriedenen Ostdeutschen, sondern über das, was sie eingebracht haben und was das Gemeinsame eigentlich ist. Und den Ostdeutschen legt Hametner nahe, sich nicht mehr klein machen zu lassen, sondern stolz zu sein auf das Eigene.
Denn die ostdeutsche Kunst zwischen 1949 und 1989 kann sich genauso sehen lassen wie ein Großteil der ostdeutschen Literatur, die immer gegen Widerstände und Ignoranz anzuschreiben hatte. Und auch der Hinweis ist wichtig: Die Revolution 1989 haben allein die Ostdeutschen gemacht.
Das Feld ist eröffnet – nach 30 Jahren
Das ist etwas, was andere noch lange nicht fertigbringen würden. Schon gar nicht Leute, die immer nur darauf beharren, allein der gültige Maßstab für die Welt zu sein. (Was übrigens einen Teil unserer Welt mittlerweile zutiefst verärgert, diese Großkotzigkeit, bloß weil man am richtigen Fleck geboren wurde und von Papa her schon immer reich war.)
Aber bevor wir hier emotional werden: Das Feld ist eröffnet. Mit 30 Jahren Verspätung. Aber Unterlassung ist – historisch betrachtet – nie eine gute Ausrede gewesen.
Michael Hametner Deutsche Wechseljahre, Mitteldeutscher Verlag, Halle/Saale 2021, 14 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
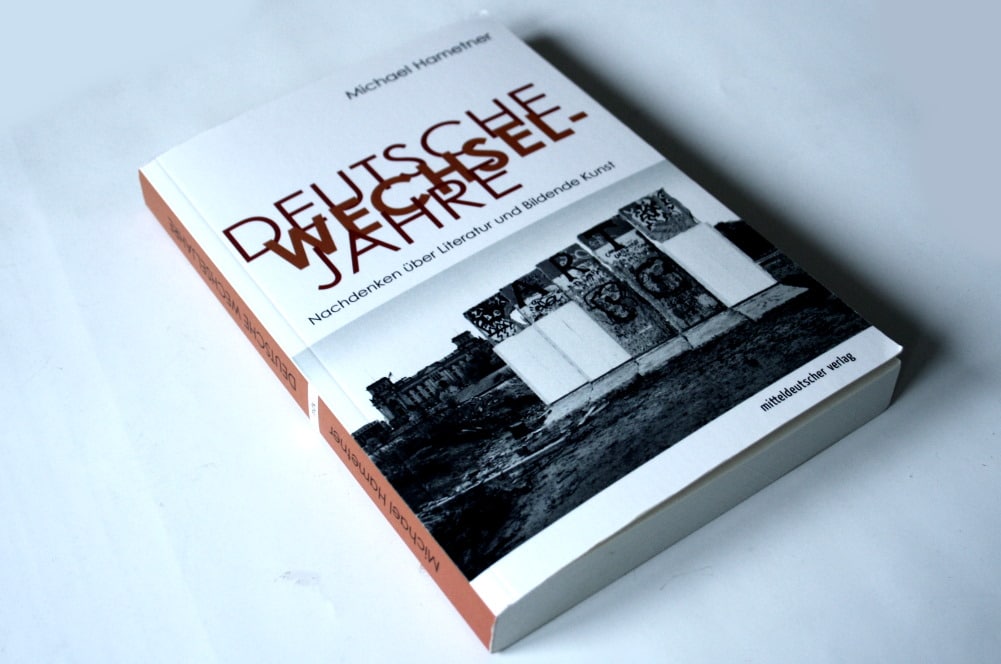






























Keine Kommentare bisher