Es ist noch gar nicht lange her, da wurde in den Medien noch eifrigst über einen Schwammbegriff wie Heimat debattiert. Meistens von irgendwelchen Werte-Politikern, die sich eine offene Welt mit freien Menschen einfach nicht vorstellen können. Bei Heimat denken die meisten Menschen trotzdem an alles Mögliche. Und am kompetentesten können darüber immer noch die Dichter/-innen schreiben. So wie im neuesten „Poesiealbum neu“.
In dem versammelt ja die Gesellschaft für zeitgenössische Lyrik regelmäßig Gedichte zu Themen der Zeit. Vorher gibt’s immer den großen Aufruf. Und dann senden Autor/-innen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum ihre Texte ein. Und weil sie sich frisch mit dem ausgeschriebenen Thema beschäftigen, werden die entstehenden Bände dann wie eine Expedition ins Gewisper der Zeit.
Regelrechte Gegenentwürfe für das meist geist- und gedankenlose Blabla in Politik und Medien. Denn Dichter/-innen nehmen sich heraus, gehen auch mal allein spazieren, um die Gedanken zu sammeln oder herauszufinden, wie sie ein gestelltes Thema tatsächlich berührt, was daran für sie wirklich sagenswert ist. Und wichtig.
Und dann ist ja da noch der Schreibvorgang am einsamen PC oder mit Bleistift auf der Parkbank, oder wo immer man heute so Gedichte in Form bringt. Das Niederscheiben und In-Form-Bringen zwingt zur Konzentration. Und da passiert meist noch etwas Anderes: Die Schreiber/-innen ertappen sich selbst, merken, dass hinter dem So-Hingedachten noch ein Anderes steckt, das Nicht-Ausgesprochene, das Eigentlich-Verstörende.
Da klingt es nur im Hefttitel scheinbar banal, wenn dem Begriff Heimat gleich der Begriff Heimatverlust gegenübersteht. Was so fern nicht liegt, da gerade die älteren Mitglieder der Lyrikgesellschaft noch Kriegs- und Nachkriegskinder sind: Ihnen ist sehr wohl bewusst, wieviele Millionen Deutsche vor 75 Jahren Fluchterfahrungen gemacht haben und wie sie der Status, Flüchtlinge zu sein, noch jahrzehntelang prägte und unterschied von den Nachbarn.
Wer da in die die eigene Familiengeschichte hineinhorcht, der kennt die komplexen Verwirrungen, die dieses Dasein als Zugewanderter mit sich brachte, ganz zu schweigen von den vielen Erinnerungen der Eltern und Großeltern, die ihre Heimat im Herzen mit sich trugen. Das verklärt natürlich den Heimatbegriff – und vermengt ihn mit Herkunft, geografischer und sprachlicher Verortung. Auch das gehört dazu, wenn die in diesem Heft versammelten Autor/-innen ihr Verständnis von Heimat ausloten.
Und es überrascht nicht, dass viele Texte geradezu mit Wehmut eintauchen in die Natur-Bilder aus der Kindheit. Denn das prägt nun einmal fürs Leben. Egal, wo Menschen groß geworden sind. Die Straßen, Gärten, Flüsse und Wälder aus den Kindertagen bilden in der Erinnerung einen Topos, an dem sich alles orientiert und der selbst nach Jahrzehnten noch wirkt und den Maßstab setzt für Vertrautheit.
Da weht einen etwas an – nur dass die meisten Autor/-innen keineswegs so naiv sind, diese Kindheitsorte mit Heimat zu verwechseln. Denn die positive Besetzung mit Gefühlen trügt in der Regel, weil das Gehirn alles in den hintersten Schubladen verstaut, was das Kind damals verstörte. Denn heil sind alle diese Landschaften keineswegs, wie etwa Waltraud Zechmeister feststellt.
Und sage keiner, ihm wären diese Phrasen in seiner Kindheit nicht begegnet: „Heimat / ist blau wie eine Haubitze / assoziiert Blut und Boden / kotzt sich voll an / (…) geht ins Exil / ist nicht kleinzukriegen / verläuft sich in der Fremde …“
Und so Mancher hat selbst beim Lesen solcher Zeilen Dorfidylle vorm inneren Auge, ein hübsches Kirchtürmchen, grasende Schafe und Leute in Trachten, die fröhlich grüßend (wie in deutschen Heimatfilmen) zum Gottesdienst eilen. Heimat ist echter Kitsch für alle. Und trotzdem die „Mitte der Welt“, wie Heidrun Stödtler schreibt.
Nicht nur, weil man immer wieder dorthin zurückkommt, weil dort Vaters Haus steht. Sondern weil man in vielen Situationen im Leben diesen Flashback erlebt, dass man wieder in den alten Kulissen landet: „meine Flüsse sind hier / eh sie verschwinden“. Auch Heidrun Strödtler verbindet, wie man sieht, das Gefühl von Heimat mit dem eigentlich nicht davon zu trennenden „alles fließt“. Die Flüsse bringen es ins Bild.
Und auch die älteren Autoren begreifen Heimat oft auch als Ort, an dem das Bewusstsein dafür entstand (manchmal auch als Erschrecken), dass nichts so bleiben wird. So wie Detlev Block in seinen Gedicht „Hauptbahnhof Hannover. September 1943“: „Ausblick begrenzt, / Fahrpläne unverlässlich / in jeder Richtung / gefährdete Strecken“. Sein Fazit: „gewiss / nur das Eine: / dass keiner bleibt, / wo er ist“.
Geht es noch deutlicher? Heimat ist überhaupt erst greifbar, wenn man weggegangen ist, wenn man vergleichen kann und auch weiß, was unsichere Wege sind. Da muss man gar nicht an all die Menschen denken, die seit 2015 ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rückten und unsere heimischen Merkenixe auf die Straßen brachten. Die nicht einmal begriffen haben, was Marlene Schulz im Nachdenken über ihr Heimat-Gefühl schreibt: „Heimat ist Wertschätzung und Aufmerksamkeit, / dort, wo achtsam mit mir umgegangen wird. – Heimat ist auch da, wo ich achtsam mit mir umgehe.“
Das muss nicht der Ort der Kindheit sein. Man merkt: Es geht um Menschen und menschliche Beziehungen. Und darum, dass man manchmal sogar weggehen muss, um seine Heimat zu finden. Erklär das mal einer den Kleinkarierten, die niemals weggehen, nicht mal dann, wenn sie Flugreisen und Kreuzfahrten buchen. Man muss auch bereit sein, den Kokon zu verlassen, wenn man mal Welt erfahren möchte.
Da erfährt man dann nämlich, dass es „die Heimat“ gar nicht gibt. Wie auch. Wie soll etwas bleiben, wenn die Alten sterben, neue Menschlein geboren werden, andere wegfahren, weil es ihnen daheim zu klein geworden ist? Selbst was scheinbar wirkt, als wäre es schon immer so gewesen, hat sich verändert. Manchmal nicht zum Besseren, was die zeitweilig Heimkehrenden oft schon merken, wenn ihnen das Fremdgewordene am Ortseingangsschild entgehen weht.
Wo also das finden, was auch die Dichter trotzdem Heimat nennen?
Jedenfalls nicht da, wo es die von Schulz erwähnten Erzkonservativen vermuten. Im Gegenteil, schreibt Leipzigs größter Sucher in seinem Gedicht „Markkleeberger Elegie“. Wenn die Spießer anfangen von Heimat zu reden, sollte man wohl schleunigst Fersengeld geben, da möchte man nicht dabei sein. Man erinnere sich an Waltraud Zechmeister: “Heimat (…) liegt im Schützengraben / kann nicht einschlafen / ist verdammt in alle Ewigkeit.“
Und was sagt Leipzigs Sucher dazu? Andreas Reimann: „Und ich?: such ich die freuden, die verlor’nen? / Nur wo man nicht ist, ist das Vaterland.“
Das ist zwar auf die verlorenen Landschaften im Leipziger Süden gemünzt. Aber es impliziert so viel mehr, weil es auch in Worten steckt. Und manchmal kann man sogar froh sein, wenn das Vaterland anderswo ist, das, was andere Leute ja so gern mit schnedderedäng als Heimat hochjubeln, auch wenn es nur ein Phantom ist, ein mit Wagner-Pathos aufgeladener Uniform- und Bühnenklamauk, mit dem die Einvernahme ins Bombastische gesteigert wird.
Mit Dichtern lernt man hinter Ecken sehen und hinter die pathologischen Kulissen. Carsten Stephan greift gar, um sein Entsetzen über die künstlich geschaffene Heimat-Kulisse von Alt-Frankfurt zu beschreiben, zu Heines Wintermärchen-Ton: „Baut endlich die deutsche Stadt wieder auf, / Und gebt uns zurück den Kaiser!“
Aber diese romantische Rekonstruktion eines vergangenen Heimatgefühls entlarvt ja geradezu die Unbehaustheit der Heutigen, die zumindest ahnen, dass das Gefühl des Haltlos-Seins viel mit der eigenen Unfähigkeit zu tun hat, innezuhalten und sich zu erden. Und so ähnelt dieser Zustand von Leuten, die eifrig „Heimat“ rekonstruieren, erstaunlicherweise dem eines wirklich heimatlos Gewordenen: Max Herrmann-Neiße, der sein Gedicht „Heimatlos“ mit den Worten enden lässt: „Die Eingebornen träumen vor den Toren / und wissen nicht, daß wir ihr Schatten sind.“
Er starb 1941 im Exil in London.
Poesiealbum neu „Heimat & Heimatverlust“, Edition Kunst & Dichtung, Leipzig 2020, 6,50 Euro
Hauptstadt der Sehnsucht: Ein ganzes Poesiealbum über die Stadt der unerfüllten Träume
Hauptstadt der Sehnsucht: Ein ganzes Poesiealbum über die Stadt der unerfüllten Träume
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Natürlich werden auch die L-IZ.de und die LEIPZIGER ZEITUNG in den kommenden Tagen und Wochen von den anstehenden Entwicklungen nicht unberührt bleiben. Ausfälle wegen Erkrankungen, Werbekunden, die keine Anzeigen mehr schalten, allgemeine Unsicherheiten bis hin zu Steuerlasten bei zurückgehenden Einnahmen sind auch bei unseren Zeitungen L-IZ.de und LZ zu befürchten.
Doch Aufgeben oder Bangemachen gilt nicht 😉 Selbstverständlich werden wir weiter für Sie berichten. Und wir haben bereits vor Tagen unser gesamtes Archiv für alle Leser geöffnet – es gibt also derzeit auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de ganz ohne Paywall zu entdecken.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere selbstverständlich weitergehende Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
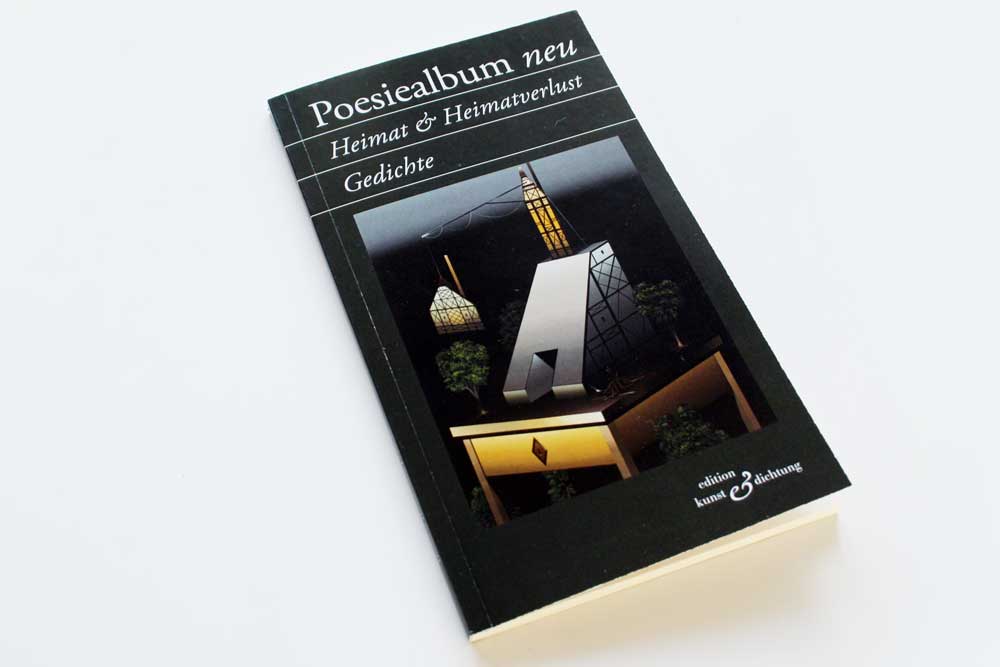













Keine Kommentare bisher