Es hat ein bisschen gedauert. 700 Seiten liest man nicht einfach mal am Abend weg. Erst recht, wenn es 700 Seiten Richard Dawkins sind. Aber es sind 700 Seiten pures Lesevergnügen, Freude fürs Gehirn, Anregung für graue Zellen. Ein Licht in trübsinnigen Zeiten. Also so eine Art „Brief Candle in the Dark“.
So hieß der zweite Band der Biographie des Biologen Richard Dawkins, als er auf Englisch erschien. Der erste hieß „An Appetite for Wonder“. Der Ullstein Verlag hat sich entschieden, beide Bände in einem zusammenzufassen und dem deutschen Lesepublikum zu präsentieren. Recht hat er getan. Denn nach Band 1 ist man hungrig, hat jede Menge Appetit auf Noch-mehr-davon. Und bekommt es im zweiten Band auch.
Denn natürlich ist es ein echter Dawkins. So wie seine wissenschaftlichen Bestseller „Das egoistische Gen“, „Der blinde Uhrmacher“ oder „Gipfel des Unwahrscheinlichen“. Auch wenn er ganz brav anfängt, wie sich das gehört für einen Mann, der sein Leben beschreibt, und die Wurzeln seiner Familie aufarbeitet – da sind ein paar kriegerische Herren darunter, Parlamentsmitglieder, aber auch etliche Priester. Und als Bewohner der tatsächlich sehr vergesslichen mitteldeutschen Landschaften staunt man, wie selbstverständlich so ein Mann seinen Stammbaum bis ins 17. Jahrhundert erzählen kann. Und wie viel englische Geschichte darin steckt – auch jede Menge englische Kolonialgeschichte. Was dazu führte, dass klein Richard nicht nur in Nairobi geboren wurde, sondern auch die frühen Jahre seiner Kindheit in Afrika verbrachte, bevor sein Leben von Internaten im doch etwas feuchteren und kühleren England geprägt war.
Und weil er ja Wissenschaftler ist, analysiert er auch die möglichen Motive, Anstöße, Anlässe oder Veranlagungen, die eventuell vorgezeichnet haben könnten, dass er mal einer der wirksamsten Evolutionsbiologen werden könnte. Das tut er – wie könnte es anders sein – mit Scharfsinn, Liebe zu Geschichten und jeder Menge britischem Humor. Man wundert sich kein bisschen, dass er sich später mit Leuten wie John Cleese und Douglas Adams richtig vertraut fühlte. Denn eines ist natürlich Fakt: Echter (britischer) Humor braucht richtig kluge Köpfe dahinter.
Es kommen im Verlauf der beiden Bände noch jede Menge kluger Köpfe, mit denen es Dawkins im Lauf seiner Karriere zu tun bekommen würde. Bei den einen hat er studiert und promoviert im heiligen Oxford, andere waren seine Kollegen und Schüler. Und auch wenn er in herrlichen Szenen zu berichten weiß, dass ihm die Biologie eigentlich nicht als Gabe mitgegeben wurde, wird selbst in dieser kritischen Rückschau auf die Kindheit deutlich: Das Eigentliche ist nicht unbedingt die Kenntnis aller Klassen und Arten und Namen ringsum, sondern die Fähigkeit, die Zusammenhänge zu verstehen. Und – was für seine spätere Laufbahn wichtig wurde – auch das Leben als Prozess zu begreifen. Selbst das Eigene, bis hinein in die Kindheit.
So macht er sich – für das dicke Buch natürlich auf Seite 90 recht früh – Gedanken darüber, ob der 70-jährige Autor eigentlich überhaupt noch derselbe ist, der als Kind immer wieder Schwierigkeiten mit Autoritäten hatte (besonders mit diesen Schulmeistertypen, die ihm später von ganz unwissenschaftlicher Seite wieder begegneten), aber auch jede Menge Mitgefühl und dann wieder völlig fehlendes Mitleid für die gemobbten Jungen in der Klasse. Wie geht das zusammen? Natürlich führt das zur Identitätsfrage – und wäre wahrscheinlich ein herrliches Forschungsfeld für Soziologen und Psychologen. Denn dass der erwachsene Schreiber identisch ist mit dem jungen Schüler, ist irgendwie evident – aber dass er sich seitdem auch verändert hat, ebenso. Selbst die moderne Psychologie ist mit dem Thema noch nicht fertig. Logisch, dass auch Dawkins sich erst einmal mit der Beobachtung zufrieden gibt, „dass die Kontinuität meiner Erinnerungen mir das Gefühl verschafft, meine Identität habe sich während meines ganzen Lebens nicht verändert“.
Logisch, dass sich so der Blick schärft für die Evolution der eigenen Lebensgeschichte, für die Wendepunkte, die dafür sorgten, dass dann die Weichen doch genau so gestellt wurden, wie es passierte. Und logisch: Es fehlt auch nicht der Exkurs zu der Frage „Was wäre wenn …?“ Was wäre passiert, wenn Dawkins einigen Lehrern in seinem Leben nicht begegnet wäre, wenn er bestimmte Schulen nicht besucht hätte und am Ende nicht in Oxford gelandet wäre und dort von einem klugen Mann auch noch in die richtige, weil ihn wirklich fesselnde Richtung gestupst worden wäre?
Dabei wird auch deutlich, wie wichtig es ist, als junger Mensch überhaupt die Chance zu haben, wählen zu können – und dabei auf Lehrer zu stoßen, die einem den richtigen Tipp geben können. So aus mitteldeutscher Sicht kommt einem dabei schon der Gedanke in den Sinn, dass das in Merry Old England augenscheinlich möglich ist. Aber wo sind diese Spielräume eigentlich im deutschen Bologna-System geblieben? Hat man sie nicht gerade mit bürokratischer Eleganz gänzlich wegrationiert? Und ist auch noch stolz darauf?
Die Frage können – vielleicht – die hierzulande Betroffenen erzählen, die dann auch die ganze prekäre Laufbahn als Aushilfskraft, befristet angestellte Projektmitarbeiter usw. durchgemacht haben. Wissenschaft braucht jede Menge Bewegung. Das bestimmt. Aber die permanente existenzielle Unsicherheit gehört ganz bestimmt nicht dazu.
Gerade im zweiten Band seiner Erinnerungen geht Dawkins auf all diese Bewegung, die vielen Begegnungen mit echten Gesprächspartnern, anregenden Kollegen, herausfordernden Gegenüber ein. Den ersten Band hat er im Grunde mit dem berühmten Knalleffekt beendet: der Veröffentlichung seines Buches „Das egoistische Gen“. Aber auch das Buch entstand ja nicht aus dem nichts. Quasi als „göttliche Eingebung“. Denn tatsächlich beginnt ja mit dem Studium erst das wissenschaftliche Lernen. Und Dawkins Glück war, dass er es früh mit einigen der wichtigsten Vertretern der Evolutionsbiologie zu tun bekam, die in der Zeit seines Studiums gerade dabei war, sich auf eine neue Stufe zu katapultieren, eine neue darwinistische Stufe. Denn gerade in dieser Zeit wurde den besten Köpfen dieser Disziplin erst so richtig bewusst, dass die eigentliche Evolution nicht auf der Ebene der Individuen stattfindet, sondern auf der Ebene der Gene, und dass nicht das Überleben der Individuen die Entwicklung vorantreibt, sondern die fittesten Gene (um mal ein schönes darwinsches Wort zu nennen) bestimmen, was überlebt und Teil des evolutionären Prozesses bleibt.
Eigentlich trug sich Dawkins schon Jahre vor der Veröffentlichung von „The Selfish Gene“ (Das egoistische Gen) im Jahr 1976 mit der Idee, so ein Buch zu schreiben. Doch dann ließ er sich wieder von Lehre und Forschung und einer „schweren Sucht zur Computerprogrammierung“ ablenken, bevor er sich dann endlich mal hinsetzte und das überfällige Buch schrieb, mit dem er nicht nur die Konservativen erschreckte, sondern auch die Linken, die fast genauso heftig reagierten. Man darf ja nicht vergessen. Es war genau die Zeit, in der mit Maggie Thatcher die knallharte Vertreterin des absoluten ökonomischen Egoismus England gründlich veränderte. Und nicht nur England: Dieser machtgewordene ökonomische Egoismus beherrscht noch heute das politische und ökonomische Denken der westlichen Welt und macht – wie man sieht – die reichsten Staaten völlig unfähig bei der Bewältigung der drängensten Probleme.
Hat eigentlich schon jemand das Buch der Evolution von Gesellschaften und Staaten geschrieben?
Dass es eine Evolution des menschlichen Denkens gibt, hat Dawkins so nebenbei auch mit diskutiert. Von ihm stammt das mittlerweile legendäre Kürzel „Mem“, das in einem ganzen Dutzend unterschiedlicher Wissenschaftsbereiche fruchtbar geworden ist, weil sich so die „genetischen“ Stabilisierungsfaktoren von menschlichen Gesellschaften beschreiben und erfassen lassen. Stoff zum Forschen ist genug da …
Und während die Bücher, die Dawkins in den 1970er und 1980er Jahren veröffentlichte, in der Welt der Biologen auf eine Menge Zustimmung stießen und selbst wieder hochbegabte Kollegen anregten, neue Wege zu gehen und die These immer neu auf Herz und Nieren zu prüfen, bekam er es verstärkt mit heftigen Attacken aus dem Lager der Kreationisten zu tun, die seit den 1980er Jahren gerade in den USA versuchen, die biblische Schöpfungslehre als „wissenschaftlichen“ Lehrstoff in die Schulen zu bekommen und die darwinistische Lehre möglichst aus Schulen und Öffentlichkeit zu verbannen.
Was sich einer wie Dawkins natürlich nicht gefallen ließ. Denn mit wissenschaftlichem Denken hat ja der ganze Kreationismus nichts zu tun. Für wissenschaftliche Logik, Analyse und Beweisführung ist der ganze Kreationismus im Grunde nur ein Witz. Und entsprechend bissig nahm sich Dawkins diese auftrumpfende Unwissenschaftlichkeit dann in Büchern wie „Der Gotteswahn“ (2006) und „Die Schöpfungslüge“ (2009) vor.
Gerade der zweite Teil seiner Biographie geht auch sehr ausführlich auf seine Bücher, die öffentliche Auseinandersetzung, aber auch die fruchtbaren Diskussionen mit Fachkollegen ein. Und immer wieder erläutert Dawkins auch, wie er auf neue Anregungen stieß, seine These zu erweitern. Denn wenn man erst einmal die Grundposition ändert und nicht mehr wie gebannt auf den Überlebenskampf und den Anpassungsdruck der einzelnen Individuen starrt, dann werden die Wirkungsweisen der genetischen Anpassungen immer deutlicher, erscheint die ganze Evolution in völlig neuem Licht und auf einmal machen sich Biologen Gedanken darüber, wie sich das Interagieren von Individuen, die erlebte Umwelt und die Entwicklung eines erweiterten Phänotyps eigentlich im Genpool spiegeln. Reihenweise tauchen da spannende Fragen auf, was denn eigentlich und in welcher Weise im genetischen Erbgut alles „gespeichert“ ist und wie die Auslese nützlicher Mutationen im Erbgut tatsächlich funktioniert.
So nebenbei beschreibt Dawkins auf diese Weise auch die Evolution der Evolutionsbiologie in den vergangenen fünfzig Jahren. Da rückt seine Arbeit als Wissenschaftler, Autor und beliebter Ansprechpartner für die Medien deutlich stärker in den Vordergrund, während der familiäre Aspekt seines Daseins deutlich in den Hintergrund rückt. Was freilich nicht ausschließt, dass er seine Lebensgefährtinnen immer wieder als echte Partnerinnen auch in seinem wissenschaftlichen Leben würdigt.
Und das Schöne für den Leser, der nicht selbst Biologe ist und ganz selbstverständlich die Entwicklung der Wissenschaft auch durch Rezeption wissenschaftlicher Fachliteratur verfolgt: Selbst mit den kurzen Ausflügen von Richard Dawkins in seine Bücher bekommt man eine sehr plastische Vorstellung von dieser faszinierenden Wissenschaft – und natürlich auch Appetit auf die Bücher selbst, wenn man sie noch nicht gelesen hat.
Eher wundert man sich darüber, dass dieser Bursche nun auch schon 75 ist. Und was für ein Gedächtnis er haben muss. Ob Lieder, Gedichte oder Familienerinnerungen oder die vielen Begegnungen mit Wissenschaftlerkollegen – er schüttelt das alles aus dem Hemdsärmel, als müsste er nicht mal irgendwo in ein Tagebuch gucken (das er sowieso nicht schreibt, wie er an einer Stelle versichert). Und das wäre vielleicht noch zu überlesen, wenn das nicht wirklich die wichtigsten Forscher der Gegenwart wären, von denen er dankbar Anregungen aufnahm, die ihrerseits weitermachten, wo sie bei Dawkins auf Anregungen stießen.
Und er lässt auch die kritischen Stimmen nicht aus, weil es natürlich auch einen Autor wie ihn dazu bringt, darüber nachzudenken, wie weit Wissenschaft eigentlich geht und was eigentlich wissenschaftliches Denken ist. Und das schreibt er natürlich auch den fundamentalistischen Alleswissern ins Stammbuch, dass die wichtigste Grundlage aller Wissenschaft immer der Zweifel ist. Auch der an den eigenen Thesen und Theorien. Die sind nämlich dazu da, überprüft und hinterfragt zu werden. Die besten Wissenschaftler geben sich alle Mühe, Experimente anzustellen, um die eigene Theorie einem maximalen Belastungstest auszusetzen oder gar Anhaltspunkte zu finden, die sie möglicherweise zusammenstürzen lassen.
Da haben die Leute, die immer wieder behaupten, sie bräuchten nur einen (wahlweise einfachen oder komplizierten) Gott, um die Entstehung der höchstkomplexen Lebewesen auf Erden zu erklären, ganz schlechte Karten. Auf das Thema geht Dawkins zum Ende des zweiten Bandes natürlich etwas ausführlicher ein. Und man merkt, welche Freude es Dawkins bereitet, für das wissenschaftliche Denken zu werben und immer wieder zu erklären, warum es mit Glauben und „christlicher Wissenschaft“ nichts, aber auch gar nichts zu tun hat.
Das Buch ist eine echte Erfrischung für den Kopf. Und am Ende ist man eigentlich nur deshalb verstimmt, weil es schon zu Ende ist.
Richard Dawkins Die Poesie der Naturwissenschaften, Ullstein Verlag, Berlin, 2016, 38 Euro.
In eigener Sache
Frühling? Jetzt bis 8. April (23:59 Uhr) für 49,50 Euro im Jahr die L-IZ.de & die LEIPZIGER ZEITUNG zusammen abonnieren, Prämien von den “Hooligans Gegen Satzbau”, Schwarwel oder fhl Verlag abstauben und vielleicht mit einem „Leipzig-Rad“ in den Sommer radeln. Einige Argumente, um Unterstützer von lokalem Journalismus zu werden, gibt es hier.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
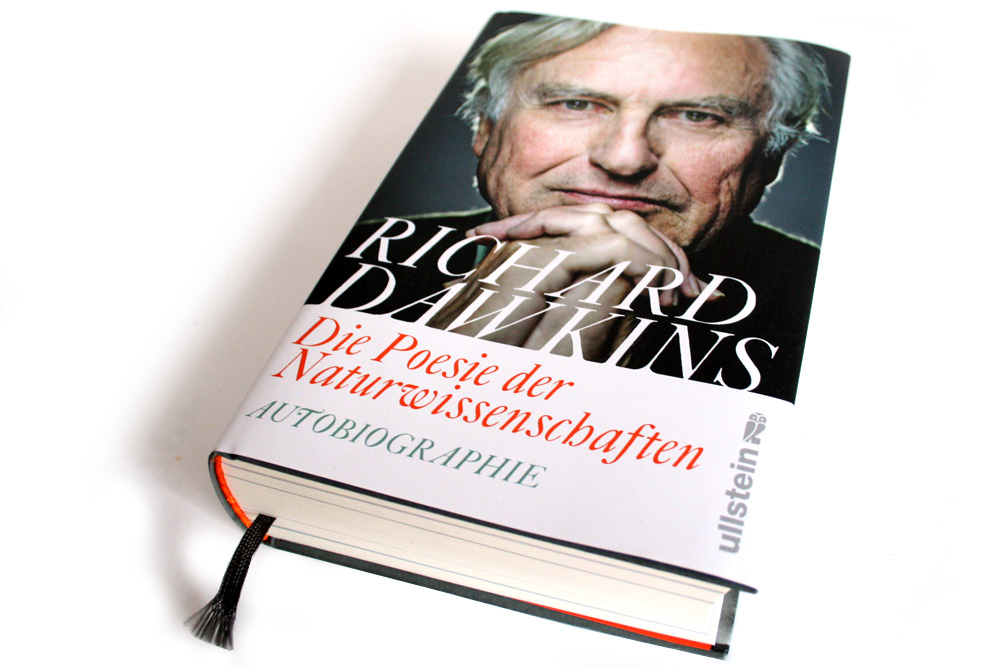










Keine Kommentare bisher