Man darf ja ruhig ein paar falsche Spuren legen. Auch wenn das Stefan B. Meyer eigentlich nicht nötig hat. Er schreibt in einer völlig anderen Krimi-Kategorie. Aber wenn es um große literarische Vorbilder geht, bringt er gern mal eine falsche Fährte unter, erwähnt so beiläufig einen gewissen Sam Spade. Echte Kinofreunde haben da gleich Humphrey Bogart vor Augen, der in "Die Spur des Falken" den Privatdetektiv spielte.
Der Film entstand nach Dashiel Hammetts “Der Malteser Falke”. Aber das eigentliche Vorbild für Meyers Privatdetektiv Hans Staiger ist nicht Sam Spade, sondern Phil Marlowe, der grimmige, abgeklärte und abgebrühte Privatschnüffler aus den Romanen von Raymond Chandler. Eine Type, die man in der deutschen Kriminalliteratur regelrecht vermisst, was auch daran liegt, dass deutsche Krimiautoren denkbar brav, wohlerzogen und angepasst sind. (Außer, wenn sie mal über die Kollegen herziehen, weil ihnen deren Arbeitsweise nicht gefällt.) Und zur Angepasstheit gehört auch, dass man akzeptiert, dass nur die Kriminalpolizei ermitteln darf und selbst die staatlichen Ermittler sich von Alpha bis Omega an die Gesetze, Regeln und bürokratischen Vorschriften zu halten haben und deshalb in der Regel nicht ermitteln dürfen, weil sie ständig irgendwo eine Erlaubnis von höheren Stellen brauchen.
Was dann einer der Gründe dafür ist, dass die Hauptfiguren des deutschen Krimis in der Regel völlig desillusionierte und geplagte Gestalten sind, für die jeder Fall zur Qual wird, das Familienleben zur Katastrophe und das Gerangel um die Karriere im Polizeiapparat zur permanenten Bedrohung. Und regelmäßig stoßen sie an die Grenzen der Hierarchie – wahrscheinlich gibt es weit und breit kein anderes Land, in dem Hierarchien derart rigide aufgebaut und eingehalten werden und wo Polizisten derart Muffensausen haben, wenn sie es mit Politikern, Wirtschaftsbossen und höheren Amtsebenen zu tun bekommen.
Die Betroffenen werden wissen, ob diese Darstellung in den Krimis realistisch ist. Es spricht Vieles dafür.
Aber was macht man, wenn man solche Krimis gar nicht schreiben will, sondern wenigstens ein bisschen Action in die Bude kriegen möchte?
Man ändert die Personage und schickt eben doch mal einen Typen wie diesen Staiger los, der es nicht nur genauso unverfroren anpackt wie Marlowe, sondern auch denselben Ton drauf hat. Damit haben sich schon ganze Scharen von Krimi-Experten und Literaturwissenschaftlern beschäftigt: Was ist das eigentlich für ein Ton, den Chandler seinem Detektiv verpasst hat? Haben die Privatermittler, Bullen und Ganoven damals genauso geredet – in Chicago zum Beispiel (oder Schigago, um den ursprünglichen Titel dieses Krimis zu zitieren, der 2007 im Mitteldeutschen Verlag erschien und den Meyer jetzt noch einmal komplett überarbeitet hat)?
Haben sie nicht. Die meisten Forscher gehen mittlerweile davon aus, dass dieser von deftigen Bildern und Vergleichen gespickte Stil erst durch Chandler in die Welt kam und über die Romane und Verfilmungen in den Slang der “harten Jungs” einsickerte. So fern sie es schaffen. Denn dazu gehört Grips und Geistesgegenwart, die die meisten Ganoven nicht haben. Und es gab zwar immer wieder Versuche auch deutscher Krimi-Autoren, diesen Ton nachzumachen. Aber hier gilt genau dasselbe: Es funktioniert nur, wenn man auch als Autor ein wenig wie Chandler arbeitet und am Stoff richtig feilt, bis die Bilder stimmen und die Pointen sitzen. Und zum Hauptakteur muss es natürlich auch passen. Was noch deutlich schwieriger ist – denn Deutschland ist ja nun wirklich kein Land, das selbstbewusste Typen wie diesen Staiger so einfach machen lässt.
Oder machen ließe, wenn sie denn als Privatdetektiv so agieren würden wie dieser recht robuste ehemalige Architekt, der eigentlich die Sache mit der Baubranche auch deshalb an den Nagel gehängt hat, weil man da mit ehrlicher Arbeit nicht wirklich nach oben oder gar auf feste Füße kam – kommt – kommen könnte. Er kennt die Branche zwar aus dem Effeff, aber wenn man nicht zum Häkchen werden will, sucht man sich doch lieber was anderes – und wenn es das mehr als prekäre Leben als kleiner Dienstleister und Detektiv auf Abruf ist. Da rufen einen die Leute dann nicht an, weil man brav ist, sondern weil man seine Arbeit ordentlich macht.
In diesem Fall hat es sich herumgesprochen bis zu einem der ganz großen Bosse im deutschen Baugeschäft, der Staiger eigentlich nur einen kleinen, persönlichen Aufklärungsauftrag gibt, “Kein großes Ding” eben, obwohl sich am Ende herausstellt, dass durchaus ein paar große Dinger dahinter stecken. Die Hintergrundkulisse ist – wie in “Desperados im Land des Lächelns” – das Dresden der ganz wilden Jahre, in dem es da und dort noch nach den heruntergekommenen Ecken der 1990er Jahre riecht, die meisten Häuser schon für ein paar Äppel und ein paar Eier die Besitzer gewechselt haben und diverse neue Bauhaie und Projektentwickler ihren Reibach machen, bei dem sie auch mal über Leichen gehen. Und zur Leiche wird man in dem Geschäft nun einmal, wenn man den Geldgierigen und Strippenziehern mit etwas zu viel Anständigkeit auf den Keks geht.
Wer von Meyer die “Desperados” und den Leipzig-Krimi “Im falschen Revier” gelesen hat, weiß, dass er nicht die Spur daran glaubt, dass in Sachsens Entscheideretagen jederzeit alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Immerhin ging es ja beim großen Reibach nicht nur um schöne Pöstchen und ein paar Seilschaften, sondern auch um eine Menge Geld. Die Frage für Staiger ist eigentlich nur: Wo ist der Zipfel, an dem er ziehen muss? Dass er mit der normalen, ehrlichen Ermittlerarbeit gar nichts finden würde, das merkt der Unermüdliche spätestens, als er der Kriminalpolizei (das Ermittlerduo heißt liebenswürdigerweise Cosel und Wettin) und dann gar noch dem raunzigen LKA in die Quere kommt, denn die Polizei ist zwar durch einige Vorgänge aufgeschreckt (die nun ausgerechnet Staiger zumeist ans Licht gebracht oder als selbsternannter Finanzermittler ausgelöst hat), aber die Ermittlungen sind (man kennt ja die ganze lähmende Bürokratie aus anderen Krimis) entsprechend träge, so dass Staiger dann eben doch immer wieder der Erste ist, der einem oder mehreren Ganoven zu nah auf die Pelle rückt, was dann wieder recht gefährliche Folgen hat.
Am Ende wühlt er sich tatsächlich immer tiefer in ein recht zwielichtiges Immobilienkomplott hinein, hat aber noch eine Menge Aufmerksamkeit übrig für die Frauen in diesem Kosmos, die ihrerseits durchaus ein Faible für diesen großmäuligen Burschen haben, der auch entsprechende amouröse Fallen durchaus zu genießen weiß, auch dann noch, wenn die Schönen ihn am Ende sitzen lassen. Oder auch nicht. Denn manchmal kommen sie auch wieder – wie seine Ex Sylvia, so dass es da und dort mit den Frauen ein bisschen drüber und drunter geht. Zumindest das unterscheidet diesen Staiger deutlich von Marlowe: Er ist nicht so einsam. Aber er hat da und dort denselben illusionslosen Blick auf die Mitmenschen, der dem Leser so gut tut, weil einem das im normalen Leben eher selten gegeben ist. Geschweige denn, dass man in aller deutschen Höflichkeit solchen Typen so kaltschnäuzig käme, wie es Staiger tut.
Natürlich liest sich das weg. Eher ist man geneigt, unterwegs zu bremsen, weil die lakonischen Beschreibungen der Vorgänge aus Staigers Sicht so deftig gemalt sind, dass man seine Freude dran hat. Heruntergekommene Kaschemmen sind nun einmal heruntergekommene Kaschemmen, Talmi ist Talmi und Dresden ist – naja – eigentlich nur der von August dem II. hingeklotzte Protz, mit dem der prestigeversessene Kurfürst der Welt zeigen wollte, was für ein reicher Schnösel er war. Reines Machtgehabe. Staiger hält von diesem ganzen Prunk überhaupt nichts. Oder ist es Meyer selbst, der zwar seine Krimis gern in Dresden spielen lässt, die Dresdener Verzücktheit vor den restaurierten Barockfassaden aber nicht mag? Auch weil sie für eine völlig verklärte Sicht auf Macht und Reichtum steht?
Meyer selbst lebt in Leipzig. Vielleicht braucht man tatsächlich diese Distanz zur sächsischen Residenzstadt, um auch Distanz zu haben zur sächsischen Verklärung von Vergangenheit, König und Macht. Eine Menge davon steckt in Staiger. Und da man selbst ja ein sozialisierter Sachse ist, befürchtet man eigentlich die ganze Zeit, dass die Polizei seinem Treiben ein Ende setzt und ihn erst mal hinter Gitter bringt, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat. Und davon gibt es eine Menge Stellen im Buch. Aber irgendwie macht das, wenn man es so liest, auch recht deutlich, wie leicht es den Ganoven in Deutschland eigentlich gemacht wird, den richtigen Ganoven, denen, die keine Skrupel kennen, Beamte zu kaufen und Politiker zu bestechen und die sich mit dem ganz großen Löffel bedienen, während die anständigen Bürger noch in der Warteschlange im Amt stehen und am Ende gesagt bekommen, dass man ihrem Anliegen leider nicht stattgeben werde.
Die Welt, in der Staiger stöbert, ist keinesfalls unrealistisch. Nur Staiger ist es. Und das begeistert beim Lesen und bekümmert zugleich, weil man genau weiß, dass solchen Leuten in der Regel keine Überlebenschance beschieden ist. Zumindest nicht als frei herumlaufender Detektiv, der in Dingen stöbert, die man lieber nicht aufgerührt haben möchte.
Stefan B. Meyer Kein großes Ding, fhl Verlag, Leipzig 2015, 13 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
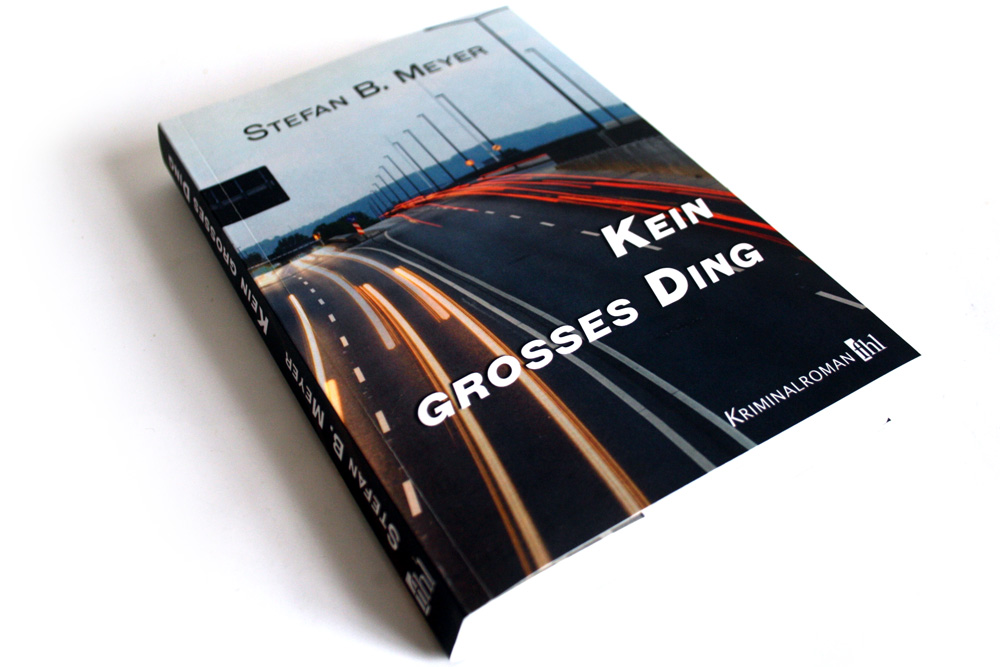










Keine Kommentare bisher