Am 4. Oktober gab's im "Telegraph" die Leseparty zur Vorstellung des neuen "Poet", des Literaturmagazins aus dem Poetenladen, der Nr. 17 inzwischen. Und das ist schon ein Achtungszeichen aus dem kleinen Gohliser Verlag, der dem großen Projekt Poetenladen angegliedert ist. Immerhin hat das Magazin mit 224 Seiten das Format eines ordentlichen Buches. Und es zielt auf ein Publikum, das schon ein nicht ganz gewöhnliches ist.
Denn die meisten Literaturmagazine werden in Deutschland von Insidern für Insider gemacht. Sie sind die Plattform und der Kommunikationsort für Schreibende, Verlegende, Übersetzende und Lektorierende, all die Leute, der sich von Fach und Beruf her mit Literatur beschäftigen. Eigentlich gehören auch Nur-Lesende dazu, quasi das, was man früher echte Liebhaber nannte. Und die Wissenschaftler und Journalisten nicht zu vergessen, die sich mit dieser ganz speziellen Disziplin beschäftigen – dem Schreiben und all seinen Komplikationen.
Der Liebhaber-Leser kennt das aus vielen Texten, in denen Autoren aus vollem Herzen jammern und stöhnen über Schreibhemmungen, Blockaden, Mühseligkeiten, quälende Anfänge, stockende Worte, ihr Ringen mit Form und Inhalt – und noch viel schöner: mit knauserigen Verlagen und bösartiger Kritik. Das Leben eines Autors ist nicht leicht. Wahrscheinlich ist es nicht schwerer und mühseliger als andere Berufsleben auch. Aber da Autoren die Hoheit über ihren Füllfederhalter, ihre Schreibmaschine oder die Computertastatur haben, können sie sich über ihr Arbeiten so ausufernd auslassen, dass es zuweilen nervt. Stöhnen auch Straßenbauer, Bäcker und Kirschpflücker so über ihre Arbeit?
Was hat das mit diesem “Poet Nr. 17” zu tun?
Zweierlei. Erstens hat der Herausgeber sich gewünscht, dass ein paar Autoren sich einmal über das Thema Vergänglichkeit auslassen, immerhin ein Thema, das in vielen Romanen und Geschichten und Gedichten eine wesentliche Rolle spielt. In vielen Neuerscheinungen der letzten Zeit spielen der Tod oder das Hadern mit Krankheit und Verfall eine wesentliche Rolle. Auch diverse Preisträger wurden in letzter Zeit für Bücher geehrt, in denen sie sich akribisch mit Krankheit, Abschied und Verlust beschäftigt haben. Meist wählen ja die honorig besetzten Jurys dann Titel zur Kür aus, die man nach erstem Anlesen aus lauter Verzweiflung weglegt und nie wieder aufblättert. Aber tatsächlich hat sich die literarische Landschaft in den letzten Jahren spürbar verändert. Während Jurys die feinnervigen Analysen von Tod und Abschied bevorzugen, bevorzugen die Leser im Buchladen wieder Dystopien: Beschreibungen von Gesellschaften im Zustand von Krankheit und Verfall. (Exemplarisch kommt im Buch dazu Matthias Nawrat mit seinem Buch “Unternehmer” zu Wort.) Für die eher vom Feuilleton geliebte Variante stehen exemplarisch Georg Klein und Clemens J. Setz.
Wobei Klein den Bogen öffnet und auch die Vergänglichkeit von Literatur, Ruhm und der Wirksamkeit von Texten benennt. Eigentlich schon ein anderes Thema, das Autoren natürlich trotzdem beschäftigt. Und beschäftigen muss, auch wenn sich die sechs im Magazin Befragten alle recht bescheiden geben und sich mit dem Wirken im Jetzt zufrieden geben. Das kann man mögen. Aber das kippt leider auch ganz leicht. Erstaunlicherweise fällt das Wort Postmoderne nicht – oder hab ich es nur überlesen? Denn das Projekt Postmoderne ist ja die Grundierung für die sichtliche Ratlosigkeit von Autoren, Verlegern und wohl auch Lesern der Gegenwart. Anne Weber benennt es im Gespräch mit Jan Kuhlbrodt: Spätestens der Verlag versucht oft recht gewaltsam, ein Buch in eine Rubrik einzusortieren. Was regelmäßig schief geht, wenn Autorinnen und Autoren Grenzen überschreiten, neue Formen ausprobieren. Manchmal auch einfach ausprobieren müssen, denn der Stoff drängt meist geradezu nach einer (neuen) Form. Für Anne Weber führte das zu einem Bruch mit dem Suhrkamp Verlag, der eigentlich für seine Offenheit für moderne belletristische Formen bekannt ist. Sie kam bei S. Fischer unter.
Aber in Frankreich, wo sie lebt, tut man sich augenscheinlich genauso schwer mit der Rubrizierung. Und das trotz des in Frankreich “erfundenen” Noveau Roman. Aber auch das gehört zur Diskussion um Postmoderne: Ab wann werden neue Formen für Leser nicht mehr nachvollziehbar? Wann geht das Experiment zu weit? Denn auch das ist Fakt: Vieles, was an literarischen Experimenten in den vergangenen 60 Jahren gepriesen wurde, hat die breite Leserschaft nie erreicht, hat sie sogar schlicht überfordert. Denn wenn zum Verständnis von Literatur gar schon ein gewisses Expertenwissen oder eine hohe Frustrationsschwelle vonnöten sind, beginnt der Diskurs um zeitgenössische Ausdrucksformen zu einem inneren Diskurs der Literaturexperten zu werden. Die ihr Wissen übrigens mit ins Grab nehmen, wenn es soweit ist. Auch Avantgarden können sich ganz hoffnungslos im Gelände verirren.
Literatur funktioniert tatsächlich nur, wenn das Gespräch mit den Lesern zustande kommt. Das gilt auch für Lyrik – gerade weil die Gemeinde der Lyrikleser klein ist. Insofern ist jedes “Poet”-Heft auch ein Angebot an Leser, der größte Teil ist der Vorstellung neuer Texte gewidmet, alle mit einem Autorenporträt versehen. 80 Seiten sind komplett der Vorstellung neuer Gedichte gewidmet – darunter auch die drei Leipziger Dichter Roland Erb, Thomas Böhme und Carl-Christian Elze. Auch der Herausgeber betont es extra: Indem sich Elze sich im Gedicht mit dem Tod eines Freundes beschäftigt, kommt das Thema Vergänglichkeit natürlich auch literarisch ins Bild. Und auch Erbs Gedichte erzählen vom Vergänglichen – das eigene Leben und die Landschaft der eigenen Stadt gehören ja dazu. Nichts bleibt, wie es war. Und zu recht benennt Georg Klein in seinem Interview seinen Ekel vor all den Menschen, die sich selbst und ihre Zeit überleben wollen, um dann verbissene, überforderte alte Greise zu werden, die die Gegenwart mit den überholten Normen ihrer längst verschwundenen Jugend taxieren und beurteilen.
Das sind Momente, an denen auch so ein Literaturmagazin über sich selbst hinauswächst und gesellschaftskritisch wird, wie man es bei deutschen Autoren viel zu selten liest. Denn die Grundierung für die um sich greifende Niedergangsstimmung hat ja etwas mit der Sicht der Alten auf die Welt zu tun – und mit ihrer zunehmenden Präsenz in allen Bereichen der Gesellschaft, wo sie ihre Ansichten einsickern lassen, in denen der Zorn auf die “schnellen und unüberschaubaren Veränderungen” lodert. Gerade deshalb, so Klein, sei es ehrlicher, schon zu Lebzeiten den Verzicht auf die Bühne zu denken. Auch zu akzeptieren, dass das eigene Schreiben vielleicht nicht mehr gefragt ist.
Den 80-seitigen Lyrikteil folgt im Magazin wieder das, was eigentlich ganz vorn stehen müsste, für die Nicht-Experten, die einfach neugierigen Leser, die die Kunst des Gedichtelesens noch nicht trainiert haben. Denn eine Kunst ist es. Deswegen heißen die Dinger ja Gedichte: Weil sie Wesentliches in kompakter, stark verdichteter und darum (wenn’s gut gemacht ist) auch in komplexer Form darbieten. Wie das funktioniert, das demonstrieren hier wieder Michael Braun und Michael Busemeier, die sich Gedichte von zwölf Lyrikern vorgeknöpft haben und sie geradezu aufblättern, herauslesen, was sie darin an Bildern, Subtexten, Anregungen gefunden haben. Das haben sie in der Wochenzeitung “Freitag” seit ein paar Jahren schon öffentlich praktiziert. Und es sind schöne Beispiele dafür, wie man Leser anregen kann, eigene Lesarten für Gedichte zu entwickeln. Denn auch das merkt man, wenn man erst das Gedicht gelesen hat und dann die Entfaltung: So hat man es meist gar nicht gelesen. Aber es ist möglich. In manchen Gedichten stecken drei, vier und mehr Lesarten. Auch das ist etwas, was nicht jeder weiß. Mancher verbietet es sich ja auch, nachdem er in der Schule gelernt hat, es gebe nur eine Lesart. Die vom Lehrplan vorgegebene.
Aber das ist bei jedem guten literarischen Text so: Er entfaltet auch beim zweiten und dritten Lesen neue Einsichten und Deutungsmöglichkeiten. Gerade dann, wenn das Erzählte scheinbar simpel und eindeutig ist. Eine Einladung also zum Selbst-Probieren, auch dann, wenn die beiden Herren ihre Aversionen gegen klassische Gebundenheit oder gar Reime durchblicken lassen. Beides kann nerven, keine Frage. Aber nur, weil es von Amateuren so leicht nachgeahmt werden kann. Was eben nicht bedeutet, dass diese Instrument in der Werkstatt wirklich sprachbegabter Autoren nicht wieder blitzen und vor allem – funktionieren können.
Wann kommt eigentlich ein “Poet”, das sich mal mit der Funktionsweise von Literatur beschäftigt? Denn darum geht es ja im Grunde bei all den Menuetten rund ums Thema Vergänglichkeit. Literatur, die vergeht, hört schlichtweg auf zu funktionieren. Oder hat nur funktioniert, schwamm nur im kurzen Rausch eines Hypes mit, wurde beklatscht, bepreist und dennoch nicht gelesen. Wie wird es den Prosatexten ergehen, die im Magazin auf knapp 40 Seiten vorgestellt werden? – Auch “Steiners Geschichte” von Constantin Göttfert (die demnächst als Buch herauskommt) ist ja eine typische Geschichte von Vergänglichkeit: Wie gehen wir mit unheilbaren Krankheiten um, wenn sie unverhofft in unser Leben einbrechen? Können wir das überhaupt noch? Immerhin sind wie zu einer Gesellschaft geworden, die mit Tod und Unvollkommenheit nicht mehr umzugehen weiß, die kaputt gegangene Teile der Gesellschaft lieber schnell entsorgt – in diesem Fall in die Reparaturmaschinerie Krankenhaus, auch wenn von Anfang an klar ist, dass Steiners Zeit abgelaufen ist.
Es gibt also einige schöne Kreuz- und Querverbindungen im Heft, das man ja wirklich so lesen kann, wie man will, vorschlagsweise von hinten weg, wo die sechs Interviews mit Autoren zum Thema Vergänglichkeit stehen. Und dann wieder von vorn. Oder überhaupt das Ganze stückweise. Denn zum Thema Vergänglichkeit gehört ja auch das Wirken im Jetzt. Wie kann das organisiert werden, wenn die großen Verlagshäuser sich in ihren Rubriken eingerichtet haben? Ein wenig dazu erzählt die Schweizer Autorin Dorothee Elminger in ihrem Interview. Ins Extrem treibt es die Lyrikerin Rike Scheffler – da wird Text ganz und gar zur Performance. Aber auch das gehört dazu. Spätestens in der Konfrontation mit Publikum muss sich erweisen, ob ein Textfeld funktioniert – oder gar nicht funkt. Oder nur so funkt – und gedruckt nicht funktioniert.
Der Rest sind dann Entscheidungen, die Autorinnen und Autoren treffen, ob sie die große oder die kleine Bühne bevorzugen und welche Art Diskurs mit den Lesenden der ihre ist. Der, mit dem sie sich lebendig fühlen. Und wo ihnen Veränderung keine Sorge macht. Was die Nachwelt draus macht, ist sowieso egal. Aber es beruhigt zumindest zu Wissen, dass die meisten der im Heft Befragten nicht gar zu sehr auf den großen Ruhm im Nachleben schielen. Nichts ist unberechenbarer als das Rechnen mit der Zukunft. Oder um Georg Klein zu zitieren: “Ich bin dafür, dass gestorben wird!”
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
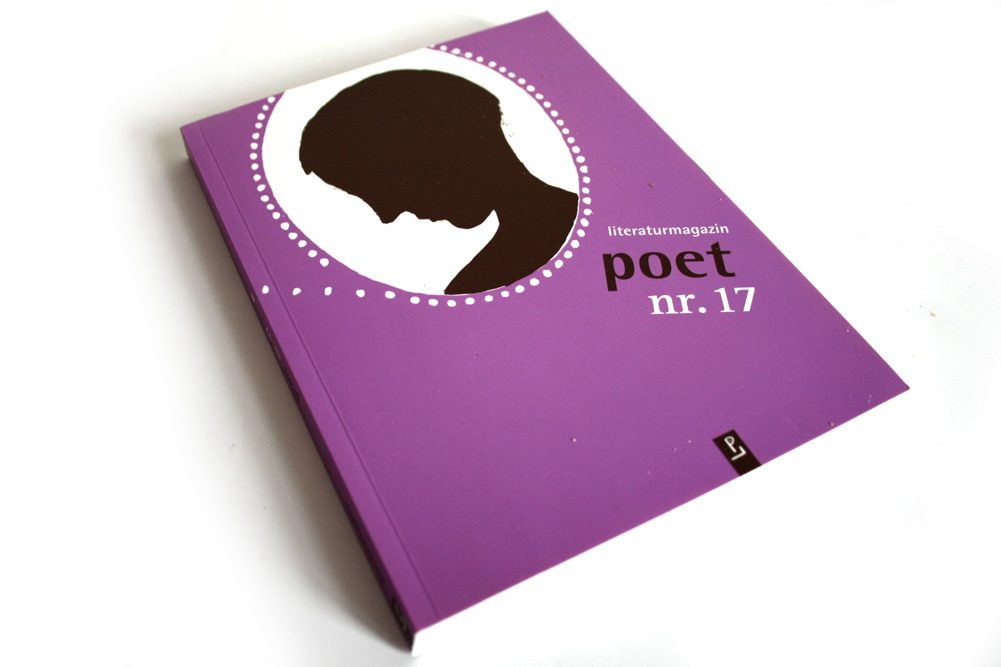








Keine Kommentare bisher