Das sagt man ja so. „Rein rechnerisch gesehen würde man ...“ Oftmals steht der Konjunktiv dabei. Also bekommt diese Phrase auch den ihr entsprechenden hypothetischen Unterbau. Jeder weiß, was damit gemeint ist: Verlasse dich auf das, was du schwarz auf weiß siehst, schau darauf, was abzurechnen ist. Mit wem, das wollen wir meist gar nicht wissen. So werden Prozesse planbar, die Menschen in ihnen werden es auch. „Rein rechnerisch“. Klingt irgendwie glatt und entseelt.
Schauen wir darauf, wie wir Floskeln Leben einhauchen, ihnen die Kälte nehmen oder verinnerlichen wir solche Wendungen als Alltagsmantra, bis wir gezwungen werden, über unseren natürlich sinkenden Leistungskoeffizienten nachzudenken, solange wir es noch können? Rein rechnerisch gesehen?
In der Schule fängt es an. Für die Konzentration im Mathematikunterricht sicher durchaus förderlich. Rein rechnerisch – wer möchte das nicht können? Leidenschaftslos und vorurteilsfrei. Kühl und genau rechnen, das Ergebnis im Blick, die sich umdrehende Magengrube im stickig-konzentrierten Klassenraum einfach mal „wegrechnen“. Nullstellen berechnen (das sind meist ganze Zahlen, nach meinen analytischen Unterrichtserfahrungen und -ergebnissen hätte es manchmal Mikromillimeterpapier geben müssen …), Wurzeln ziehen und – nicht zu vergessen – integrieren, dividieren und multiplizieren. Erweitern und Kürzen. Schaut man sich diese Grundmethoden des Rechnens genauer an, was fällt auf?
Alles ist wichtig.
Um am Ende einen Durchschnitt unter dem Durchschnitt zu haben. Statt Einskommafünf – was ja nicht schlecht ist, denn jeder hat Reserven, ansonsten gäbe es das Wort nicht mehr oder es wäre komfortabel gekürzt worden – Einskommanull, das ist das Ziel. Besser geht’s nicht. Da gibt’s dann nichts mehr zu meckern. Rein rechnerisch. Reserven verschwunden. Ressourcen auch? Worin besteht der Unterschied? Die „Leistungsmaschine“ Mensch kann sich zurücklehnen und auf „Standby“ schalten. Was nun?
„Es wächst der Mensch mit seinen größeren Zwecken.“ Schon wieder mal Friedrich Schiller. Als Additiv humanistischen Denkens. Prolog zum „Wallenstein“. Welche „Zwecke“ meint der Typ? Aufgaben? Funktionen? Dienstleistungen? Die „Funktion“ solcher „Moraltrompetern“ ist oftmals, dass man nie genau weiß, wer oder was gemeint ist. Was wollen sie eigentlich? Schreiben sie es sich von der Seele, um sich vom Zynismus des Protagonisten abzugrenzen, oder legen sie letzteren Worte in den Mund, die so ungeheuerlich klar erscheinen, dass man vor der subjektiven Wahrheit zurückschreckt?
Hier beginnt der Unterschied.
„Rein rechnerisch“ ist da nichts zu machen. An der Stelle fängt die Unwägbarkeit an. Die kalte Technokratie stößt an ihre Grenzen. „Anstatt neue Grenzzäune zu errichten, sollten wir nicht darauf schauen, welche wir in uns tragen und Spontandemos vor ihnen zulassen?“ rufe ich den ungläubig schauenden Schülergesichtern entgegen. Veränderung und „Ressourcenforschung“ fängt doch bei jedem selbst an, oder? Rechnen und Berechnen bildet die Grundlage dafür. Dann kommt das „Umrechnen“. Das Verstehen. Das ist die „höhere“ Mathematik. Das Differential menschlichen Bewusstseins. Spätestens jetzt zeigt sich, wie verschieden die Wertmaßstäbe der Abrechnung sein können, wie es um die Glaubwürdigkeit der eigenen Funktionsgleichung bestellt ist.
Hier müssen Begriffspaare wie „Endlich-Unendlich“ eine Rolle spielen, müssen wir Leistung neu bestimmen oder nachschauen, welche Parameter in unseren grundlegenden Gesetzen dafür vorgesehen sind. Im Grundgesetz. Mit Grundrechenarten kommen wir hier nicht weiter. Wahrscheinlichkeiten, Toleranz- und Wertebereiche müssen gefüllt werden. Wenn man sie erkennt. (Wenn der Begriff „Volksbildung“ nur nicht solch stalinistischer Deformation anheim gefallen wäre …)
Aber bleiben wir im Indikativ, in der Gegenwart und versuchen uns an höherer Mathematik.
Unterlaufen wir die anerzogenen Schulkodizes wie egomanes „Leistungsstreben“, Nicht-Abgucken und braves Melden. Hinterfragen wieder mehr und schauen auf die Dinge, die wir nicht sofort verstehen, bleiben dran und verlangen nicht sofort ein Lösungsheft. Jetzt in diesen heiß-kalten Tagen des Herbstes. „Das ist ein Oxymoron, das weiß ich! Oder war das falsch?“ – „Nein, deine Antwort war richtig, Max.“ Haben wir keine Angst vor dem Verlust, der bringt uns bisweilen der Wahrheit näher als der Gewinn. Einem anderen Gewinn. An Größe und Menschlichkeit. Mitmenschen hinzugerechnet heißt es dann „Mitmenschlichkeit“.
Diesmal nicht Schiller, sondern mit Fernando Pessoa, einem großen portugiesischen Dichter und Philosophen des 20. Jahrhunderts, gesprochen „Denn ich bin so groß, wie das, was ich sehe. Und nicht so groß, wie ich bin.“ Aus seinem „Buch der Unruhe“.
Beruhigen wir uns. Werden oder bleiben klar. Gehen auf Grenzsuche. „Rein rechnerisch“ betrachtet werden wir größer. Können wir dann sagen. Und werden wir sehen.
Das Bildungsalphabet erschien in der LEIPZIGER ZEITUNG. Hier von A-Z an dieser Stelle zum Nachlesen auch für L-IZ.de-Leser mit freundlicher Genehmigung des Autors.
In eigener Sache
Jetzt bis 9. Juni (23:59 Uhr) für 49,50 Euro im Jahr die L-IZ.de & die LEIPZIGER ZEITUNG zusammen abonnieren, Prämien, wie zB. T-Shirts von den „Hooligans Gegen Satzbau“, Schwarwels neues Karikaturenbuch & den Film „Leipzig von oben“ oder den Krimi „Trauma“ aus dem fhl Verlag abstauben. Einige Argumente, um Unterstützer von lokalem Journalismus zu werden, gibt es hier.
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
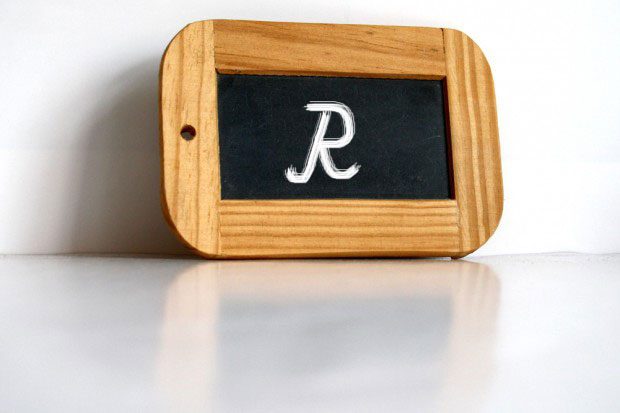




Keine Kommentare bisher