Musik immer und überall verfügbar zu machen – das ist die Erfolgsformel des Streaminganbieters Spotify mit seinem milliardenschweren Umsatz. Auf rund 100 Millionen Songs können Musikfans via Smartphone zugreifen. Mit etwas Fantasie ließen sich die Wurzeln dieser schwedischen Erfolgsgeschichte vor 140 Jahren in Leipzig verorten.
Schon damals hat es das Bedürfnis gegeben, sich unterschiedliche Lieblingslieder möglichst häufig anzuhören. Die Voraussetzung, um dieses Bedürfnis zu stillen, hat Paul Friedrich Ernst Ehrlich (1849–1925) Ende des 19. Jahrhunderts gelegt.
Der gelernte Instrumentenbauer erfand 1882 eine Mini-Drehorgel, das Ariston, auf der gelochte Pappplatten aufgelegt und durch Kurbeln abgespielt werden konnten. Diese Erfindung war deshalb so bahnbrechend, weil es erstmals möglich war, selbst Musik abzuspielen, ohne ein Instrument beherrschen zu müssen. Hinzu kam, dass sich die Platten wechseln ließen. Mit der Lochplatte hatte Paul Ehrlich auch einen der ersten musikalischen Datenträger kreiert.
Damit hatte der Leipziger, dessen Todestag sich am 17. Januar 2025 zum 100. Mal jährt, die Musikwelt revolutioniert. Musikgenuss wurde erstmals für die breite Masse erschwinglich und war zu einem Preis von 25 Reichsmark nicht länger an elitäre Darbietungen im adeligen Kontext gebunden. Fast jeder konnte sich das preiswerte Ariston und die noch günstigeren Lochplatten leisten. Erstmals war es möglich, sich so etwas wie eine Musiksammlung aufzubauen.
„Die Musikautomaten stillten den Bedarf danach, individuell in allen Gegenden der Welt die beliebtesten Lieder, Tänze und andere Melodien so oft man wollte abzuspielen, ohne Stromanschluss und musikalische Bildung“, erklärt Dr. Birgit Heise, Musikwissenschaftlerin an der Universität Leipzig. Paul Ehrlich hatte das Musikerlebnis demokratisiert und die Basis für den Massenkonsum der heutigen Zeit bereitet.
Seine Idee traf nicht nur einen Nerv, sie begründete auch einen eigenen Industriezweig, der die Stadt Leipzig über 50 Jahre zum Zentrum der globalen Musikautomaten-Industrie machte. Tausende Arbeitsplätze und ein gestiegener Wohlstand gingen damit einher.
Das Ariston
Das Ariston war nicht nur preiswert, sondern auch einfach zu bedienen. Selbst Kinder konnten die Kurbel drehen und Musik erzeugen. Niemand brauchte mehr mühsam ein Instrument zu erlernen, um sein Leben mit Musik zu bereichern. Das Ariston wurde binnen kürzester Zeit zum Verkaufsschlager, und Paul Ehrlich war nicht mehr nur als genialer Erfinder, sondern auch als Unternehmer und Kaufmann gefordert. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, gründete er die Firma Leipziger Musikwerke.
Die Industrialisierung spielte ihm in die Karten, da maschinell produzierte Instrumente schnell und in großer Zahl hergestellt werden konnten. Während Paul Ehrlich 1881 noch 5.000 Instrumente verkaufte, waren es 1885 schon 100.000. Auch die Zahl seiner Angestellten stieg binnen weniger Jahre von 65 auf 600.
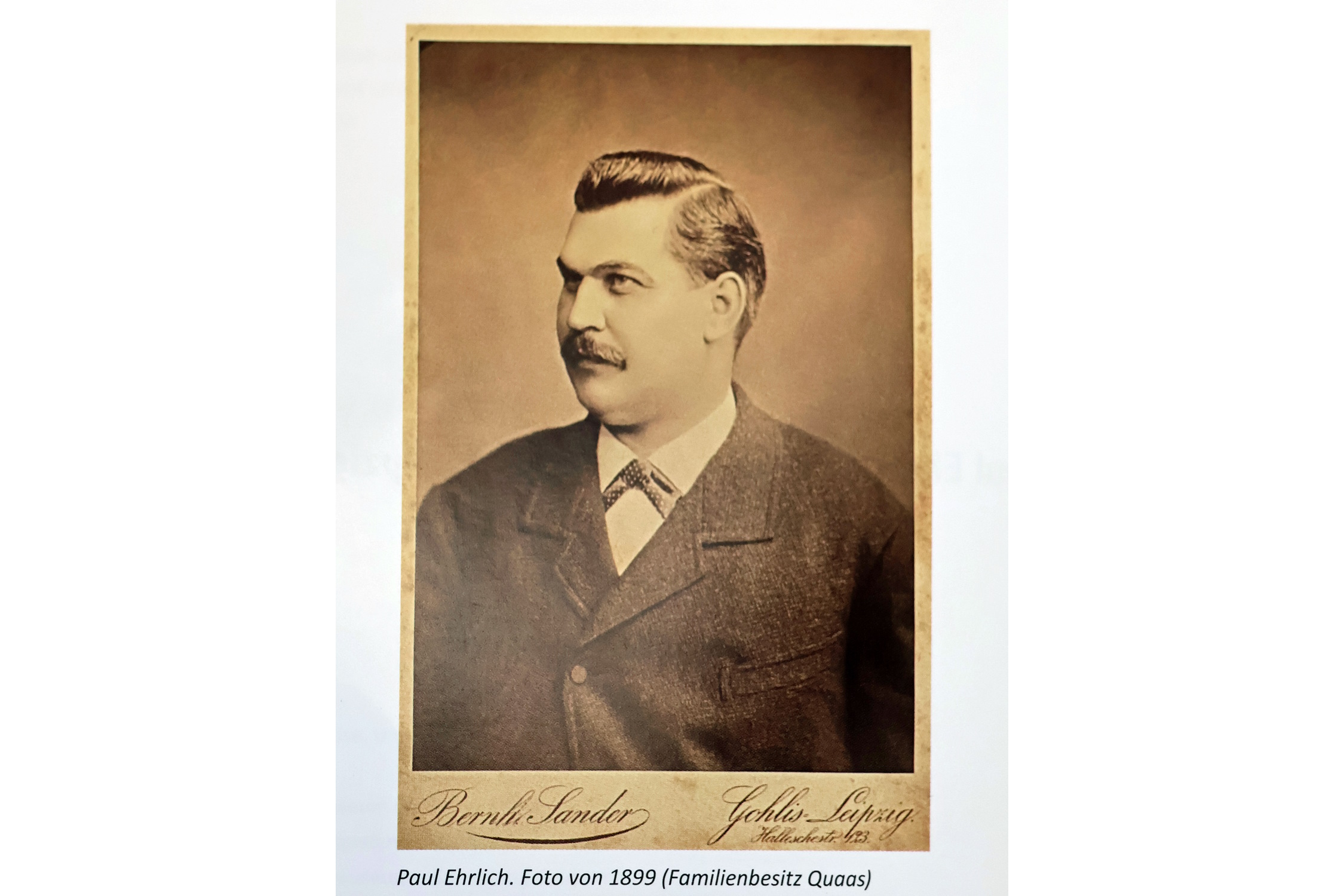
Das neue Instrument fand nicht nur in Deutschland reißenden Absatz. Es wurde auch nach England, Amerika sowie Australien exportiert. Überall wollten die Menschen ihre Lieblingsmelodien hören und in geselliger Runde zusammenkommen. Mit der Verbreitung von Musik vertrieb Paul Ehrlich nicht nur ein positives Lebensgefühl, sondern auch ein verbindendes Element zwischen den Menschen. Der Erfolg zog viele Nachahmer auf den Plan, sodass Leipzig zum Zentrum dieser Entwicklung avancierte.
Sogar König Albert von Sachsen staunte nicht schlecht: „Wer hätte jemals ahnen können (…), dass die Erfindung der mechanischen Musikwerke mit durchlochtem Blatt und auswechselbaren Notenblatt, (…) einen so gewaltigen Aufschwung der durch Sie ins Leben gerufenen Industrie hätten gewinnen können!“
Nur 15 Jahre nach der Erfindung des Aristons waren rund 400.000 Exemplare und rund fünf Millionen Lochplatten verkauft.
Das Ende
Doch der kometenhafte Aufstieg des Unternehmens setzte sich nicht fort. Urheberrechtsklagen von Komponisten machten der Branche zu schaffen. Hinzu kam eine durch Kriege in Südafrika und China verursachte Exportkrise, die nicht nur zu einem harten Konkurrenzkampf der Betriebe, sondern auch zu Überproduktion führte. Da sich am Horizont bereits der Siegeszug des Grammophons abzeichnete, ging die Zeit des Aristons zu Ende.
Zwar hatte der technische Direktor und Instrumentenbauer Paul Ehrlich die Angebotspalette der Fabrik Leipziger Musikwerke schon frühzeitig um Klaviere, Harmoniums und sogar Orgeln erweitert, das finanzielle Polster des Unternehmens reichte jedoch nicht aus, um in dieser Krisensituation erneut in die Entwicklung zu investieren. Wie viele der Mitbewerber steuerte das Unternehmen in die Insolvenz und wurde schließlich 1905 in ein Nachfolgeunternehmen überführt.

Doch er steckte den Kopf nicht in den Sand. Die Begeisterung, Dinge zu verbessern und die Freude an neuen Ideen trieben ihn weiter an. Mehr als 100 Patente hatte Paul Ehrlich im Laufe seines Lebens erlangt. Mit 74 Jahren wollte er es noch einmal wissen und gründete in Minden/Westfalen die Ehrlich AG. Minden schien ihm für eine Neugründung sicherer zu sein als das krisengeschüttelte Sachsen der Nachkriegszeit.
Mit der Aktiengesellschaft wollte er an die Vorkriegserfolge des Harmoniums anknüpfen. Doch die hohe Inflation der 20er Jahre sowie der Umstand, dass es bereits zahlreiche etablierte Harmoniumbauer gab, verhinderten einen Erfolg.
Anstatt sich selbst materiell abzusichern, dachte der siebenfache Vater zunächst an seine Kinder: Etliche seiner Patente hatte er bereits seinen Töchtern überschrieben, damit diese nicht mittellos alt würden. Trotzdem setzte die ausufernde Inflation der Familie immer weiter zu. So kostete ein Laib Brot 1923 zeitweise rund zehn Millionen Mark. Seine letzten Lebensjahre verbrachte Paul Ehrlich verwitwet im Kreise seiner Töchter Meta und Gertrud in Leipzig.
Arztrechnungen für seine schwere Lungenentzündung zehrten auch den letzten Rest an Vermögen auf. Dies ging so weit, dass frühere Weggefährten und Unterstützer am Ende nicht nur für einen Teil seiner Behandlungskosten aufkommen mussten, sondern auch sein Begräbnis finanzierten. Paul Ehrlich starb am 17. Januar 1925 in Leipzig.
Eine Sonderausstellung
Dem Lebenswerk von Paul Ehrlich sowie dem Ariston wird sich das Deutsche Automatenmuseum in Espelkamp, das der Unternehmerfamilie Gauselmann gehört, am 2. April mit einer Sonderausstellung widmen. Neben dem thematischen Bezug über die Automaten gibt es aber auch einen sensationellen familiären Kontext, denn Paul Gauselmanns Ehefrau Karin ist die Urenkelin von Paul Ehrlich.
Sie war schon lange mit dem Automaten-Unternehmer verheiratet, ehe sie im Rahmen einer Familienfeier darauf aufmerksam gemacht wurde, dass sich hinter ihrem Urgroßvater ebenfalls eine bedeutende Erfinder- und Unternehmerpersönlichkeit im Bereich automatisierter Musikunterhaltung verbirgt. Mit der Ausstellung wird auch ein Stück Familiengeschichte, das durch den Krieg und die DDR-Zeit in Vergessenheit geraten ist, wieder in Erinnerung gerufen.
Im Verlauf des Sommers wird die Ausstellung außerdem im Grassi Museum Leipzig gezeigt.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:









Keine Kommentare bisher
Lochscheiben-Grammophone scheinen einmal eine Leipziger Stärke gewesen zu sein.
Im Musikarchiv der Nationalbibliothek am Deutschen Platz in Leipzig wird solch ein Gerät bei Führungen regelmäßig vorgestellt (kostenfrei und mit Fahrradabstellplatz).
Dieses Gerät, eine Orphenion Lochplattenspieldose von 1892, ist ein Konkurrenzprodukt zu dem von Paul Ehrlich, allerdings mit weniger kommerziellem Erfolg, da fehleranfällig. Die Bezeichnung “Spieldose” führt in die Irre. Die Platten haben einen Durchmesser von schätzungsweise um 30 cm. Und diese Spieldosen haben eine hervorragende Klangqualität! Erbauer war Bruno Rückert, ebenfalls aus Leipzig, wie Ruprecht Langer, Leiter des Deutschen Musikarchivs, berichtet. Anschauen und anhören lohnen sich!
https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/klingendes-gedaechtnis/#s17/1