LeserclubSie wissen ja, dieser kaffeeverkleckerte Morgen deutete für Herrn L. in drei Richtungen. Eine Kompassnadel wies nach Schwaben, eine nach St. Petersburg. Und eine - das ahnte Herr L natürlich nicht - in eine muffige Kneipe mit dem honorigen Namen „Allerletzte Instanz“.
Sie befand sich nicht, wie eine Gaststätte ähnlichen Namens, in der die Gäste von hochnäsigen Kellnern auch heute noch platziert wurden und Butler mit weißen Handschuhen die Fahrzeuge der Gäste in die Tiefgarage fuhren, in der Nähe der hohen Gerichte, die dieser Stadt einen Ruf als unsicheres Pflaster eingetragen hatten. Jeder, der im Leben einigermaßen bei Sinnen war, wusste, dass es nach der „Letzten Instanz“ der Leute, die die dicken Börsen hatten, immer noch eine Station gab, wo ein dürrer Mann im angeschabten Frack erklärte, was eine Feuer- von einer See- und eine Kassen- von einer Waldbestattung unterschied.
Wer noch nicht da war, konnte natürlich nicht ahnen, dass es hier meistens sehr ausgelassen zuging. In der Hälfte der Fälle zahlte ja bekanntlich der Verstorbene die Zeche. Und manchmal saß er auch mit bei Tisch und musste sich noch einmal alle Bosheiten anhören, die er schon vor seinem seligen Abgang hatte über sich ergehen lassen müssen.
„Er hat ja nie auf mich gehört“, war so ein Spruch.
„Genau da treffen wir uns, junger Mann“, sagte die kratzige Stimme im Telefon. L. hat es nicht fertig gebracht, die fremde Nummer unhinterfragt zu lassen und den Hörer nicht abzunehmen. Es gehört schon ein gewisser Humor dazu, wenn einer sich die Telefonnummer 110 0815 zulegt.
Und so ein Gefühl in der Bauchgegend sagte ihm, dass er den Burschen kannte, der ihn nach dem Abheben einfach anherrschte: „Tachchen, Herr L. Sie können’s wohl einfach nicht lassen? Nicht mal die Toten sind Ihnen heilig, was?“
Und das klang wie früher, als ein bierbäuchiger Feldwebel Herrn L. auf dem Kasernenhof zusammenschnarrte nach Strich und Faden. Alte preußische Schule, dachte L. damals. Der seinen Fontane gelesen hatte und seine Hasek. Und der lange geübt hatte für das „Erlauben gehorsamst, Herr Feldwebel …“
Was ihm nicht viel nutzte damals. Es war nun einmal keine österreichische Armee, sondern eine im preußischen Geiste. Und Kujonieren war in dieser Armee eine Tradition.
Die bei manchen Leuten auch in der Stimme steckte, selbst wenn der Mann nun mittlerweile 70, 75, 80 Jahre alt sein musste. Längst außer Dienst. Schon damals war er ein bärbeißger alter Beamter gewesen. Damals, am Löwengehege im Zoo.
Aber wie hatte er von L.s Nachfrage erfahren, wenn er nicht auch noch als alter Zausel an seiner alten Dienststelle hing?
„Ich geb’s ja zu, Herr …“
„Sie und zugeben. Sie will ich mal im Verhör haben. Da werden Sie erst mal was zugeben ..-.”
„Ich hab aber …“
„Natürlich haben Sie. Halten Sie mich für blöd? Toter im Zoo, wa? Neue Erkenntnisse, wa? Sie setzen Gerüchte in die Welt, junger Mann …“
„Ich habe nur …“
„Verarschen sie keinen altgedienten Beamten. Das wird teuer. Um Eins seh’ ich Sie in der Allerletzten Instanz. Kennen Sie ja. Aber pünktlich. Ich hab nicht viel Zeit.“
Krachen im Hörer.
Und L. stand noch immer – halb diensteifrig gebückt, halb Hacken zusammen. Das hat ihn schon immer gewurmt, wie leicht ihm so ein Ton in Mark und Bein fuhr und alle seine genetisch ererbten Vorfahren und Untertanen stramm standen vor einem bläkenden Feldwebel, der doch selbst nur ein Muschkote war. Aber wer fragte danach in einem Land, in dem die Leute noch immer heimlich den Radetzkymarsch hörten und ihre Unterhosen bügelten und sich nach Feldwebeln sehnten?
„Hat er sich wenigstens vorgestellt? Wer war das?“, wollte sein Ressortchef wissen, der mitgehört hatte, vielleicht auch ein bisschen besorgt um die nächste Geschichte für die morgige Ausgabe. Aber das ließ er sich nie anmerken, schaute nur etwas strenger als sonst über seine Brille, als vermutete er in Herrn L. einen jener Spaßvögel, wie sie neuerdings in der Branche immer öfter aufschlugen und gern „was mit Medien“ machen wollten, aber nicht unbedingt arbeiten, sich rumärgern oder gar festbeißen. „Es gibt keine Bullterrier mehr“, zitierte er manchmal einen Film, den niemand gesehen hatte.
Und dass er den Neuen – und Herrn L. zählte er auch jetzt noch zu den Neuen – nicht für einen Bullterrier hielt, hatte er ihm schon mehrfach nicht nur zwischen den Zeilen zu verstehen gegeben. Immer wieder drückte er ihm Worte wie heimtückisch, höchst kriminell, ahnungsloses Opfer, brachiale Gewalt oder Raubzug der Gier in den Text, auch wenn L. nie über so etwas geschrieben hatte. „Texte müssen rauchen“, hatte er dann als Kommentar zu hören bekommen. Oder: „Wenn du da nicht ein bisschen Feuer reinbringst, liest es keine Sau.“
So dass L. oft nicht einschätzen konnte, ob die Leser nun empört wegen seiner Artikel anriefen oder wegen der Wörter, die drinstanden.
Also versuchte er auch in dem Text für morgen das Wort ruchlos unterzubringen. Musste ja irgendwie klappen.
Dubiose Vorgänge am Hermannkai
Hat eine ruchlose Immobilienmafia die halbe Stadt verramscht?
In längst vergessene Zeiten fühlten sich die Anwohner der Straße am Hermannkai am gestrigen Tage versetzt, als sie am frühen Morgen von Blaulicht aus dem Schlaf gerissen wurden. Eine ganze Flotte von Polizeifahrzeugen und staatsanwaltlichen schwarzen Karossen war vorgefahren vor einem der so edel aussehenden villenartigen Gebäude am einstigen Kanalufer. Vom Kanal sieht man nichts mehr, auch wenn hier die Bodenpreise schon seit ein paar Jahren unerbittlich in die Höhe klettern und Otto Normalverbraucher sich die Mieten und Kaufpreise in dieser künftigen Straße an einem von der Stadt wieder teuer instand gesetzten Ufer nicht mehr leisten kann.
Anwohner wie Frau B., die heute noch in einer bezahlbaren Genossenschaftswohnung auf der anderen Straßenseite wohnt und zum Jahresende gekündigt wurde, wie sie uns erzählte. Denn auch dieses Haus wurde jüngst erst verkauft. Und wenn unsere Informationen stimmen, hat dieselbe dubiose Immobiliengesellschaft ihre Finger im Spiel, der das prätentiöse Büro mit der noblen Adresse Hermannkai 26 gehört, genau jener Adresse, wo an diesem Morgen ein gutes Dutzend Polizisten und gnadenloser Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft vor der Tür standen und beharrlich Einlass verlangten.
Und auch bekamen. Ab 7 Uhr jedenfalls wurden Stapel von Akten aus dem Haus getragen. „Vier große Transporter voll“, verriet uns ein unbescholtener Bürger, der hier mit seinem Schäferhund unterwegs war (!), der uns auch gleich die Fotos der unübersehbaren Aktion zusandte.
Nach Auskunft der Staatsanwaltschaft handele es sich freilich um eine überschaubare Menge, die wir auch in der Lage sind, zeitnah abzuarbeiten.
Zeitnah? Bei der derzeit unübersehbaren Überlastung der hiesigen Staatsanwaltschaft? – „Zeitnah“, betonte Herr Dr. M., der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Und zwar noch dieses Jahr. „Davon können Sie ausgehen. In diesem Fall geht es nicht nur um irgendwelche herrenlosen Häuser.“
Vielleicht um Steuerhinterziehung? Sonst ist doch die Staatsanwaltschaft nie so schnell?
„Wir werden zu laufenden Vorgängen dieser Art keine Kommentare abgeben“, war die Antwort. „Erst recht nicht zu diesem.“
Womit sich unser Verdacht bestätigt, dass die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im Rathaus jetzt eine neue Wendung genommen haben. Denn dort wurden schon am gestrigen Tag sämtliche Akten zu jener (ruchlosen?) Immobilienfirma am Hermannkai in Verwahrung genommen, wo am heutigen Morgen die Haussuchung stattfand. Das Rathaus bestreitet zwar vorsichtig, dass die im Rathausarchiv beschlagnahmten Akten „irgendetwas mit dem Skandal um die Panama-Papiere zu tun haben könnten“.
Aber wir fragen: Warum wurden diese Akten dann komplett angefordert? Und warum: schon wieder? Denn diese Akten lagen schon einmal bei der Staatsanwaltschaft. Lang ist es her. (Jahr und Tag, bitte! – Kannste vergessen. Dann kann ich’s gleich für die Konkurrenz schreiben. – Schluderei. – Du kannst mich mal.) Und auch damals verkündete ein übereifriger Mitarbeiter der Stadtverwaltung unserer Zeitung gegenüber, dass ein unbescholtener Amtsträger in seinem hohen Hause durch „nichts, was in diesen ganzen Akten stünde, in irgendeiner Weise belastet würde“ und man auf entsprechende Unterstellungen von Seiten der Presse künftig mit anderen Maßnahmen reagieren wolle.
Welche Maßnahmen das sein sollten, das wurde seinerzeit nicht verraten. Auch weil in den folgenden 20 Jahren nie wieder jemand nach diesen Akten fragte. Bis gestern. Und der von uns angefragte Staatsanwalt bestätigte, „dass es durchaus einen dringenden Verdacht gebe, der sich aus der Aktenlage ergebe“.
Welcher Verdacht, das wollte er auch auf Nachfrage nicht präzisieren. Es könnte sich also durchaus auch um ein paar schwerere Verbrechen handeln. (Konkreter?!- Vergiss es.)
- hätte L. sich jetzt durchaus noch mit dem Ressortchef darüber streiten können, ob der letzte Satz unbedingt drin bleiben müsste. Aber dazu hatte er jetzt eigentlich keine Zeit. Der Termin drängte. Und ein verschrobener Bursche wartete in der „Allerletzten Instanz“ auf ihn. Mantel schnappen, Mütze, Tasche, ein letzter Blick auf das kaffeefarbene Malheur unterm Schreibtisch.
„Ich bin dann mal …“
„He, das kannst du so nicht schrei …“
Türknauf schnappen, loslau …
Und dann mit einem Schrank von Mensch zusammenkrachen. Das war dann eigentlich alles eins, bevor L. sich von einer riesigen Pranke von den Füßen gehoben sah und so richtig am Schlafittchen gepackt fühlte. „Chab ich dich, du Chundesohn …!“
Alle Teile der Serie zum Nachlesen.
Vorhergehender Teil Nr. 16
Die schöne Belinda oder Warum zuviel Mitgefühl die schönste Geschichte zerhaut
Teil Nr. 15
Herr L. ärgert gleich in früher Stunde ein paar Leute und steigt in staubige Ecken hinab
In eigener Sache – Eine L-IZ.de für alle: Wir suchen „Freikäufer“
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
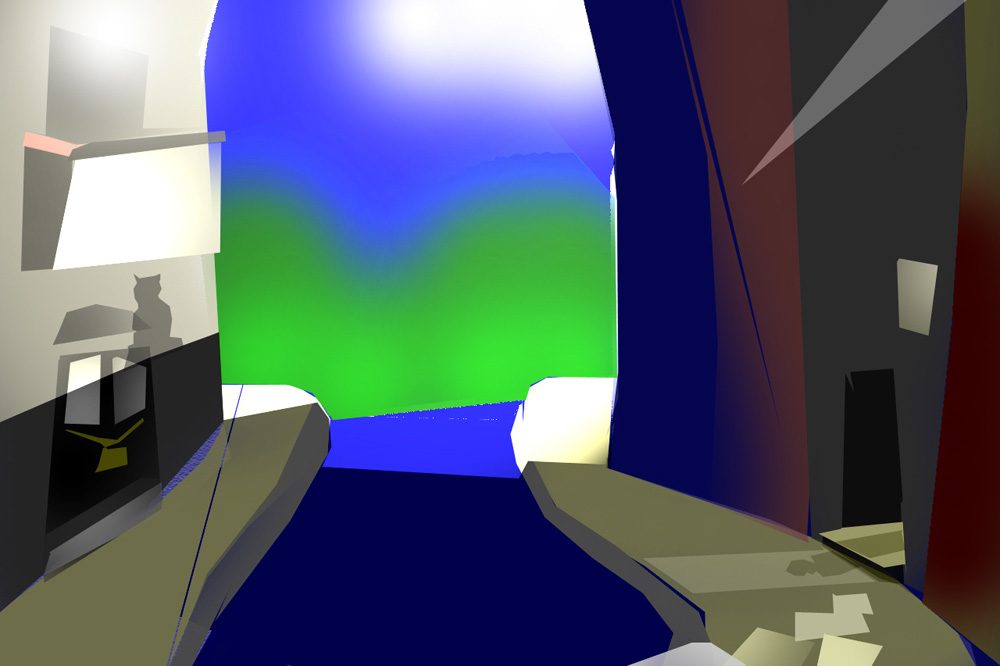








Keine Kommentare bisher