Einen Trend, mit dem heute Zeitungsverlage versuchen Geld zu verdienen, haben auch sächsische Zeitungsleser schon mitbekommen: Die Zeitungen versuchen über Nebengeschäfte zum Service-Dienstleister zu werden. "Dynamisches Dienstleistungszentrum", nennt es Michael Haller in seinem Buch.
“Für die Zukunftssicherung unerlässlich ist die enge Kooperation mehrerer Regionalverlage sowie die Verwandlung des Zeitungshauses in ein dynamisches Dienstleistungszentrum, das rund um seine angestammte Kernmarke eine Palette lokaler Dienste und Services tastend und testend im Markt erprobt und entwickelt”, schreibt er zu dem Thema, zu dem dann unter anderem Peter Stawowy zur DD+V Mediengruppe (die unter anderem die “Sächsische Zeitung” herausgibt), den Versuch einer Analyse bringt, wie gut sich das Zeitungshaus mit Reisebüro, Ticketservice, eigenem Vertrieb oder gar Marketingaufträgen ein drittes Standbein aufgebaut hat. Das Problem ist nur: Dazu gibt es eigentlich keine belastbaren Zahlen, ob’s wirklich dauerhaft funktioniert. Ebenso wenig wie das Projekt einer Wochenzeitung der SZ.
Aber irgendwie scheint die Zahl, die Michael Haller nennt, derzeit die Chefs in den großen Zeitungshäusern umzutreiben auf der Suche nach einer funktionierenden Finanzierung des Geschäfts: 33:33:33. Ein Drittel der Erlöse werden über Abo und Verkauf generiert, ein Drittel über Werbeumsätze, ein Drittel über “Dienstleistungen”.
“Die Sachsenbank zählt in ihrem jährlichen Ranking die DD+V Mediengruppe, Mutterhaus der Sächsischen Zeitung und der Morgenpost Dresden, zu den Top 100 Unternehmen in Mitteldeutschland. Mit 205 Millionen Euro Umsatz und über 1.900 Beschäftigten hatte man sich im Jahr 2013 noch einmal gegenüber 2012 verbessert (Sachsenbank 2014)”, stellt Stawowy fest, während Denni Klein, Leiter des Projekts “Lesewert” bei der “Sächsischen Zeitung” erläutert, wie man mit organisiertem Feedback von neu gewonnenen Lesern versucht, die Zeitung den neuen Nutzungsgewohnheiten anzupassen.
Selbst dieses Buch von Haller zeigt: Es gibt eigentlich zwei Welten.
Und beide agieren völlig anders. Die Großen versuchen, einen Markt zurückzugewinnen, aus dem sie sich durch ihre Burgmentalität selbst herausgekegelt haben.
Und dann gibt es da die vielen kleinen Projekte, die deutschlandweit von frustrierten Journalistinnen und Journalisten gestartet wurden, weil ihnen die bräsigen Lokalzeitungen keine lokalen Texte mehr abgenommen haben. Das aktuell genutzte Schlagwort dazu lautet “Hyperlokalität”. Viele der gern gefeierten Projekte beschränken sich auf eine Stadt, eine Region oder auch nur (wie in Hamburg oder Berlin) auf einen Stadtteil.
“Die sublokalen Online-Medien sind ein Fluchtpunkt für idealistische, aber vom Medienbetrieb desillusionierte Journalisten und ein ideales Experimentierfeld für die wachsende Gruppe der Kreativen, die sich in den Metropolregionen konzentrieren, oft in prekären Verhältnissen leben und ‘irgendwas mit Medien’ machen wollen”, schreibt Wolfgang Michal in seinem Beitrag dazu. “Die Kiezmagazine bilden eine Art Auffangnetz für all die neugierigen und bildungshungrigen Leser, die in ihrer Regionalzeitung nichts Interessantes mehr über ihr Viertel finden können.”
Nur scheint den Meisten dann doch bei allem Fleiß ziemlich bald die Luft auszugehen. Michal: “Wie den Oldenburgern geht es vielen hyperlokalen Online-Medien. Wer ihre Homepage-Adressen auf den Vernetzungsplattformen kiezblogs.de oder lokalblogger.de anklickt, wird schnell feststellen, dass zahlreiche Seiten wieder verwaist sind und nur noch als Archive oder Medienruinen im Netz herumstehen. Bei manchen ist der letzte Blog-Eintrag über ein Jahr her, doch in der Start-up-Szene ist der unbemerkte Übergang in die digitale Friedhofsruhe nichts Ungewöhnliches. Hyperlokale Medien funktionieren nach dem Trial-and-Error-Prinzip. Die Irrtümer überwiegen.”
Einige Projekte werden im Buch trotzdem vorgestellt, sehr euphorisch, samt den Versuchen, sich mit Solibeiträgen, Spendensammeln oder Fundraising irgendwie doch zu finanzieren. Gleichzeitig werden Projekte geschildert, wie alte und neue Medienangebote versuchen, die crossmedialen Möglichkeiten des Internets zu nutzen, auch neue Erzählweisen zu generieren. Die aber, wenn man ein wenig darüber nachdenkt, doch wieder die alten sind, die so lange vergessenen und von den großen Medienhäusern nicht mehr gefragten.
Da wird zumindest ein wenig der Leser sichtbar, den auch Haller nicht wirklich erfasst. Denn die Frage lautet ja nach wie vor: Für wen macht man eigentlich Zeitung? Und: Was ist eigentlich Zeitung? Und: Was wünschen sich Leser, was ihre Zeitung sei?
Ein kleines Statement dazu findet man im Beitrag von Robert Berlin zur “Rhein-Zeitung”: “Somit richtet sich Rhein-Zeitung.de nur noch an zahlende Leser, nicht mehr an die digitalen Flaneure aus aller Welt. ‘Mittelfristig wird dies die Website verändern: weg vom Klickgeschäft, hin zu einem prasselnden Kaminfeuer, vor dem man in Ruhe gute Texte lesen, zuverlässig das Wichtigste vom Tag im Lokalen und die eine und die andere aufwendige, multimediale Aufbereitungen erleben kann’, so Schwarze.” Marcus Schwarze ist Leiter für Digitales bei der “Rhein-Zeitung” in Koblenz.
Was dann Hallers Analyse um einen wichtigen Aspekt ergänzt.
Der hatte ja in seiner Analyse festgestellt: “Quer durch alle Altersgruppen erwarten auch heute die meisten Erwachsenen von der Tageszeitung, dass sie über das aktuelle Geschehen in der großen wie in der kleinen (lokalen) Welt zuverlässig ins Bild gesetzt werden.” Eine Orientierungsfunktion habe sie, die aus der “Informationsleistung (nachrichtliche Aktualität und Recherche) und der Interpretationsleistung” bestehe.
Wenn es nur das wäre, wären Zeitungen sehr nüchterne, sehr trockene Angelegenheiten, die niemanden aufregen und niemanden interessieren würden. Die notwendige Emotionalität fehlt, das, was Schwarze das “Kaminfeuer” nennt, das Gefühl, dass Leser sich heimisch fühlen, gut unterhalten werden, Vertrauen haben und – das wird in einigen Beiträgen des Buches angesprochen – auch gefragt sind, mitreden, sich einbringen dürfen. Zeitungen mussten schon immer kommunizieren, nur dass dieser Prozess heute zumeist in den “social media” stattfindet, wo er eigentlich nicht hingehört.
Und damit kommen wir zur gesellschaftlichen Rolle der Zeitungen. Denn sie informieren ja nicht nur über das, was geschieht, sie sind Mittler für die gesellschaftlichen Diskurse. Und da wird’s dünn.
Nicht nur in Großstädten, wenn Zeitungsmonopolisten die Thementiefe und Themenvielfalt verringern, sondern erst recht in den kleineren Städten und Gemeinden. Und da kommen wir wieder nach Norwegen. In seinem Beitrag zur norwegischen Zeitungslandschaft erwähnt Dirk Arnold einen wichtigen Fakt: “Der Erhalt der Besiedelung auch in den entlegenen Landesteilen stellt ein nationales Anliegen dar. Die ausgeprägte Verwaltungsautonomie der Kommunen zählt zum Kernbestand norwegischer Demokratie. Das föderale Konzept ermöglicht die direkte Mitwirkung der Bürger an der Kommunalpolitik, was ein hohes Bedürfnis nach lokaler Informiertheit erzeugt, wofür die Lokalblätter genutzt werden.”
So ganz nebenbei ein hochaktuelles sächsisches Thema, auch wenn die sächsische Staatsregierung das Thema Demografie und “Besiedelung auch in den entlegenen Landesteilen” derzeit völlig vergeigt hat und wohl auch nicht mal versteht.
Und zu diesem “Erhalt” gehört nun einmal auch die Existenz einer lokalen Berichterstattung. Die in Sachsen kaum noch ein Thema ist, weil sich die bestehenden Zeitungsmonopolisten immer weiter aus den ländlichen Räumen zurückziehen, am stärksten “Freie Presse” und LVZ.
Und das ruft eben nicht nur “Kiezprojekte” auf den Plan, das verändert auch politische Landschaften. Nach Heidenau haben große Medien, die mal schnell eingeflogen sind, großmäulig über die Abwesenheit gesellschaftlichen Widerstands gegen die rechte Szene lamentiert. Aber sie hätten auch alle einfach in den Spiegel schauen können: Wo waren sie denn in den letzten Jahren? In Heidenau? Das glaubt doch kein Mensch.
Gesellschaften verarmen regelrecht, wenn es keine öffentlichen Diskurse mehr gibt.
Und so seltsam das klingen mag: Es gibt kein anderes Medium, das so gut geeignet ist, gesellschaftliche Diskurse darzustellen, zu unterfüttern und auch mal anzutreiben, wie Zeitungen. Übrigens: Es ist schnurzpiepegal, ob sie gedruckt oder digital daher kommen. Sie müssen nur da sein, die Regionalreporter, die sofort dran sind, wenn sie merken, dass es irgendwo klemmt, brennt, knirscht, schwächelt, wenn Gemeinden kleine Probleme haben und Kommunen große.
Und das liegt nicht an der Art der Ausstrahlung. Es geht um die Art der Wahrnehmung, der Präsenz, Genauigkeit und der absoluten Orts- und Personenkenntnis.
Und wo es diese unabhängige Darstellung und Reflexion nicht mehr gibt, da driften Regionen ab. Ihnen fehlen Kontra und Widerhall. Und es entstehen die in sich abgekapselten Gesellschaften, die dann so befremdlich in den öffentlichen Raum taumeln wie z. B. Pegida & Co. Das ist nicht durch einen “überregionalen” Diskurs zu lösen, sondern nur lokal, vor Ort. Was natürlich heißt: Leser wollen und brauchen echte lokale Zeitungen.
Aber da sind wir schon deutlich über den Analyserahmen des Buches hinausgeprescht. Obwohl es eigentlich nur ein kleiner, logischer Schritt ist. Nicht nur für Journalisten, die dieses riesige Loch in der hiesigen Medienlandschaft sehen, sondern auch (siehe Norwegen) für die kommunalen Vertreter. Aber da sind wir ganz schnell bei all den sinnfreien sächsischen Kommunalreformen, die die lokalen Ebenen immer weiter geschwächt haben. Mit dem Ergebnis, dass einer ausgedünnten Lokalberichterstattung eine kränkelnde kommunale Selbstverwaltung gegenüber steht.
Aber wer zwei so wichtige gesellschaftliche Elemente schwächt, braucht sich über ein Heidenau in Sachsen wirklich nicht zu wundern.
Michael Haller (Hrsg.) “Wir brauchen Zeitungen. Was man aus der Zeitung alles machen kann. Trendbeschreibungen und Best Practices“, edition medienpraxis, Herbert von Halem Verlag, Köln 2015, 18 Euro
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
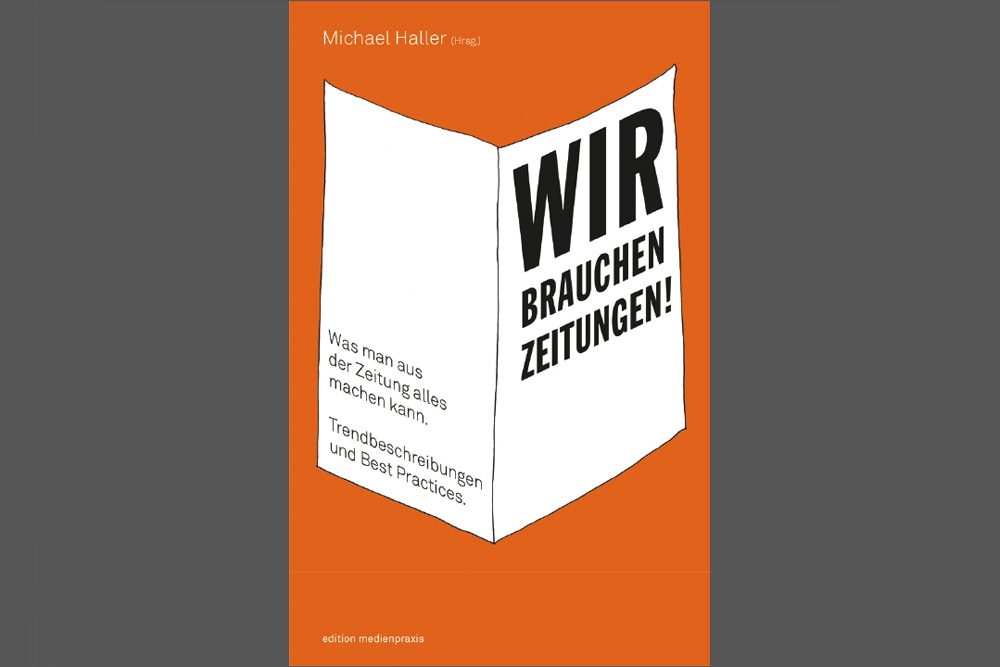








Keine Kommentare bisher