LEIPZIGER ZEITUNG/Auszug Ausgabe 85, seit 20. November im HandelMein bester Freund, auch Lehrer für Englisch und Geschichte, hat seit längerem die Nase voll. „Dieser Beruf macht schon Spaß, aber ich sehe einfach nicht das Resultat meines Tuns. Es ist keine Tischlerei, in der ich am Ende des Tages meine Produkte zählen und stolz sein kann“, pflegt er schon eine Weile zu sagen. Weitere Beispiele aus anderen Handwerksberufen folgen hin und wieder. Und er hat recht.
Als Lehrer sieht man nicht immer gleich, was des eigenen Tuns Auskommen ist und wenn man sieht, dass ein Schüler gute Leistungen bringt, lässt sich nicht zweifelsfrei nachweisen, dass dies auch mit dem eigenen Unterricht in Zusammenhang steht. Kein Schüler sagt oder schreibt am Ende seiner Antwort: „Danke Herr Hofmann, dass sie mich befähigt haben, diese Antwort zu geben.“
Der Lehrerberuf ist dahingehend schwierig und zermürbend, weil man eventuelle Fehlentwicklungen nicht wie im Handwerksberuf lediglich auf sein eigenes Tun zurückführen kann, sondern mehrere Faktoren eine Rolle spielen und die Arbeit des Lehrers unterschiedlichen Einfluss hat. Gleichzeitig ist man als Lehrer immer an vorderster Front, kann sich im Unterricht selten wegducken, laufen die Fäden – wenn’s gut läuft – die ganze Zeit in Lehrerhand zusammen.
Morgens erst mal einen Kaffee trinken und in Ruhe den Rechner hochfahren, die Post sichten, durchatmen, den Kollegen noch ins Büro ein „Guten Morgen“ und schließlich erst loslegen, wenn die eigene Wohlfühltemperatur erreicht ist, ist im Lehrer-Job selten möglich. Zwei Gründe, warum ich das möglicherweise nicht ewig machen will.
Die erste Grundregel der Lerntheorie lautet: Man kann kein Wissen von einem Kopf in einen anderen eins zu eins zu übertragen. Lernen ist ein individueller kognitiver Prozess, der nicht sichtbar ist. Es kann also nicht erwartet werden, dass Schüler das Wissen des Lehrers so in ihrem eigenen Gehirn abbilden können wie er selbst. Vielleicht ist das schon eine Enttäuschung für manchen Kollegen.
Mir selbst fällt es manchmal schwer, mich über außergewöhnlich positive Lernergebnisse von Schülern zu freuen. Natürlich ist es großartig, wenn Schüler Inhalte aus dem Unterricht für sich selbst durchdrungen und durchdacht haben. Aber dann kommt auch schon die Frage: Hat er das alles bei mir gelernt? Gerade im Fach Englisch ist das so eine Sache. Angebote wie Netflix, YouTube, das Computerspiel Minecraft oder die App Discord bieten multiple Möglichkeiten, Englisch zu hören und zu sprechen. Gerade während des ersten Corona-Lockdowns haben sich einige „meiner“ Schüler eigenen Angaben nach dort ausgetobt.
Neulich las ich eine Erörterung einer Schülerin, die bisher eine klare 3 auf dem Zeugnis hatte, weil sie nie sprachliche Richtigkeit und Ausdrucksvermögen gemeinsam aufs Papier gebracht hat – und ich zweifelte. Das ist auch so typisch Lehrer. „Wer hat ihr wohl geholfen?“, „Hätte ich das vielleicht doch nicht als Hausaufgabe aufgeben sollen?“, „Jetzt denkt sie, sie kann es, dabei ging es nur mit Hilfe.“ Schlimm ist das. Wieso kann man nicht einfach darauf vertrauen, dass sich Schüler entwickeln, einen sogenannten Sprung machen? Wieso kann man als Lehrer sich nicht einfach auf die Schulter klopfen und sagen: „Das habe ich gut gemacht“?
Weil, ja weil eben nicht klar ist, wie viel Prozent nun hausgemacht sind und wie viel über den Input aus dem Unterricht kommen. Es ist nicht ohne weiteres messbar. Außerdem können auch schon mal ein paar Monde ins Land gehen, bis sich Inhalte bei Schülern festsetzen. Bei anderen ist selbst das Datum der nächsten Mondfinsternis zu knapp bemessen, um darauf zu vertrauen, dass er oder sie dann Inhalte aufgenommen hat.
Als Lehrer hat man natürlich im Gefühl, wenn eine Unterrichtsstunde besonders gelungen oder auch besonders schlecht war. Aber selbst das bedeutet nicht automatisch vollen Lernerfolg. Wie sagte unser Didaktiker früher immer. „Sie müssen sich vorstellen, sie haben später 28 Schüler vor sich. Und da gibt es nur zwei Zustände: Licht an oder Licht aus, aufmerksam oder nicht aufmerksam. Aber selbst wer aufmerksam zuhört, muss es nicht immer gleich verstehen.“ Soviel dazu.
Das hat übrigens nichts mit Erfolgen und Misserfolgen zu tun. Letztere kann ich mir auch sehr gut selbst attribuieren.
Frustrierend daran ist, dass Lehrer die volle Unterrichtszeit für den Erfolg der Schüler arbeiten (wollen/sollen). Schüler und Eltern erwarten vollkommen zu Recht, dass Lernen so arrangiert und ermöglicht wird, dass der größtmögliche Lernerfolg bei den Schülern zu sehen sein wird. Das bedeutet aber: Als Lehrer musst du im Klassenzimmer funktionieren.
Du solltest nicht zu oft betonen, wie nervtötend so eine erste Stunde eigentlich ist, wenn früh um 6 nicht nur der Wecker klingelt, sondern schon mindestens ein Kind um dich herumgetanzt ist, was irgendeine Art von Fürsorge braucht. Das interessiert zu Recht niemanden. Genauso wenig wie Schüler interessiert, wie lange du am Abend zuvor noch geplant, korrigiert, telefoniert oder mit dir selbst gehadert hast.
Professionalität gebietet, dass du deinen Gemütszustand nicht vor den Schülern auspackst. Wenn die Klingel zur 1. Stunde surrt, falls es eine Klingel gibt, dann gibt es nur eins: Vorwärts. Schüler begeistern, für sich gewinnen, mitnehmen, inspirieren und das geht am besten mit guter Laune. Lehrer sind eben auch manchmal Schauspieler, besonders am Morgen – oder in Stunde sechs oder sieben.
Ich habe schon oft genug darauf hingewiesen, dass auch Pausen keine Ruhe versprechen. Schüler, Kollegen, Schulleitungsmitglieder bringen Fragen, suchen nach Antworten. Abschalten, runterkommen, sich mal auf einen Kaffee beim Kollegen verkriechen, in der Mittagspause dreißig Minuten spazieren gehen oder eine Runde – oder solange wie die Kollegen Zeit haben – glückselig Tischkicker spielen ist nicht drin. Funktionieren! Mitdenken! Vordenken! Nachdenken! Das Gehirn rattert in einem fort und das kann an langen Tagen schlauchen.
Freistunden verschaffen zumindest dahingehend Linderung, dass man zumindest nicht von 28 Augenpaaren beobachtet und beurteilt wird, sondern auch mal die Hände in die Hosentasche können, das Hemd aus der Hose rutschen kann und die Haare nicht gut liegen müssen. Erleichterung.
Nicht jeder Tag hat sieben Unterrichtsstunden, es gibt Tage mit einer, zwei oder drei Stunden. Das ist keine Überraschung. Aber sie sind bei Vollzeitlehrern selten und nur auf Kosten von mehreren vollen Tagen zu haben. Wer 26 Unterrichtsstunden oder selbst bei zwei Abminderungsstunden 24 Stunden pro Woche unterrichtet, muss im Schnitt pro Tag 5 Unterrichtsstunden ran und sich zeigen. So als wenn jedes Mal von vorn der Vorhang gelüftet wird und eine Zaubershow beginnt.
Aber wie lange mag der Zauberer sich selbst leiden, wie lang vermag er auf der Bühne stehen und immer nur sein Temperament regulieren und gleichzeitig Entscheidungen treffen, vorplanen und zuhören in einem? Es ist eine Herausforderung, dies bis ins Rentenalter durchzuziehen.
Zur Ungleichbehandlung von Lehrern an freien und staatlichen Schulen
Zur Ungleichbehandlung von Lehrern an freien und staatlichen Schulen
Leipziger Zeitung Nr. 85: Leben unter Corona-Bedingungen und die sehr philosophische Frage der Freiheit
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
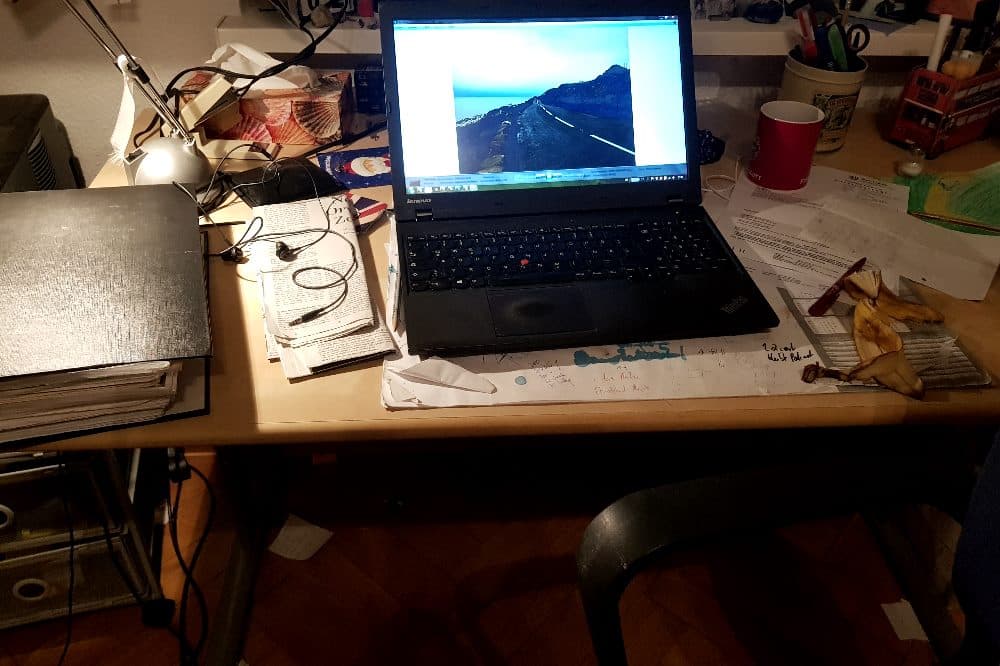











Keine Kommentare bisher