Wenn im Lehrerzimmer die Computer und die Sitzplätze knapp werden, wenn Kollegen fluchend durch das Zimmer stapfen und in den entlegensten Winkeln nach vermissten Notenbüchern schauen, wenn Taschenrechner gefühlt dem Goldwert entsprechen und selbst 17 Uhr noch keine Nachmittagsstille eingekehrt ist, dann verdichten sich die Anzeichen, dass bald das Schul(Halb)jahr zu Ende geht. Keine Zeit im Schuljahr ist für uns Lehrer stressiger als diese. Da müssen wir nämlich mal was tun ...
Ich habe insgesamt rund 790 Noten in die Notenbücher eintragen müssen: Kopfnoten und Jahresendnoten von acht Klassen. Lehrer mit Zwei- oder Ein-Stunden-Fächern dürfen für elf Klassen Listen befüllen. Wer jedem Schüler bei den Kopfnoten gerecht werden will, hat sich zu jedem Schüler und zu jedem Bereich „Ordnung“, „Mitarbeit“, „Fleiß“ und „Betragen“ seine Notizen über das Schuljahr gemacht. Diese würde er nun sichten und zu einer Note kommen. Bei sechs Klassen in der Sekundarstufe I mit 25 Schülern und vier Noten pro Schüler sind das alleine 600 Noten, über die man sich klar werden muss. Dazu die Jahresabschlussnote.
Nein, ich will nicht klagen. Ich habe es mir ja ausgesucht, ich habe insgesamt acht Jahre dafür gearbeitet und insgesamt 33 Prüfungen absolviert, um am Ende im Klassenzimmer zu stehen und mir von Außenstehenden immer wieder sagen zu lassen: „Ach, den Stress hast du am Anfang. In 20 Jahren musst du doch nichts mehr machen.“ Wenn es jemals ein Buch darüber geben wird, wie Menschen in Deutschland über die Arbeit des Lehrers denken, dieser Satz würde mit Sicherheit auf den ersten Seiten zu finden sein. Das launige „Lehrer müsste man sein“ wäre heißer Titelanwärter.
Müsste man das wirklich? Lehrer? Theoretisch hat jeder die Chance dazu. Daran erinnere ich auch jeden, der sich kurzzeitig in einem Klassenzimmer wähnt und mir subtile Vorwürfe macht, ich würde berufsmäßig faulenzen. Aber selbstredend wollen meine Gesprächspartner immer nur ins Klassenzimmer, um am Nachmittag viel Zeit zu haben. Erst neulich sprach eine Frau in meinem Beisein von „widerlichen Teenagern“, mit denen sie „nichts zu tun haben“ wolle. Da könne sie nämlich nicht an sich halten. Tja, zeitig Feierabend hat eben seinen Preis.
Aber was heißt schon zeitig? Na gut, ich gebe zu: Ich habe dieses Jahr auch ein paar Stunden aus dem Ordner gezaubert. Aber das einzige Hilfreiche daran ist, dass man zumindest erst mal das Material für den Unterricht zusammenhat: Arbeitsblatt-Vorlagen, Lehrbuchverweise, Aufgabenstellungen. Mehr ist es aber auch nicht, denn nie kann ein Lehrer mit seinem Stoff so wie im letzten Jahr voranschreiten. Da gibt es Überhang aus der letzten Stunde, da müssen Hausaufgaben verglichen werden, Tests geschrieben oder schlicht Themen anders angepackt werden. Einmal abends 22 Uhr in einen meiner 13 Ordner gegriffen und quasi mit dem Schlafengehen den nächsten Tag vorbereitet: So einfach ist es nicht.
Sonntags arbeiten?
Pro Stunde investiert man noch einmal mindestens 30 Minuten in die direkte Vorbereitung, was ein etwaiges Einlesen in das Thema, in die Biografie eines Protagonisten der kommenden Stunde mit einschließt. Ein jeder kann bei 26 Unterrichtsstunden, die vollbeschäftigte Lehrer in Sachsen pro Woche halten, die Wochenarbeitszeit ausrechnen.
Dazu kommen die täglichen Duelle am Kopierer. An meiner alten Schule waren 45 Minuten vor Unterrichtsbeginn schon alle Messen gelesen, da blieb nur Platz 6 oder 7 in der Schlange vor dem Kopierer. Jetzt gibt es immerhin drei Kopierer. Auch wer abends in den ominösen Ordner greift, muss morgens im Zweifel zum Kopierer. Und wer abends nichts hat, wo er reingreifen kann, bereitet seine Stunden vor. Einlesen ins Thema, Material heraussuchen, Aufgabenstellungen erstellen, Unterrichtseinstieg, Transferleistung am Ende. Wer es ordentlich macht, kann für jede Unterrichtsstunde 60 Minuten Vorbereitungszeit rechnen.
Bei aufwendigen Methoden wie Gruppenarbeit auch gern länger. Ganz abgesehen davon, dass eine Unterrichtsstunde nie perfekt ist. Aber das kann man ja alles 20 Jahre lang verwenden … Wird eigentlich in 20 Jahren immer noch dasselbe in den Geschichtsschulbüchern stehen? Übrigens wird auch sonntags Unterricht vorbereitet.
Alles Routine hier
Ganz zu schweigen vom Korrekturaufwand, der logischerweise jedes Jahr neu anfällt. „Die Intelligenz eines Lehrers zeigt sich schon bei der Fächerwahl“, frotzeln die Kollegen gern untereinander. Nähme man das an, wäre ich saudumm. Englisch und Geschichte sind dahingehend undankbare Fächer, vor allem wenn man einen Englisch-Leistungskurs zum Abitur führt. Nicht nur, dass Klausuren natürlich länger sind als Klassenarbeiten, die Fehleranalyse ist auch umfassender als in einer 5. Klasse. Jeder Schüler will ja wissen, wieso er jetzt schon wieder nur 7 oder 9 Notenpunkte hat und wie er sich verbessern kann.
Schnell Haken dran und weglegen ist nicht. Feedback-Kultur heißt das Modewort, was eigentlich nur eine Selbstverständlichkeit beschreibt: Ein Schüler kann sich nicht verbessern, wenn er auf seiner Arbeit richtig und falsch sieht. Das wird nur gehen, wenn er die Fehler aufgelistet bekommt und Lösungsansätze und/oder Ratschläge quasi als Sahnehäubchen dazu. Das wird übrigens auch in 20 Jahren noch meine Aufgabe sein.
Und so kommen pro Klausur schon mindestens 45 Minuten zusammen, 36 Klausuren pro Halbjahr sind es. Die Rechnung ist einfach. Dasselbe noch mal für Geschichte, wo der Fehleranalyse-Aufwand mit Sicherheit geringer, die Texte aber länger und die Behauptungen steiler sind.
Ja ja, es unterrichten ja nicht alle Lehrer Englisch und Geschichte. Ich weiß. Die beneide ich auch manchmal, obgleich vor allem die Sportlehrer immer behaupten, sie hätten trotzdem genügend zu tun.
Was, schon wieder Ferien?
Und dann diese schier endlosen Ferien. Was soll ich bloß mit meiner Zeit anfangen? „Schon wieder Ferien? Na dir geht es gut.“ Ach ja? Das einzig Gute an den Ferien ist: Man kann etwas länger schlafen und muss abends nicht bis spät am Schreibtisch sitzen. Denn Korrekturen fallen auch über die Ferien an, endlich bleibt Zeit, mal das Arbeitszimmer zu säubern, die eigene Stoffverteilung zu überprüfen, Material für die kommenden Wochen zu sichten und das eigene Tun zu hinterfragen.
Ja, ich weiß. Das sollten diese Lehrer viel häufiger. Ihr Tun hinterfragen.
Und am letzten Ferienwochenende wird der Unterricht für die ersten Tage vorbereitet. Von zwei Wochen Ferien bleiben dann vielleicht drei Tage echte Entspannung übrig. Logisch, dass die Februar- und auch die Sommerferien am beliebtesten sind. Denn zumindest Korrekturen gibt es dann keine mehr. Dafür bleibt mehr Zeit für die Weiterbildung. Es gibt mit Sicherheit eine Geschichtsepoche, über die man noch etwas lernen kann – und was ist eigentlich gerade in Großbritannien oder den USA los?
Im Übrigen kann man auch über den Unterricht hinaus noch so einiges anstellen … In der Jobbeschreibung hieß es immerhin: „über die Maßen engagiert“. Aber dafür brauche ich nicht mehr Liebe, mir reicht schon durchschnittliche Anerkennung. Ich habe es ja so gewollt.
Weiter gehts in Teil 3: Und täglich grüßt der Widerling
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:

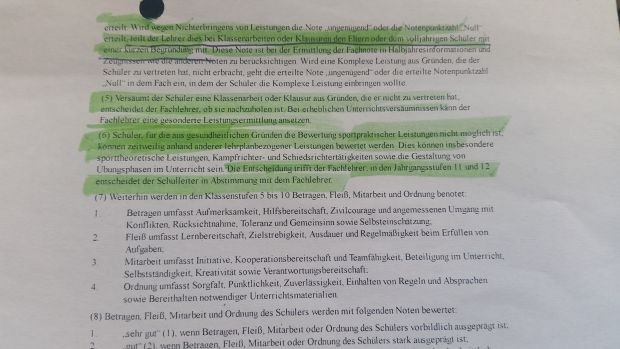









Keine Kommentare bisher