Den Kommunismus verlor Jens-Fietja Dwars schon als Kind. Mitten in jenem ganz DDR-typischen Kommunismus, in dem sich junge Erwachsene zusammentaten, um aus einem ehemaligen Flussschwimmbad an der Saale ein Gemeinschaftsprojekt zu machen. Ein Projekt, das genau in dem Moment zu scheitern begann, als die Mitglieder der kleinen Gemeinschaft begannen, aus den alten Umkleidekabinen kleine Bungalows zu machen und sich wohnlich abschotteten. Mit der schönen Gemeinschaft war es dann ganz schnell vorbei.
Mit dem offiziellen Kommunismus noch nicht. Der hatte noch über zwei Jahrzehnte verkniffene Bastelei vor sich, über die Dwars in diesem Erzählungsband schreibt. Der hatte 2006 schon einen Vorläufer mit „Die alte Kuh und das Meer“. Dwars hat ihn erweitert. Aber wer eine Abrechnung mit dem abgeschafften Kommunismus erwartet, wird sie in dieser Weise nicht finden. Es geht dem Autor und Verleger aus Thüringen nicht um Politik. Auch wenn es immer auch Politik ist, die in die Erlebnisse seiner Protagonisten hineinfunkt und auch Stimmungen beeinflusst. Entscheidungen sowieso wie in der Geschichte „Wer die Wahl hat“, in der eine junge Lehrerin im Frühjahr 1989 alles tut, um den Vater eines Schulkindes vom Selbstmord abzuhalten. Eine Hilfsbereitschaft, die ihr schon wenig später auf die Füße fällt, weil ihr der Weg zur allmächtigen Stasi als Belastung ausgelegt wird.
Wobei Dwars schon sehr genaues Augenmerk auf die Probleme seiner Heldin legt, in einem Land zu leben, in dem Verstellung geradezu Grundvoraussetzung dafür war, irgendwie durchzukommen. Sie aber kann nicht lügen. Und ihr Lebensgefährte hatte wohl recht, als er sie davor warnte, sich als Wahlhelferin zu den Kommunalwahlen im Frühjahr 1989 verdonnern zu lassen.
Zeiten-Wende
Ganz bewusst hat Dwars seine Erzählungen in ein Davor und ein Danach eingeteilt, in „Die alte Welt“ und in „Die neue Welt“. Und letztlich geht es in fast allen Geschichten um die Frage, wie man in dieser Welt ein anständiger Mensch bleiben kann. Exemplarisch etwa in der Geschichte des Grenzsoldaten erzählt, der mit anschauen muss, wie sein Begleiter an der Grenze eine junge Frau erschießt, und er dafür später in einem Gerichtsprozess wegen Mittäterschaft zur Verantwortung gezogen wird („Stunde der Wahrheit“).
Oder am Beispiel des jungen Studenten, der ein geradezu exotisches Studium in Polen beginnt, sich dort verliebt, aber bei der Begegnung mit der Familie seiner Freundin erlebt, wie tief die Wunden des Zweiten Weltkriegs und der deutschen Besatzungsmacht noch immer waren. Für die betroffenen Generationen noch: unheilbar („Von der Liebe Ohnmacht“).
Wann macht man sich schuldig? Da ist eigentlich eine Frage, die sich die Akteure in Dwars’ Geschichten immer wieder stellen. Und das hat 1989/1990 nicht wirklich aufgehört, auch wenn sich nun alle Figuren in völlig neuen Verhältnissen einrichten müssen, Verhältnisse, die auf andere Weise immer wieder neu die Entscheidung erzwingen: Bleibt man ein anständiger Mensch oder handelt man egoistisch?
Eine Frage, die sich erst recht dann stellt, wenn man – wie es Dwars’ Heldinnen und Helden meistens geht – nicht viel Geld hat und bei allem, was man sich gönnt, Mark und Euro dreimal umdrehen muss. Und dann doch – wie beim Urlaub an der Ostsee – merkt, dass andere Leute keine Rücksicht nehmen. Nicht auf das Leben einer preisgekrönten Kuh („Die alte Kuh und das Meer“) und nicht bei den Angriffen auf den ersten Italiener, der glaubte, im Ostseebad eine wirtschaftliche Zukunft haben zu können.
Und auch der scheinbar dauerrauchende Mieter im Haus bekommt sein Fett weg, weil sich der Erzähler der Geschichte einfach nicht traut, an dessen Tür zu klingeln und ihn zu bitten, das Quarzen einzustellen. („Nachbarn“). Auch das ist „die neue Zeit“, eine Zeit, in der man schon aus Angst, dass ein Gespräch in eine aggressive Konfrontation ausarten könnte, anderen Menschen eine simple Bitte zuzumuten.
Verstörende Zeiten
Man geht im Grunde so verstört aus der „alten Zeit“ in die „neue Zeit“, dass man sich nicht einmal mehr wundert, wenn man das Buch zuschlägt und sich in der Gegenwart genauso verstört fühlt. Als wäre schon wieder alles Menschliche für inakzeptabel erklärt worden.
Jedes Mitgefühl einfach lächerlich und selbst in Partnerschaften ein offenes Gespräch über die eigenen Wünsche und Versagensängste nicht mehr möglich. So wie in „Schöne Bescherung“, wo der Held zum Weihnachtsfest die neue Geliebte seiner Fraui präsentiert bekommt, wo er doch so schön gezeigt hat, dass er prima auch allein zurechtkommt. Oder wie in „Der Anruf oder Das erste Mobiltelefon“, wo ein aufgezeichnetes Gespräch auf dem Gerät seinen Besitzer in tiefe moralische Nöte stürzt.
Die optimistischste Geschichte ist dann tatsächlich jene, in der der Protagonist eine geradezu himmlische Begegnung im Café hat, nachdem er sich völlig verstört dorthin verirrt hat („Audienz am Dienstag“).
Eine Geschichte, in der sich all die Verunsicherungen einer ständig von Perfektion besessenen Welt in dem Erzähler ballen, der schon gar nicht mehr weiß, wie er ohne das Gefühl, ständig beobachtet und bewertet zu sein, durch seinen Alltag kommen kann.
Dass beide Zeiten zwingend zusammengehören, betont Jens-Fietje Dwars in seinem P.S. in Bezug auf den 1990 abgeschafften „Apparat der Mächtigen“. „Auch die Ohnmächtigen, damals wie heute, tragen ihn fort, als lang nachwirkende Prägung im Guten wie im Schlechten, Verhaltensmuster, die sich noch immer in Gesten und Worten verraten, an denen man einander erkennt oder erkannt wird.“
Obrigkeitliche Gesellschaften prägen das Verhalten ihrer Bewohner – der mächtigen genauso wie der ohnmächtigen. Auf vielerlei Weise. Und wer sich dessen nie bewusst wird, reproduziert immer wieder die alten, eingeübten Verhaltensweisen, kommt aus seinem Gefühlskorsett nicht heraus. „Liebe und Haß schaffen Bindungen über das Grab hinaus. Wer nicht loslässt, wird abhängig, auch von dem, was er einst bekämpft hat.“
Das darf man sehr wohl auch auf die politische Ebene beziehen, auch wenn Dwars bei ganz normalen menschlichen Schicksalen bleibt. Denn eins weiß er, weil er es genau so allüberall auch beobachten kann: „So lebt das Land in den Leuten fort, verteufelt und verklärt.“
Fremd in der Welt
Wir leben in Klischees, deutet er an. Und das stimmt letztlich auch. Oft sind es gerade noch diese Klischees, die die durch ihre Leben irrenden Menschen noch irgendwie mit der Realität verbinden, während sie sich einsam und fremd fühlen in einer Welt, in der scheinbar nichts mehr zu stimmen scheint. Und nur noch „Sensationen“ über die Wahrnehmungsschwelle dringen.
Was auch auf die zerflatterte Medienwelt und die Bestseller-Titel in den Buchhandlungen zutrifft. So wie in der Geschichte „Müde“, in der ein alt gewordener Autor über sein mögliches Ende schreibt und dann vom regionalen Chefkritiker auch noch nachgerufen bekommt: Warum habe er sich denn dann nicht umgebracht?
Häme? Bosheit? Die blanke Lust am Verletzen und Zerfetzen? Als könne man den Anderen in seiner Betroffenheit nicht mehr respektieren? So gesehen sind Dwars’ Gechichten eine kleine Bestandsaufnahme eines ungeheilten Zustandes. In dem das Zwischenmenschliche unter die Räder gekommen ist und die erlebte Distanz zueinander sich in Aggression verwandelt.
Als wären immer die anderen Schuld am eigenen Unbehagen. Und wer ein Amt hat, der darf richten? Auch so eine Frage, die sich Jens-Fietje Dwars stellt, ziemlich irritiert von diesen kleinen Macht-Gelüsten der Mitmenschen. Und sich trotzdem dessen bewusst, dass jeder nur einen kleinen Ausschnitt von allem sieht. Ein Ausschnitt, der auch trügen kann, wie er in „Der Passant“ erzählt.
Es hilft wohl nichts: Der Mensch muss seine Höhle verlassen und unter Menschen gehen. Sich auf die unverhofften Begegnungen einlassen, die einem manchmal erzählen, dass man in seiner eigenen Blase immer nur einen Schatten der Welt wahrnimmt, wie sie wirklich ist. Und sich damit selbst um ein Leben voller bereichernder Begegnungen bringt.
Jens-Fietje Dwars „Wie ich den Kommunismus verlor“ quartus-Verlag, Bucha bei Jena 2024, 18 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
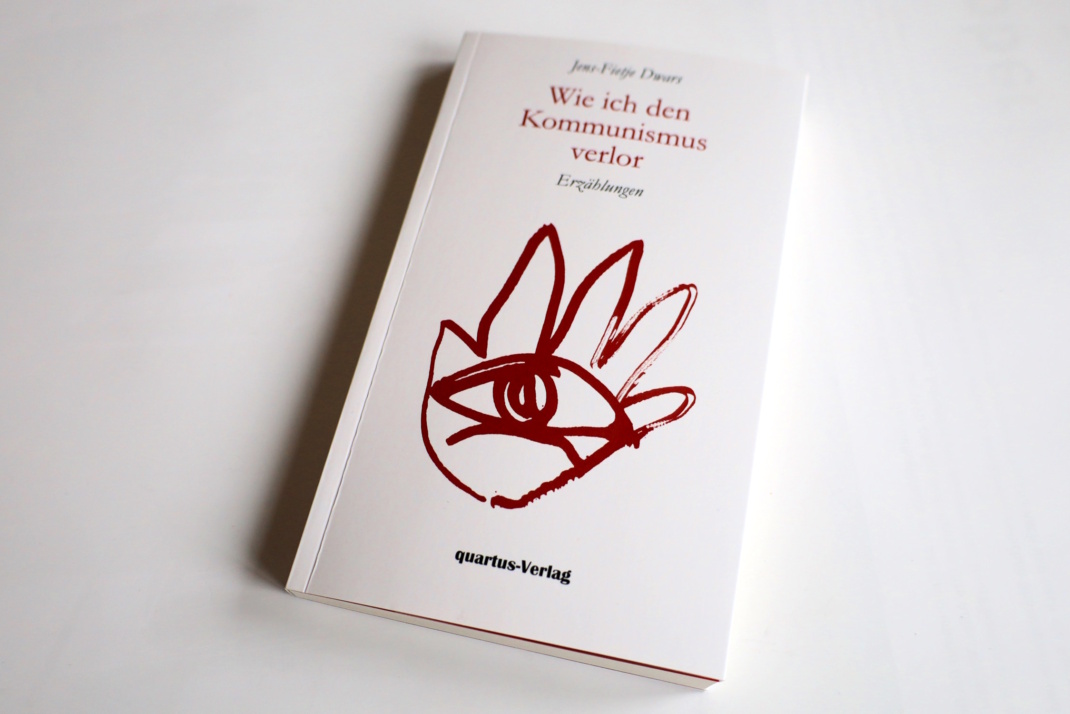
















Keine Kommentare bisher