„Über sich redete Hanna selten, es fragte auch niemand nach. Nur einmal kam sie ins Reden, da war Karl schon tot und sie fast achtzig.“ Andere Autoren wären happy, wenn sie solche Sätze als Anfangssätze für ihre Bücher finden könnten. Und auch Annett Gröschner hätte so diesen Roman über die Floristin und Kranfahrerin Hanna Krause beginnen können. Sie kann solche Sätze. Sie besitzt das seltene Talent, ein ganzes Menschenleben zu erzählen in einer Lakonie, die erst recht sichtbar macht, was Menschen wie Hanna im Leben auszuhalten hatten. Und das war erschreckend viel.
Und es braucht am Ende diese Enkelinnen, die zuhören, die wissen wollen, die es schaffen, die Schale des Schweigens aufzubrechen. Was wenigen gelungen ist. Denn die Frauen, die den Krieg überlebt haben, haben das Schreckliche, das ihnen widerfahren ist, fast alle bis zum Lebensende tief in sich verschlossen. Sie waren oft genauso traumatisiert wie die Männer, wenn sie – wie Hanna – die Bombardierungen ihrer Stadt miterlebt haben.
Nicht nur eine, sondern mehrere. Denn Magdeburg war auch damals schon ein Zentrum des Schwermaschinenbaus und damit einer der Hauptproduktionsorte für die deutsche Wehrmacht. Ganz im Zentrum das Grusonwerk, Teil des Krupp-Konzerns und immer wieder Ziel für die alliierten Bomberangriffe, die nicht nur das notdürftige Obdach von Hannas Familie zerstörten, sondern sie auch geliebte Menschen kostete, die in diesen Bombenangriffen ums Leben kamen.
Und dabei waren eigentlich Blumen ihr Lebensinhalt. Als Tochter einer Magdeburger Floristin hatte sie selbst einen kleinen Blumenladen im „Knattergebirge“, wie der Volksmund diese Gegend nah an der Elbe nannte. Eigentlich ein armes Stück Stadt. Aber Hanna holte sich Ideen für ihre Blumengestecke, wo sie sie finden konnte. Doch mit dem Krieg kommt das Ende, bleiben die Kunden weg und der kleine Laden geht insolvent. Sodass Hanna sich als Putzkraft im Grusonwek verdingt, wo ihr Mann Karl auf dem Kran saß. Auf dem später Hanna sitzen wird, weil Karl durch einen Unfall, der vielleicht auch kein Unfall war, ein Bein verlor.
Wenn Aufgeben nicht infrage kommt
Ach, dieser Karl, möchte man sagen. Seine Rolle wirkt wie nur skizziert, und trotzdem spürt man in ihm einen der vielen Männer, wie sie so typisch waren nach dem Krieg. Auch wenn seine Unfähigkeit, wirklich ein liebender Vater und rücksichtsvoller Ehemann zu sein, eher nichts mit dem Krieg zu tun hat. Es ist Hanna, die die kleine Familie am Laufen hält. Und die sich nicht kleinkriegen lässt, auch wenn in diesem Krieg dann doch das Schlimmste passiert und sie im Flammeninferno ihren Sohn verliert, nachdem sie mit den Kindern nur knapp im Keller der getroffenen Kirche überlebt hat.
Gerade hier entfaltet die Lakonie in der Erzählweise von Annett Gröschner ihre ganze Kraft, nimmt die Leser geradewegs mit hinein in Situationen, die eigentlich nicht auszuhalten sind. Und in denen man dennoch merkt, wie diese Frau sich regelrecht verbietet, zusammenzubrechen.
Wie Hanna immer weiter macht, so wie Millionen Frauen im größten Entsetzen immer weiter gemacht haben. Hauptsache, die Kinder überleben, sie haben etwas zu essen auf dem Tisch und ein Dach über dem Kopf. Die Männer sind ihr da keine große Hilfe. Solange Karl das Haus verlassen kann, vertrinkt er das Geld in den Kneipen, aus denen Hanna ihn spätnachts nach Hause lotsen muss. Um den Haushalt kümmert er sich nicht. Und ein Mensch, mit dem Hanna ihre Sorgen und Nöte teilen könnte, ist er auch nicht. Das kann sie eher mit ihrer Halbschwester in Berlin oder der Schwiegermutter, die einen ebenso elenden Tod im Bombenhagel findet.
Eigentlich sind es die Blumen, die Hanna nicht verzweifeln lassen. Sie nimmt sie mit in den Kranführerstand, legt neben der Werkhalle ein richtiges Blumenbeet an, später auch unterm Fenster ihre Neubauwohnung. Das Foto eines Blumengemäldes begleitet sie ein Leben lang, bis sie das Gemälde in Holland tatsächlich sieht. Und auch das Kriegsende bedeutet nicht das Ende der Schrecken. Denn beim Zugunglück von Langenweddingen 1967 stirbt die Tochter ihrer Freundin Edith. Noch ein verbranntes Kind, das sie in ihren Albträumen unterbringen muss.
Unerzählte Geschichten
Und man ahnt, wie lange diese Geschichte schon im Kopf der Autorin heranreifte, gerade weil das eine Geschichte ist, die weder vor 1990 noch danach ins Erwartungsraster des großen Feuilletons passte. Annett Gröschner erzählt keine Heldengeschichte, die wird auch nicht zur introvertierten Nabelschau.
Sondern sie zeigt eine Frau, wie sie eigentlich prägend war für dieses von Männern demolierte Land, Frauen, die gar nicht auf die Idee kommen konnten, ein konservatives Hausfrauendasein zu führen, weil das Geld in der Familienkasse immer zu wenig war und jedes weitere Kind die finanzielle Not der Familie noch vergrößerte. Jedes Mal stand Hanna vor der Frage: Abtreiben oder nicht?
Und bis zuletzt bleibt es für sie ein Trauma, dass sie zwei ihrer Kinder nicht begraben konnte. Nur: Sie redete nicht darüber. Annett Gröschner erzählt die Geschichte, die Millionen Frauen nicht erzählt haben. Und die dennoch ihre Töchter und Enkelinnen geprägt haben. Bis heute. Denn auch wenn es nicht erzählt wird, wird es weitergegeben, prägt die Handlungsweisen der Nachkommenden. Steht immer im Raum, wenn das Leben die Kinder und Enkel vor Entscheidungen stellt.
Und so wird ein Stück ostdeutscher Geschichte greifbar, das in den Großerzählungen eigentlich nie vorkommt. Obwohl es das Leben von Millionen Familien geprägt hat und bis heute prägt. Auch die noch heute virulente Ernsthaftigkeit, mit der Menschen im Osten um ein Leben in Würde ringen.
Denn darum geht es eigentlich. Und Annett Gröschner schafft es, aus dem scheinbar so kleinen Leben der Hanna Krause eine Erzählung von einem Leben in Würde zu machen. Einer Würde, die Hanna auch in der Zeiten der schlimmsten Not bewahrt. So wie an dem Tag, als ihr Karl Invalide wurde. „Karl bekam vom Werk nur eine kleine Invalidenrente.
Also ging Hanna rüber zu Krupp-Gruson, Putzen im Verwaltungsgebäude.“ Und man merkt: Das ist kein kleines Leben. Im Gegenteil. Annett Gröschner erzählt von der stillen Größe einer Frau, die um ihre Stärken weiß, die sich von den Männern auch nicht einschüchtern lässt, als sie die Prüfung zur Kranführerin macht. Und die ihren Karl mehr als einmal aus der Patsche holt, wissend, dass sie allein der Motor in dieser kleinen Familie ist.
Den Laden am Laufen halten
Und es färbt ab. Ihre Töchter werden ähnlich selbstbewusst. Entwickeln eine ganz ähnliche Stärke, das Leben so zu nehmen, wie es ist, und sich von Männern nicht sagen zu lassen, wie es sein sollte. Denn wer gelernt hat, sich mit dem Nötigsten durchzuschlagen, der entwickelt einen stillen Stolz. Der sich vererbt. Und der auch fordernd sein kann. Bis in eine Gegenwart, in der diese ganzen ostdeutschen Geschichten nicht mehr zu passen scheinen. Aber es gibt sie noch, auch wenn es meist nicht die Frauen sind, die sich zu Wort melden. Weil sie überwiegend viel zu beschäftigt sind, den Familienladen am Laufen zu halten und alles zu tun, damit es den Kindern gut geht.
Wie sehr Hanna, die eigentlich recht harsch mit den Töchtern umgeht, an den Kindern hängt, merkt man immer dann, wenn etwas Schlimmes passiert und Hanna stumm leidet und aushält und weitermacht, weil es für sie gar keine andere Lösung gibt, als weiterzumachen und auszuhalten. Und so erzählt Annett Gröschner stellvertretend ihre Geschichte, gibt Hanna ein ganzes Leben, in dessen Mittelpunkt das alte Magdeburg steht, in dem sie aufgewachsen ist, und das dann unter Bombenteppichen ausgelöscht wird. Und so gibt sie im Grunde einer ganzen Frauengeneration eine Stimme, die bisher eigentlich nie gefragt wurde, wie sie mit all dem Grauen und den Verlusten umgegangen ist.
Und wie sie danach einfach weitermachen konnte. Hart geworden, verschlossen, oft aus guten Gründen nicht bereit, dem Grauen auch noch Sprache zu verleihen. Obwohl alle Familen, die so etwas in ihrer Geschichte haben, davon erzählen könnten, weil dieses Schweigen sich – laut und eigentlich nicht zu ignorieren – fortpflanzt durch die Generationen.
Und es löst sich nur, wenn man es endlich erzählen kann. Auch wenn es erst die Enkelin ist, die es erzählt. Lakonisch, wie auch Elke Heidenreich feststellte. Aber gerade deshalb umso dichter und mitreißender. So, dass man Kapitel um Kapitel spürt, welche Lasten da eigentlich ein Leben lang auf dieser kleinen Frau lagen, die am Ende in einer Wohnung mit lauter verblühten Blumensträußen lebt.
Und die den Mächtigen auf die Pelle rückt, als diese ihre Tochter ins Gefängnis sperren. Mit Hauspantoffeln sitzt sie Tag für Tag vorm Gefängnis. Ein stummer Protest, der einem so vertraut ist. Schon wieder, möchte man meinen. Als würden mächtige Männer nie begriffen, was sie den Kindern antun. Und den Frauen, von denen sie immer erwarten, dass diese stumm und duldsam funktionieren.
Da dürfte sich so mancher beim Lesen von der eigenen, nie erzählten Familiengeschichte eingeholt fühlen. Es darf einen zerreißen dabei. Denn diese Geschichte ist wahr. So wahr wie das Leben der Frauen, die den Laden immer am Laufen halten, wenn die Männer glauben, sie müssten Weltgeschichte machen.
Annett Gröschner „Schwebende Lasten“ C. H. Beck, München 2025, 26 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
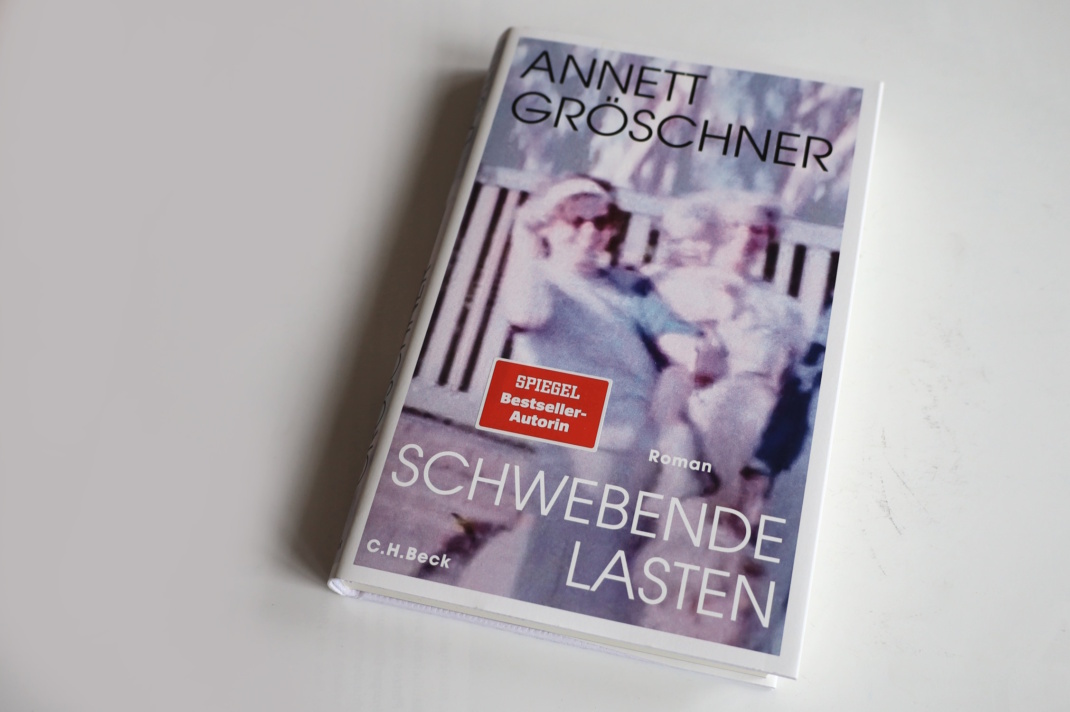












Keine Kommentare bisher