Es ist ein Abschied. Ein bisschen märchenhaft. Ein bisschen anarchisch – so wie die beiden Hauptdarsteller, die sich Signum-Herausgeber Norbert Weiß und Jens Wonneberger für dieses letzte Heft der 1999 in Dresden gegründeten Signum-Reihe ausgesucht haben. „Blätter für Literatur und Kritik“ heißt es im Untertitel. Halbjährlich erschien jeweils ein dickes Heft. Und einmal im Jahr gab es auch noch ein Sonderheft, in dem ein besonderes literarisches Thema aufgegriffen wurde.
Oder eben das Schicksal von Autorinnen und Autoren, die nicht vergessen werden sollten. Und mit einem solchen Sonderheft beenden die beiden Herausgeber jetzt nach 26 Jahren tatsächlich die Signum-Reihe. „Über allen Gipfeln ist Ruh’“, zitieren sie ganz lakonisch ein Goethe-Gedicht.
Sodass alle Leser, die dieses Heft in die Hand bekommen, nun auch das letzte Signum-Heft überhaupt vor sich haben. Und das ist tatsächlich einer Märchentochter und einem Rebellen gewidmet, einem der markantesten Schriftsteller-Paare der deutschen Literatur: Lisa Tetzner und Kurt Kläber. Und wem beim Namen von Kurt Kläber nichts einfällt, der darf an sein Pseudonym Kurt Held denken, unter dem auch sein bekanntestes und erfolgreichstes Kinderbuch erschien: „Die rote Zora und ihre Bande“ (1941). Aufgelegt bis in die Gegenwart.
Auch weil mit Zora ein Mädchen die Heldin ist, die sich als Anführerin einer Bande von Waisenkindern durchs Leben schlägt, Vorbild für viele Mädchen der jüngeren Zeit, die mit Zora gelernt haben, dass man sich nichts gefallen lassen darf. Schon gar kein Unrecht und keine Ausgrenzung.
Wenn Rebellen sich begegnen
Lisa und Kurt sind Kinder aus Mitteldeutschland. Lisa wurde in Zittau geboren, Kurt in Jena. 1924 heirateten sie. Der Vagabund, die Märchenerzählerin, könnte man sagen. Aber das wäre zu simpel. Und würde die Zeit ausblenden, in der sie ihre Jugend erlebten – den Ersten Weltkrieg genauso wie die Emanzipationsbewegungen ihrer Zeit.
Auch Lisa war ein rebellisches Kind und wollte ganz gewiss nicht so, wie ihr Vater wollte. 1919 lernten sich Kurt und Lisa kennen – wohl auf einer Wanderschaft. Und merkten ziemlich schnell, wie sehr sie einander verwandte Seelen waren. Möglicher Stifter dieser Bekanntschaft: der Verleger Eugen Diederichs, in dessen Verlag in Jena Lisa ihre Märchenbücher veröffentlichte.
Schon allein dafür wäre sie unbedingt Teil der deutschen Literaturgeschichte. Selbst im Rundfunk hatte sie eine damals bekannte Märchenstunde.
Die Begegnung erzählte Lisa noch ein bisschen anders: „Es war im Jahr 1919. Ich wanderte märchenerzählend durch den Thüringer Wald. In einer kleinen Stadt, Lauscha, dem Mittelpunkt der Glasbläser, traf ich eine laute Kirchweih, mit vielen Buden und Wagen der Schausteller. Besonders eine Bude fesselte sofort meinen erstaunten Blick. Davor stand ein junger Bursche mit dichtem, braunem, ziemlich struppigen – oder sagen wir offen – liederlichem Haar.“
Aber der wild aussehende Bursche hatte Prinzipien und war selbst ein guter Erzähler. Er veröffentlichte Bücher wie „Barrikaden an der Ruhr“ in linken Verlagen und geriet 1933 natürlich ins Fadenkreuz der triumphierenden Nazis, die ihn nach dem Reichstagsbrand verhafteten. Und wahrscheinlich wäre ihm ein elendes Leben in deren Gefängnissen oder Konzentrationslagern sicher gewesen, hätte Lisa nicht alle Tricks angewandt, ihn aus den Krallen der Polizei zu befreien.
Auch diese Geschichte wird in diesem Signum-Heft erzählt, das sich auf sehr lockere und feuilletonistische Art diesen beiden Menschen annähert, sie auch mit Ausschnitten aus ihren Büchern kurz vorstellt. Denn natürlich liegen diese Bücher heute nicht mehr auf den Bestseller-Tischen. Sie laufen eher in den Programmen einiger deutscher Verlage so mit.
Lesestoff bis in die Gegenwart
Nicht nur „Die rote Zora und ihre Bande“ wird immer wieder aufgelegt, sondern auch Lisa Tetzners bekanntestes Kinderbuch-Projekt „Erlebnisse und Abenteuer der Kinder aus Nr. 67“, dessen neun Einzelbände zwischen 1933 und 1949 erschienen und in dem sie die Schicksale der Kinder aus dem Haus Nr. 67 in Berlin über die ganze Nazi- und Kriegszeit hinweg erzählt. Ein Buch, mit dem sich die Zensoren in der Schweiz und der frühen Bundesrepublik gewaltig schwertaten.
Kinderundjugendmedien.de schreibt dazu: „In der BRD erfuhr die Kinderodyssee erst im Zuge der Aufarbeitung des Nationalsozialismus ab der Mitte der 19070er Jahre ihre richtige Würdigung. 1980 wurde Lisa Tetzners Kinderodyssee unter dem Titel ‘Die Kinder aus Nr. 67 oder Heil Hitler, ich hätt’ gern ‘n paar Pferdeäppel’ verfilmt. Zeitgleich zum Film veröffentlichte der Sauerländer Verlag 1980 eine Sonderausgabe, die bis heute weitere Auflagen erfährt. Der Deutsche Taschenbuch-Verlag hat die Bände in seine Reihe ‘dtv junior’ aufgenommen.“
1933 gelang es Lisa und Kurt, aus dem bedrohlich gewordenen Deutschland zu fliehen und nach Stationen in der Tschechoslowakei und Frankreich in der Schweiz ein anfangs sehr prekäres Unterkommen zu finden. Bis sie dann in Carona nicht nur ein eigenes Haus bauten, das sie Casa Pantrova nannten, Haus des Brotes.
Und da dieses Haus bis heute eine Oase für ruhebedürftige Schriftsteller/-innen ist, spielt es im Signum-Heft eine besondere Rolle. Hier kommen Autoren zu Wort, die noch die Gastfreundschaft von Lisa und Kurt erlebten, ihre langen Kämpfe um die Schweizer Staatsbürgerschaft und den Abschied von den beiden so besonderen Menschen. Andere Autoren schildern die Casa, wie sie diese in jüngster Zeit erlebten.
Zwei zum Wiederentdecken
Und in gewisser Weise war das Schreiben von Kinderbüchern für Kurt Kläber auch eine Rettung, denn eigentlich war ihm, ein bekennender Kommunist, das Schreiben von Büchern in der Schweiz untersagt. Was ihn in eine tiefe Depression stürzte. Bis er – wohl auch durch Lisa angeregt – begann, ebenfalls Kinderbücher zu schreiben.
Und so ganz nebenbei bekommt man mit, dass die beiden auch das Zentrum eines letztlich den Erdball umspannenden Netzwerkes waren, in dem die Emigranten aus Deutschland Kontakt miteinander hielten. Viele waren zuvor auf dem Weg in die Emigration in der Schweiz zwischengelandet – so wie Bert Brecht und Thomas Mann -, aber nicht dort geblieben. Auch weil die Schweizer Politik eher versuchte, die Emigration in die Schweiz zu verhindern und die dort gelandeten Flüchtlinge schnellstmöglich wieder loszuwerden.
Aber letztlich ist das Heft auch eine Wiederentdeckung zweier Schreibender, die viel zu selten genannt werden, wenn es um Autoren aus Mitteldeutschland geht. Obwohl Lisa Tetzner zum Beispiel zu einem Vorbild für eine noch viel berühmtere Kinderbuchautorin wurde – für Astrid Lindgren.
Und sie schrieben auch nach 1945 weiter. Und auch Märchen aus aller Welt gab Lisa Tetzner weiter heraus. Ganz vergessen sind die beiden also nicht. Und viele Enkel dürften die Kinderbücher der beiden wohl auch noch im Regal ihrer Großeltern finden. Oder gar vorgelesen bekommen, weil die Bücher nach wie vor aktuell und lesenswert sind. Rebellisch sowieso.
Und so ist der Abschied mit diesem Signum-Sonderheft vielleicht für so manchen auch der Beginn einer neuen Bekanntschaft mit zwei markanten Gestalten der deutschen Kinderliteratur, deren Bücher heute immer noch von jeder neuen Lesergeneration entdeckt werden können.
Norbert Weiß, Jens Wonneberger (Hrsg.) „Signum Sonderheft Märchentochter & Rebell“, Dresden 2025, 8,20 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
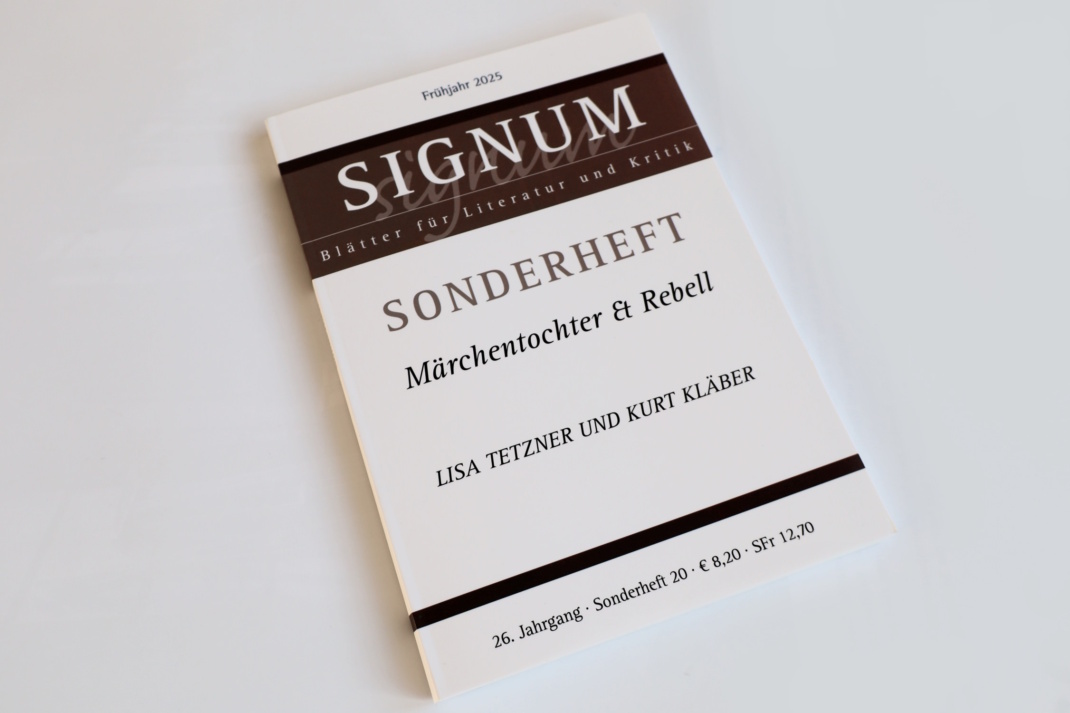















Keine Kommentare bisher