In der Vergangenheit galt in der Regel, dass es vor allem junge Leute sind, die sich radikalisieren. Auf der Suche nach einem Sinn in ihrem Leben, einer klaren Botschaft und einer starken Truppe, in der man akzeptiert wird. Doch der Rechtsruck in unserer Gesellschaft in den vergangenen Jahren wird dadurch geprägt, dass immer mehr ältere Menschen sich radikalisieren und in Filterblasen abtauchen. Was dann oft zu heftigen Problemen in ihren Familien führt. Und die Kinder und Angehörigen suchen dann natürlich nach Hilfe. Aber wo? Erste Beratungsstellen gibt es dafür. Eine davon ist ZEBRA in Baden-Württemberg.
Es ist die Zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen des Landes Baden-Württemberg, wo Dr. Sarah Pohl arbeitet. Mirijam Wiedemann arbeitet in der Stabsstelle Religionsangelegenheiten /Staatskirchenrecht im Kultusministerium von BW. Da hatte man – wie anderswo auch – jahrzehntelang stets nur die Jugendlichen im Blick, die man mit entsprechenden Sensibilisierungs- und Medienkompetenzprogrammen versuchte, vor Radikalisierungstendenzen zu bewahren. Damit haben vergleichbare Arbeitsstellen in allen Bundesländern Erfahrung, dafür gibt es umfassende Programme.
Doch nicht nur in Baden-Württemberg gibt es immer mehr Anfragen von betroffenen Familienangehörigen, die mit sich radikalisierenden Eltern und Großeltern konfrontiert sind. Ein Problem, das sich mit den Verschwörungserzählungen während der Corona-Zeit massiv verschärft hat. Und das seitdem auch nicht verschwunden ist.
Denn wer einmal in den geschlossenen Welten der Verschwörungserzählungen gelandet ist, findet dort Bestätigung, glaubt sich wieder handlungsfähig in Zeiten von scheinbarem Chaos und zunehmender Unübersichtlichkeit. Der „Sturz ins Kaninchenloch“ erfüllt einen ganz bestimmten Sinn für die Betroffenen. Das weiß man längst bei ZEBRA und in all den Breatungsstellen, die inzwischen Beratungsangebote für die betroffenen Angehörigen anbieten.
Die unterschätzten Brüche im Alter
Aber um zu verstehen, was da eigentlich mit den Seniorinnen und Senioren passiert, wenn sie – für Angehörige anfangs oft unbemerkt – in die Filterblasen abtauchen, haben die beiden Autorinnen den Hauptteil dieses Buches mit Beispielen aus der Praxis gefüllt. Beispiele, die in jedem Fall auch zeigen, wie sehr das Abdriften in radikale Weltsichten mit den tatsächlichen Kalamitäten des Alters zusammenhängen. Nicht ohne Grund spricht der Untertitel von der Generation 50+, denn das ist die Generation, die mit zwei heftigen Veränderungen in ihrem Leben konfrontiert ist.
Der erste – und viel zu oft unterschätzte – Bruch ist der Auszug der erwachsenen Kinder. Von heute auf morgen stehen die Eltern dann auf einmal da, die Kinder füllen nicht mehr Alltag und Denken, was nun? Und gleich naht auch noch das nächste Drama: das Ende des Berufslebens. Ein Sprung im Leben, in dem viele Menschen in ein Gefühl der Nutzlosigkeit abstürzen, weil ihre Arbeit ihr ganzes Leben mit Inhalt und Struktur erfüllt hat. Und das ist auf einmal weg.
Und dazu kommt dann oft der nicht reflektierte Umgang mit den „Social Media“. Was Befragungen in letzter Zeit immer wieder bestätigt haben: Die jungen, mit dem Internet aufgewachsenen Generationen wissen in der Regel, wann sie Fakenews und Fakeprofilen begegnen.
Sie können damit umgehen. Doch gerade die älteren Generationen verfügen nur über wenig Medienkompetenz und sind damit im Umgang mit den Plattformen wesentlich ungeschützter und vertrauensseliger. Und damit auch anfälliger, allen möglichen Verführern auf den Leim zu gehen. Freiwillig, weil viele dieser Angebote genau das versprechen, was ihnen in ihrem einsam gewordenen Alltag abhandengekommen.
Wo Argumente nicht (mehr) funktionieren
Die im Buch versammelten Fallbeispiele zeigen sehr eindrücklich, dass das Abdriften in die Filterblasen immer auch Ursachen im persönlichen Lebensabschnitt der Betroffenen hat. „Die Radikalisierung älterer Menschen ist eng mit ihrem sozialen Umfeld verbunden und kann nicht isoliert betrachtet werden“, schreiben die Autorinnen im zweiten Teil des Buches, in dem es dann darum geht, was Angehörigen geraten werden kann, wie sie mit ihren Eltern und Großeltern dann eigentlich noch umgehen können.
„Wenn ein Familienmitglied plötzlich politische und religiöse Überzeugungen ins Radikale ändert, hat dies zwangsläufig Auswirkungen auf die Familien und den Freundeskreis.“ Die Irritation ist groß. Die Ratlosigkeit ebenso. Was kann man da noch tun?
Was nicht funktioniert, ist Überzeugungsarbeit. Argumente und Faktenchecks funktionieren nicht. Sie bestärken die Betroffenen in der Regel nur in der Abwehr, vertiefen die Gräben und schaffen keine Verständigungsbasis. Denn so funktionieren ja Filterblasen: Sie bieten ein in sich geschlossenes Weltbild, das alle Kritik und alle Einsprüche abprallen lässt. Wer damit konfrontiert wird, empfindet das als Angriff und stellt sofort auf Abwehr um.
Was natürlich im familiären Kontext überhaupt nicht hilft. Also muss das Gespräch auf eine andere Basis kommen. Denn die Menschen, die uns auf einmal so fremd begegnen, sind ja nicht allein die radikalisierte Meinung. Sie sind immer noch auch die Menschen, die wir vorher gekannt haben. Weshalb das Buch vor allem deutlich macht, wie man gerade deshalb wieder eine gemeinsame Gesprächsebene herstellen kann und muss.
Und wie man auch wieder lernen muss, sich den scheinbar so Abgedrifteten selbst wieder zuzumuten – mit seinen Gefühlen, seinen eigenen Sorgen. Denn wenn die Menschen mit ihren Fragen zu den radikalisierten Senioren in die Beratungsstellen kommen, haben sie ja selbst ein Problem. Sie leiden unter der Situation und wollen in der Regel auch nicht einfach alle Brücken abbrechen.
Es gibt keine Patentrezepte
Also gilt es – oft genug mühsam, und in aller Verletzlichkeit – wieder eine gemeinsame Gesprächsebene zu suchen. Ohne agitieren zu wollen. „In vielen Fällen haben wir beobachtet, wie wichtig es ist, Kontakt zu halten“, schreiben Pohl und Wiedemann. „Das Gespräch nicht abzubrechen, im Dialog zu bleiben, gemeinsame Unternehmungen trotz unterschiedlicher Ansichten fortzusetzen und sich auf Gemeinsamkeiten zu konzentrieren – all das ist besonders wichtig, damit der andere nicht in seiner isolierenden Filterblase verloren geht.“
Dazu gibt das Buch eine ganze Reihe von Ratschlägen, in denen es aber zentral eben auch darum geht, dass sich die Familienangehörigen auch ihrer eigenen Bedürfnisse bewusst werden. Denn nur so können sie sich schützen und deutlich machen, dass ihnen am Anderen etwas liegt. Dass das schwer genug ist, ist den Autorinnen nur zu bewusst. Aber es gibt für Menschen, die in radikalen Filterblasen gelandet sind, kein Patentrezept, wie man sie wieder da rausholt.
„Vielleicht empfinden Sie an dieser Stelle einen gewissen Widerstand, weil sie sich klare Argumente oder Strategien gewünscht haben, um dem anderen zu zeigen, wie stark er sich verlaufen hat“, schreiben Pohl und Wiedemann. „Oder Sie wünschen sich effektive Strategien, um ihn oder sie durch die Hintertür zu überzeugen. Glauben Sie uns, das funktioniert nicht!“
Das klingt hart. Aber die Sache ist nicht wirklich aussichtslos. Sie funktioniert nur eben nicht auf der logischen, argumentativen Basis, sondern auf jener der Emotionen. „Denn Meinungen und Überzeugungen entstehen dort, wo unsere Gefühle zu Hause sind. Deshalb ist es entscheidend, die Sprache der Gefühle zu beherrschen, wenn Sie Menschen von einer anderen Meinung überzeugen möchten.“
Was gibt dem Leben Sinn?
Es hilft alles nichts. Man muss zuhören, zu verstehen versuchen, die eigenen Gefühle ansprechen. Denn alle Fallbeispiele zeigen ja, wie sehr hinter der Radikalisierung oft die Sehnsucht nach Akzeptanz, Bestätigung, Gehörtwerden steckt. Eine riesengroße Sehnsucht in einer Gesellschaft, in der Menschen zunehmend vereinsamen und oft nicht wissen, wie sie ihre auf einmal leeren Tage im Alter mit Sinn erfüllen können.
Oft wissen sie nicht einmal, was sie mit ihrem Leben noch anfangen können, wenn die Kinder aus dem Haus sind, kein Berufsalltag mehr Struktur verschafft. Kinder und Kollegen geben dem Alltag Struktur. Das unterschätzen viele. Und bereiten sich nicht wirklich auf eine Zeit vor, in der sie ihr eigenes Dasein auf einmal als sinnlos ansehen, ganze Tage zum Grübeln haben und ihre Bestätigung dann in den „Social Media“ suchen, ohne die Funktionsweise der Algorithmen zu verstehen, auch nur zu ahnen, wie „Kommunikation“ dort tatsächlich funktioniert.
Da aber viel zu lange immer nur die Radikalisierung der jungen Menschen im Fokus der Beratungsangebote stand, ist so manches über die Radikalisierung im Alter noch nicht wirklich erforscht. Bis hin zum Phänomen der Gewaltbereitschaft, mit der inzwischen auch Gruppierungen älterer Leute für Schlagzeilen gesorgt haben – man denke nur an die Verschwörergruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß oder an die Reichsbürgerszene überhaupt, deren Akteure ebenfalls aggressiv auftreten und gleich alle staatliche Institutionen delegitimieren.
Simple Erklärungen für eine Welt voller Widersprüche
Das heißt: Auch die Vorstellung, alte Menschen neigten von Natur aus zu Weisheit und Gewaltlosigkeit, stimmt so nicht mehr. Hier muss noch viel geforscht werden, um das Phänomen zu verstehen. Genauso, wie die Rolle der a-sozialen Medien bei der Radikalisierung der gesamten Gesellschaft erst in Ansätzen untersucht ist. Immer geht es um Gefühle, es geht um Weltbilder und auch Gefühle der Ohnmacht und der Bestätigung.
Aber damit gehen die betroffene Senioren eben eher selten in die Beratungsstellen, weil die Filterblase für sie auch ein Ort der Akzeptanz und der Ordnung ist. Eine meist simple und nicht überfordernde Erklärung für die Widersprüche der Welt, so abstrus diese Erklärungen für Außenstehende in der Regel wirken.
Es sind die Angehörigen, die unter diesem Abdriften leiden. Die die Brücke der Verständigung einbrechen sehen und befürchten müssen, einen geliebten Menschen an Verschwörungserzählungen aller Art zu verlieren. Die ja nicht harmlos sind. Das schwingt auch in diesem Buch immer mit. Denn fast alle diese Filterblasen sind darauf angelegt, unseren gesellschaftlichen Konsens zu zerstören.
Aber das ist ein anderes Thema, das natürlich in Beratungsstellen nicht gelöst werden kann. Diese können nur – mit stetig wachsendem Wissen – Hilfsangebote schaffen, damit Familienangehörige nicht an ihren radikalisierten Eltern und Großeltern zerbrechen, sondern Wege finden, das Gespräch aufrechtz erhalten und geliebte Menschen nicht wirklich an die Welt der Filterblasen zu verlieren.
Sarah Pohl, Mirijam Wiedemann „Abgetaucht, radikalisiert, verloren?“, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2025, 25 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
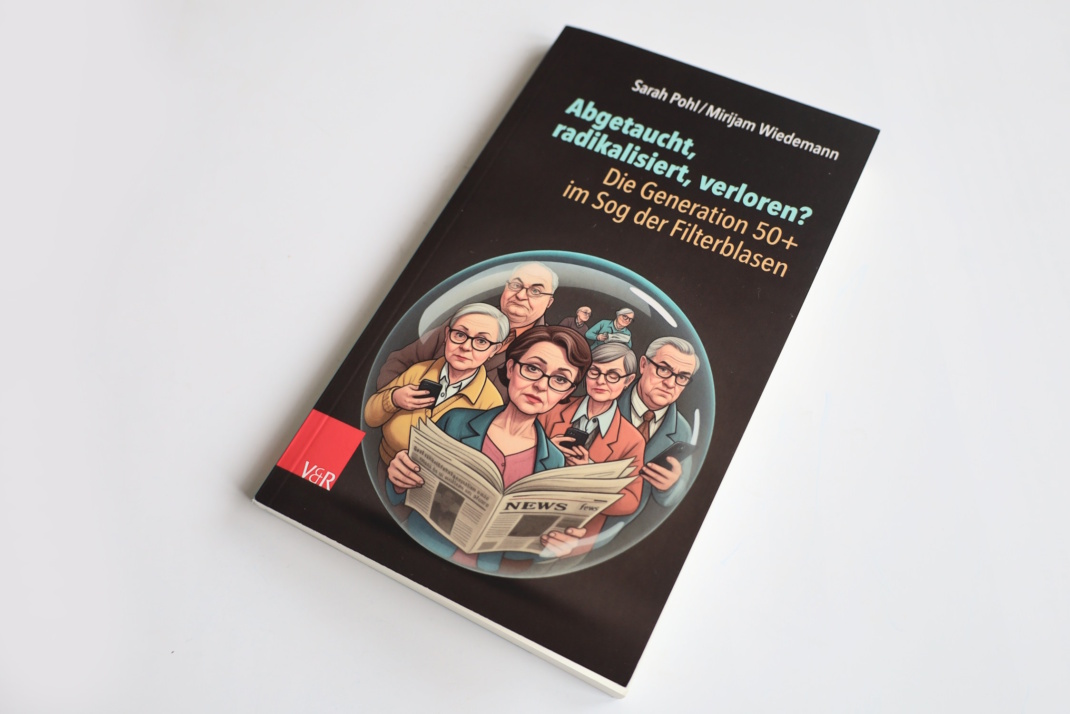






















Keine Kommentare bisher