Von 2020 bis 2024 war Dmytro Kuleba Außenminister der Ukraine und damit eines der bekanntesten Gesichter dieses Landes, das seit dem Februar 2022 um seine Freiheit kämpft. Und das vor allem seitdem durchhält und zeigt, dass man einem scheinbar übermächtigen Gegner standhalten kann, wenn man nur gewillt ist, für seine Unabhängigkeit zu kämpfen. Unterstützt von vielen Ländern des Westens, zu dem die Ukraine gehören will. Aber wie sehen die Leute im Westen (Osten und Süden) eigentlich die Ukraine? Das wollte Dmytro Kuleba unbedingt wissen.
„Die Idee zu diesem Buch entstand aus der Erkenntnis, dass Russlands Aggression gegen die Ukraine die Welt, in der wir leben, grundlegend verändern wird“, schreibt Kuleba in seinem Vorwort, mit dem er ausspricht, was bei vielen Politikern des Westens noch nicht als Botschaft angekommen ist.
Was Putin mit seinem Überfall auf die Ukraine angezettelt hat, verändert das ganze Weltgefüge – und natürlich auch die Sicht auf das Putinsche Russland, das bis heute nicht geschafft hat, aus seinem imperialen und kolonialen Denken auszusteigen. Und ebenso nicht aus seinen Träumen, im multipolaren Spiel der Kräfte weiterhin die Rolle einer Großmacht spielen zu können.
Denn der auch im Westen von vielen geteilte Glaube, dass Russland die zweitstärkste Armee der Welt hat, wurde durch diesen Krieg massiv erschüttert. Stattdessen stieg die Ukraine mittlerweile zu einer der modernsten Militärmächte der Welt auf. Und zwar nicht durch Zufall, wie einige der Beitragsautoren in diesem Band zu erzählen wissen, die sich professioneller und ernsthafter mit der ukrainischen Geschichte, dem Militär und den tatsächlichen Unterstützungen des Westens beschäftigt haben.
Manche sehr kritisch, wie der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson, der Sätze schreibt wie: „Wir haben nichts getan, um unsere Versprechen in die Tat umzusetzen. Wir haben nichts getan, um die Ukraine zu schützen.“
Putins Ziel ist nicht nur die Ukraine
Denn was Putin vorhatte, lag für die Weltöffentlichkeit seit 2014, seit dem Einrücken der „Grünen Männchen“ auf der Krim und in der Ostukraine – auf dem Tisch. Alle haben es gesehen. Und für NATO und EU hätte schon damals klar sein müssen, dass sich der Herrscher im Kreml damit nicht zufriedengeben würde. Dass man also alles hätte tun müssen, um die Ukraine militärisch zu stärken. Den Autokraten respektieren nur eins: (militärische) Stärke.
In gewisser Weise ist die Unterstützung sogar passiert. Auch das vergisst man oft. Aber es war zu wenig, wie Johnson richtig feststellt. Viel zu wenig. Auch und gerade im Interesse der Europäer. Denn Putin bedroht nicht nur die Ukraine. Länder wie Polen wissen ganz genau, dass Putin, sollte ihm eine Besetzung der Ukraine gelingen, damit nicht haltmachen würde.
Wer die massiven Desinformationskampagnen des Kremls auch nur wahrzunehmen geruht, weiß, dass sein Ziel die Schwächung und letztlich Zerschlagung von NATO und EU ist, genau jener Bündnisse, die Russland und seinen Satellitenstaaten zeigen, dass eine andere, demokratische und freiheitliche Welt möglich sind. Und es sind nicht nur die Europäer, die auf diesen Krieg schauen und sich entscheiden müssen, ob sie sich endlich zusammentun und gemeinsam Stärke zeigen.
Kuleba hat ganz bewusst namhafte Persönlichkeiten aus der ganzen Welt um einen Beitrag gebeten. Und so kommt auch Tsakhia Elbegdorij, der ehemalige Präsident der Mongolei, zu Wort. „Die Frontlinie dieses Krieges verläuft weit über die verwüsteten Schlachtfelder der Ukraine hinaus“, schreibt er. „Sie verläuft durch Asien, Afrika, Lateinamerika und den Nahen Osten. Der Krieg tobt zwischen den besten und den schlimmsten Instinkten der Menschheit. Zwischen der freien Welt und den Unterdrückten. Es ist ein allumfassender Krieg zwischen Autokratie und Demokratie.“
Der falsche Glanz der Autokraten
Und Elbegdorij erwähnt etwas, was in der westlichen Berichterstattung fast untergeht: Dass unter Putins „Teilmobilisierung“ vor allem die Schwächsten, die ethnischen Minderheiten in Russland leiden – Burjaten, Kalmücken, Tuwiner werden als „Kanonenfutter“ verheizt. In den Gemeinden der ethnischen Minderheiten findet man kaum noch Männer im militärischen Alter. Aus Elbegdorijs Sicht eine „ethnische Säuberung wie aus dem Lehrbuch“.
Und wie ein Europa aussehen würde, wenn sich der Kreml mit seinem Krieg und seiner Propaganda durchgesetzt hätte, beschreibt die US-amerikanische Historikerin Anne Applebaum in ihrem Beitrag. Die ganzen prorussischen Parteien, die mit Schützenhilfe aus Moskau in europäischen Wahlen Punkte sammeln, sind nur ein Teil des Problems. „Die Befürworter der Autokratie würden lautstark ihren Sieg verkünden. Die Putin’sche Autokratie würde mächtiger und überzeugender erscheinen als die transatlantische Demokratie.“
Obwohl sämtliche ökonomischen und militärischen Zahlen zeigen, dass selbst das so zerstrittene Westeuropa um ein Vielfaches stärker und schlagkräftiger ist als das längst zur Regionalmacht gewordene Russland, dem etliche Kommentatoren noch immer die militärische Macht der Sowjetunion zuschreiben, mit der das viel kleinere Russland aber nichts mehr zu tun hat.
Denn die eigentliche Waffenschmiede der UdSSR war immer die Ukraine. Und aus diesem Reservoir schöpfen die Ukrainer noch heute. Und sie haben nicht vergessen, wie brutal die Kolonialmacht Russland in ihrem Land gehaust hat. Ein Trauma, das die Ukraine mit eigentlich allen postsowjetischen Staaten teilt. Worauf zum Beispiel Borakoz Kassymbekova, eine Osteuropahistorikerin aus Kasachstan eingeht. Auch Kasachstan hat erlebt, wie brutal die russischen Besatzer in der Geschichte agierten.
Der imperialistische Schatten Russlands
Und der bulgarische Politologe Ivan Krăstev schildert eindringlich, wie sehr Russland heute immer noch im seinem 300 Jahre alte imperialen Denken feststeckt. Und wie dieses Denken das Handeln Putins gegenüber der Ukraine bestimmt.
Er zitiert dabei den Historiker Timothy Garton Ash, der dem autokratischen und nach wie vor imperialistischen Russland das europäische Friedensmodell gegenüber stellt, in dem „keine einzige Nation“ herrscht, sondern dutzende kleinerer und mittlerer Staaten gemeinsam Wege suchen, miteinander zu kooperieren. Das dauert oft lange, bis man zu Ergebnissen kommt. Die zögerliche Hilfe für die Ukraine hat genau da ihren Grund.
Aber genau dieses postimperiale Europa schafft den Rahmen für Frieden und ein freies Zusammenleben. Und in der Ukraine hat man sehr wohl begriffen, wie erstrebenswert es ist, genau diesem Pfad zu folgen. Hier hatte der Maidan von 2014 seinen Ursprung, als die Ukrainer den russlandfreundlichen Präsidenten Janukowitsch vertrieben. Genau das war der Auslöser für Putins Aggression.
Da muss auch den Bewohnern des Westens erst wieder bewusst werden, wie wertvoll die europäische Friedensordnung ist. Der französische Publizist Benard-Henri Lévy formuliert in seinem Beitrag genau deswegen seinen Dank an die Ukrainer und Ukrainerinnen, die mit ihrem tapferen Kampf den Westeuropäern zeigen, welch eine Kraft in einem Volk steckt, dss für seine Unabhängigkeit und die Demokratie kämpft. Und vor allem handelt, statt zu klagen und zu barmen.
Dieser Krieg verändert das Weltgefüge
Worauf auch Samantha Power, bis zum 20. Januar Direktorin der US-amerikanischen Entwicklungsbehörde USAID, eingeht. Genau der Behörde, die der US-Präsident Trump abschaffen will. Es klingt in einigen Beiträgen durchaus schon an, dass die Europäer nun lernen müssen, ihre Sicherheit selbst zu organisieren. Auch wenn man merkt, dass die meisten Beiträge 2023 geschrieben wurden, als der Krieg erst ein Jahr lang tobte, aber längst deutlich wurde, dass sich die Ukrainer nicht einfach ergeben würden.
Einige der Kritiken im Buch sind nicht mehr ganz aktuell. Die Europäer haben inzwischen deutlich mehr Hilfen an die Ukraine geleistet. Aber auch 2023 war schon zu ahnen, dass es auch 2030 noch eine Ukraine geben wird. Und dass das Land dann nicht nur einen Krieg überstanden haben wird, sondern auch eine neue Rolle in der Weltgemeinschaft spielen wird.
Und dass das Land dann auch in vielen Bereichen Vorreiter sein wird – etwa im Bereich der modernen Energieerzeugung, über den Power schreibt. Denn genau am 24. Februar 2022, als Putin seine Truppen einmarschieren ließ, hatte die Ukraine sowieso schon die Kappung der Leitungen ins russische Stromnetz geplant. Und mitten in den begonnenen Kampfhandlungen geschah das auch und die Ukrainer zeigten, dass sie fähig waren, ihre Energieversorgung auch im Krieg zu sichern.
Der ehemalige polnische Außenminister Zbigniew Rau und der Historiker Timothy Snyder blättern in ihren Beiträgen die durchaus facettenreiche ukrainische Geschichte auf. Rau geht dabei besonders auf die gemeinsame polnisch-ukrainische Geschichte im einstigen Königreich Polen-Litauen ein. Und berührt dabei natürlich den langen Weg beider Länder aus der russischen Vormundschaft.
Und Autoren wie der britische Jurist Philippe Sands skizzieren, wie sehr dieser Krieg wahrscheinlich das Völkerrecht verändern wird. Während der Finanzmathematiker Nassim Nicholas Taleb zeigt, warum die sogenannten Libertären des Westens den Autokraten im Kreml so toll finden, denn sie schwärmen ja im Name der Freiheit von der Zerstörung des demokratischen Systems. Taleb: „Sie erkennen nicht, dass die Zerstörung des derzeitigen Systems zur Tyrannei einlädt.“
Warum man Autokraten nicht füttern darf
Talebs Essay zeigt, warum Demokratie eine rigorose Gewaltenteilung braucht, ein System, in dem es eben gerade kein alleiniges Zentrum der Macht gibt, wo ein einzelner Mann bestimmt, wie die Welt zu funktionieren hat. Und Taleb sagt auch, warum die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss. Denn jedes Zugeständnis an Putin ermutigt diesen nur, dann einfach weiterzumachen.
Das europäische System der vielen kleinen Akteure hegt Autokraten ein. Autokraten, die ihre ganze Macht daraus gewinnen, dass das gesamte System vor ihnen kuscht – zumindest, solange sie sich als unbesiegter Macho darstellen können.
„Ein schwacher Putin ist nicht mehr Putin – so wie ein netter, taktvoller und umsichtiger Trump nicht mehr Trump wäre“, schreibt Taleb. „Damit das so weitergeht, braucht es eine Menge Idioten, die das Narrativ weiter füttern – und wenn die Idioten anfangen, an der Geschichte zu zweifeln, wird das der Anfang vom Ende sein.“ Nämlich das Ende der kleinen aufgeblasenen Männern, die so tun, als könnten sie die Welt mit einem Handstreich verändern.
Natürlich sind die Beiträge im Buch noch geprägt vom Krieg. Ein umfassendes Bild der Ukraine, wie sie im Jahr 2030 aussehen könnte, kann natürlich noch niemand zeichnen. Obwohl absehbar ist, dass die Ukraine wieder zur großen Kornkammer werden wird, die mit ihrem Getreide den Hunger in Afrika stillen kann. Und dass die Ukraine Vorbild sein wird auf vielen Gebieten der Energiegewinnung und der modernen IT, bei der westliche Länder wie Deutschland noch immer kleckern, statt zu klotzen.
Aber die 21 Beiträge im Buch zeigen eben auch, wie aufmerksam die Entwicklungen in der Ukraine auf allen Kontinenten beobachtet werden. Die von Kuleba eingeladenen Autor/-innen zeigen aus 21 verschiedenen Perspektiven, dass alles, was in der Ukraine passiert, auch jetzt schon Folgewirkungen nicht nur im Westen auslöst. Auch weil es Versäumnisse sichtbar gemacht hat und die Demokraten in allen Ländern daran erinnert, dass die Demokratie erkämpft und verteidigt werden muss gegen all jene Tyrannen und Autokraten, denen freie, selbstbestimmte Völker ein Graus sind.
Dass da auch deutsche Politiker unter dem Deckmäntelchen der „Besonnenheit“ eigentlich nur feige handelten und die Ukraine immer wieder am langen Arm hängen ließen, wird natürlich auch thematisiert. Obwohl ihnen jeder kenntnisreiche außenpolitische Berater ins Gesicht hätte sagen können, dass sich das Schicksal des freien Europas am Schicksal der Ukraine entscheidet.
Dmytro Kuleba (Hrsg.) „Ukraine 2030. Vision einer Nation“ Plassen erlag, Kulmbach 2025, 19,90 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
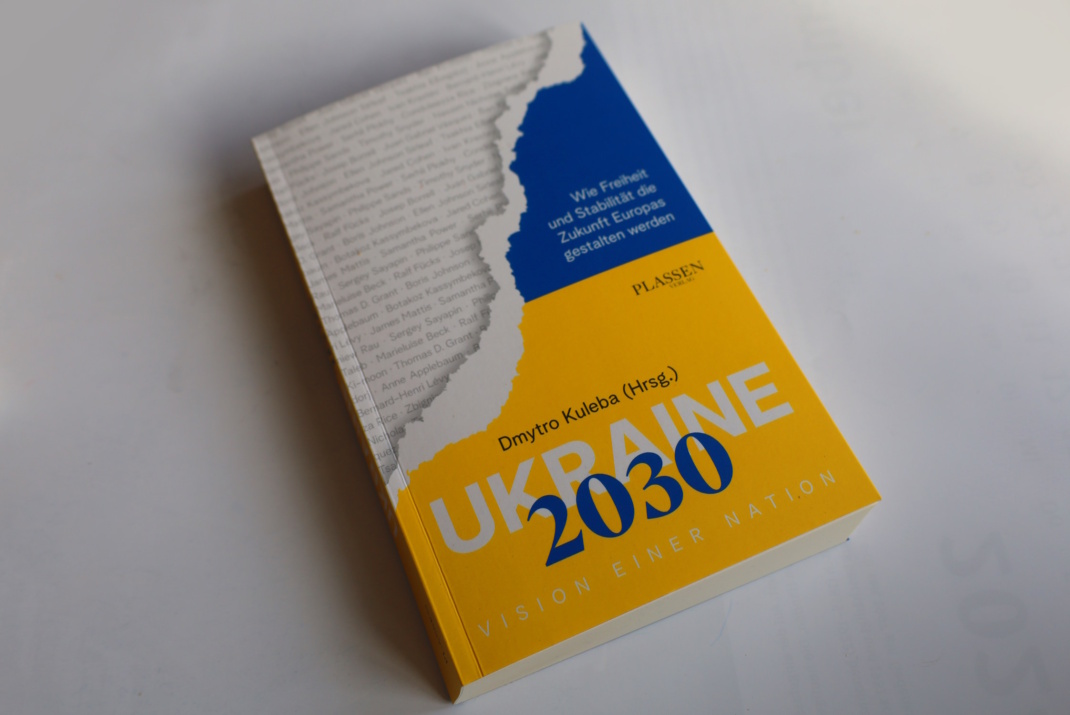
















Keine Kommentare bisher