Es ist immer das eigene Leben, aus dem auch Romanautoren ihren Stoff beziehen. Auch bei Dmitrij Kapitelman ist das so, der einen Teil seiner Jugend und seines Erwachsenenlebens in Leipzig verbrachte. Und Leipzig spielt auch eine nicht ganz unwichtige Rolle in seinem neuen Roman „Russische Spezialitäten“. Denn so heißt der Magasin, den die Eltern des Erzählers hier betreiben. Bis zur Corona-Pandemie, als sie den Laden mit nicht nur russischen Spezialitäten aufgeben müssen. Und nicht nur die Pandemie brachte ja das Leben der hier lebenden Ukrainer durcheinander.
Geboren wurde Dmitrij Kapitelmann – wie sein Erzähler – 1986 in Kyjiw, kam im Alter von acht Jahren als „jüdischer Kontingentflüchtling“ nach Deutschland, studierte an der Uni Leipzig Politikwissenschaft und Soziologie und lebt heute als Journalist und Schriftsteller in Berlin. Aber von seiner Herkunft kommt er nicht los. Da geht es ihm wie uns allen.
Nur dass die meisten von uns darüber nicht groß nachdenken. Man lebt ja meist entweder nicht wirklich weit vom eigenen Geburtsort entfernt. Oder zumindest im selben Land mit derselben Sprache. Auch wenn die Leute anderswo ein bisschen komisch sind.
Die Sprache der Kindheit
Aber wie fühlt man sich, wenn man in einem Land seine Kindheit verbrachte, in dem nun seit drei Jahren ein Krieg tobt, angezettelt vom übermächtigen Nachbarn, der das Leben in der Ukraine über Jahrzehnte geprägt hat. Ein Land, in dem bis 2022 ganz selbstverständlich das Russische genauso gesprochen wurde wie das Ukrainische. Und mit Russisch ist auch der Erzähler aufgewachsen.
Es ist die Sprache seiner Kindheit, auch wenn ihm – wenn er so die russischen Bücher im „Magasin“ betrachtet – um die Lücken in seinem russischen Wortschatz weiß. Denn längst ist er ja in der deutschen Sprache heimisch. Aber was heißt das?
Löst das die Verbindungen zur eigenen osteuropäischen Herkunft auf? Nicht wirklich. Der „Magasin“ (im Buch wirklich konsequent als der „Magasin“ bezeichnet), erzählt ja davon. Gleich den 1990er Jahren von den Eltern des Erzählers im Leipziger Westen gegründet und jahrelang florierend, weil hier all das angeboten wird, was Menschen, die aus Russland und all den anderen postsowjetischen Staaten nach Deutschland kamen, lieben und vermissen.
Wobei das frische Fleisch auch aus Polen kommen kann und die meisten Waren im Regal von Kyjiwer Märkten. Und zu all den Leckereien aus dem Osten gibt es hier auch noch richtige russische Atmosphäre mit grummeligen Kunden und einer gepflegten russischen Langsamkeit in der Bedienung. Manchmal gehört auch das dazu, um so ein wenig die Erinnerung an die Kindheit wachzuhalten.
Worüber sich der Erzähler eine Menge Gedanken macht. Mit einer riesigen Portion Ironie und doppelter Bedeutung. Er spielt nicht nur mit den schönen Wortschöpfungen der russischen Sprache, sondern auch mit der deutschen Sprache, die für viele „russische“ Sprachexperimente der ideale Knetstoff ist. Aber in diesem Buch geht die Geschichte das „Magasin“ zu Ende. Nicht nur wegen der Corona-Einschränkungen, sondern auch wegen der Krankheit des Vaters. Irgendwann können die Eltern den Laden nicht mehr am Laufen halten, auch wenn Sohnemann noch für ein paar Tage einspringt und am Ende beim Ausräumen hilft.
In der Spiegelwelt
Aber auch schon lange vor dem 24. Februar 2022 ist besonders die Mutter völlig in den russischen Fernsehkanälen angedriftet und konfrontiert den Sohn immer wieder mit all jenen Legenden, die dort in die Welt gesetzt werden. Was sich nach dem Überfall der russischen Truppen auf die Ukraine noch verstärkt und das Verhältnis von Mutter und Sohn drastisch zu zerrütten droht.
Dabei riskieren die Eltern selbst bei Anrufen bei alten Freunden in der Ukraine ein dauerhaftes Zerwürfnis. Aber es geht nicht nur ihnen so. Der „Magasin“ gab dem aufmerksamen Erzähler ja auch eine ideale Möglichkeit, in die Seelenlage der dort einkaufenden Community hineinzuhorchen, in der sich die Russen und Ukrainer mischen. Und in der die Sehnsucht zur alten Heimat auch dadurch lebendig ist, dass man nach wie vor die russischen Sender schaut und das dort Erzählte für bare Münze nimmt.
Mit alten, schon aus der Sowjetzeit bekannten Produkten wie der Drei-Schweinchen-Wurst vererben sich Erinnerung und etwas Gemeinsames, das die in Leipzig Gestrandeten verbindet. Von der gemeinsamen Sprache und einer recht rustikalen Art, miteinander umzugehen, ganz zu schweigen.
Und so fremd kommt einem das gar nicht vor. Da muss man sich gar nicht in den Ostdeutschen wiedererkennen, die im „Magasin“ palettenweise Krimsekt und russischen Kaviar kaufen. Denn so hängen ganz offensichtlich alle Menschen an den Dingen, die ihre Kindheit prägten, an Gerüchen, Namen, Stimmungen, Verhaltensweisen. So fremd ist diese sehr russische Ruppigkeit auch den Ostdeutschen nicht. Genauso wenig wie ihre Leichtgläubigkeit, wenn die „Wahrheiten“ im Fernsehen verkündet werden.
Und jetzt nach Kyjiw
Zuletzt wagt der Erzähler seine Mutter gar nicht mehr anzusprechen auf das, was da gerade in der Ukraine passiert, denn dann prallen Welten aufeinander und das Verhältnis Sohn und Mutter droht in Streit auszuarten. Aber Dim will es wissen. Und während sich seine Eltern in der Nach-Corona-Zeit irgendwie wieder eingerichtet haben (und in Kleinzschocher Leipziger Nazis ihre Zeichen hinterlassen und die Sachsen eine neue Nazi-Partei in den Landtag wählen), beschließt der Erzähler, jetzt in die Ukraine zu fahren. Vielleicht so ein bisschen, um seiner Mutter dann wirklich erzählen zu können, was dort passiert.
Aber auch, um die dort gebliebenen Freunde zu besuchen, die die Eltern bei ihren letzten Telefonaten so vor den Kopf gestoßen haben. Und schon an der Grenze erlebt Dima, wie das ist, wenn man als junger Mann nach wie vor als diensttauglich gilt und mit einem ukrainischen Pass praktisch von der Grenze weg zum Militär beordert worden wäre. Glück für ihn: Er hat die deutsche Staatsbürgerschaft. Spätestens hier merkt er, wie sich ein Land im Kriegszustand anfühlt.
Sein Handy meldet jetzt die Raketenalarme, empfiehlt den nächsten Schutzraum und gleich noch ein paar nützliche ukrainische Produkte. Aber er sieht eben auch die Zerstörungen durch die Bombenangriffe, erlebt einen auch mit anderen Kyjiwern im Bunker und fährt mit den Andrij und Wolodymyr auch nach Butscha und Borodjanki, wo zwar das Schlimmste inzwischen beräumt ist und die Menschen versuchen, wieder ein normales Leben zu führen. Aber die Zeichen der russischen Gewalt sind noch zu sehen und erschüttern den jungen Mann.
Wie sich etwas „anatmet”
Er ist aufmerksam. Er merkt, dass ihm seine Freunde oft nur Fröhlichkeit vortäuschen. Denn mit dem Schatten des Krieges leben sie trotzdem. Auch ihr Haus wurde von einer Druckwelle erwischt. Und Männer sieht man in der Straße kaum noch, dafür viele große Aufrufe, sich zum Militär zu melden. Und dass die Männer, die an der Front verletzt werden, keine Heldengeschichten erzählen, sondern – wie Wolodymyr – zutiefst schweigsam und vom Erlebten gezeichnet sind, merkt Dima auch bald.
Im Grunde ist dieser Teil des Buches etwas, was Journalisten aus Deutschland so nicht beschreiben können. Denn sie kennen die Ukraine aus friedlichen Zeiten nicht. Und können sich mit den Menschen auch nicht über die Sprache unterhalten, die Selbstverständlichkeit des Russischen und den neuen Umgang mit dem Ukrainischen. Schon gar nicht über die teilweise faszinierenden Wortfindungen im Russischen.
Denn um die Abstrusität ihres eigenen Landes in Sprache fassen zu können, schöpfen die Russen auch heute noch neue Worte. Wenn sich jemand radikalisiert, dann hat er sich etwas „angeatmet“.
„Ein kleiner, für immer mutter-sprachlich verängstigter Teil von mir freut sich darüber, auf Anhieb das richtige russische Wort für russische Radikalisierung gefunden zu haben. Sich etwas anatmen bedeutet, dumme Dinge in den Kopf zu nehmen und sich zu verändern.“
Was ja bekanntlich auch Deutschen passiert, die sich auf dubiosen Kanälen etwas „anatmen“. Und dann auf einmal fremd werden selbst für ihre Nächsten. Wobei Dima auf seiner Reise auch merkt, dass das eine Ebene der Nähe eigentlich nicht tangiert: Da, wo man sich persönlich mag, wo einen selbst Sandkastenfreundschaften für das Leben verbinden. Da werden selbst harte Worte verzeihlich. Viel wichtiger ist, dass man den Kontakt hält und einander hilft, gerade dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt.
Und die Sprache ist nicht schuld – nicht am Krieg und auch nicht an zerstörten Freundschaften. „Die russische Sprache wird den russischen Präsidenten überleben“, schreibt Kapitelman. „Wenn er schon lange in seinem hässlichen Massenmördergrab verfault. Dann könnten die russischen Wörter, die mir nicht fehlen, noch für vieles gut sein. Zumindest hoffe ich das.“
Ein Ort, der einem nie egal ist
Aber zuletzt kommt er genauso knapp wieder raus aus der Ukraine. An seinem Geburtsort Kyjiw im Pass halten sich die mit Maschinenpistolen bewaffneten Grenzer auf. Da muss er noch einmal schwitzen, bis er doch noch entlassen wird und in einem Zugabteil mit einer jungen Mutter aus dem zerstörten Mariupol Richtung Deutschland fährt, wo sein Vater „frikadellenfreudig am Küchentisch“ sitzt und seine Mutter noch immer selig die Moskauer Nachrichten schaut.
Auch hier gibt es noch einmal eine dieser vielen klugen Passagen, in denen Dimitrij Kapitelman sichtbar macht, wie Propaganda einem den Kopf verdreht, einen regelrecht einspinnt in eine Spiegelwelt, in der die Wirklichkeit auf den Kopf gestellt ist. Da sind die Russen nicht die Angreifer, sondern feiern sich als Befreier, auch wenn sie Städte wie Charkiw gnadenlos zerstören. „Diese russische Wahrheitslüge ist zu kompliziert, als dass ich sie zumindest theoretisch begreifen könnte. Doch meine Mutter bekräftigt sie in aller Schwäche.“
Ein Dilemma. Natürlich. Da helfen auch Dima nur die Erinnerungen an die Kyjiwer, die am Dnepr flanieren. „Und ein Gedanke in jenem Moment, der sich seitdem wie Wahrheit anfühlt: Heimat ist der Ort, der einem nie egal wird. Kyjiw.“
Wahrscheinlich ist es wirklich so scheinbar simpel. Aber so sind alle Orte, die unser Leben bestimmen. Sie lassen uns nicht los, auch wenn wir fast das ganze Leben schon woanders daheim sind. Und auch Dimas Eltern zeigen sich von einer anderen Seite, wenn tatsächlich vom Schicksal der Dortgebliebenen erzählt wird – etwa von Dimas Jugendfreund Rostik, dem jeden Tag die Beorderung an die Front droht. „Bljad“, sagt Dimas Vater. „Einfach so wird dieser Scheißkrieg eben nicht aufhören.“
Und auch mit seiner Mutter hat er am Ende dann doch wieder so einen Moment, in dem sie ihm vertraut ist, wenn beide nach einem wärmenden Sern am Leipziger Nachthimmel suchen. „Wie ein Stern aus Sotschi.“
Und damit trifft seine Geschichte wohl wirklich den Kern unseres Hierseins, wo wir mit lauter unsichtbaren Fäden an eine Vergangenheit gebunden sind, von der wir nicht loskommen. Die uns prägt und die auch unsere Gefühle bestimmt. Auch oder gerade dann, wenn wir – wie Dima und seine Eltern – tausende Kilometer entfernt von der Stadt leben, die uns geprägt hat.
Man nimmt sie immer mit in seiner Seele. Und das sorgt für genug Verwirrungen im Leben. Und man versteht auch besser, warum es solche Läden wie der „Magasin. Russische Spezialitäten“ geben muss, in denen Erinnerungen an ein Land wabern, das es so eigentlich schon lange nicht mehr gibt.
Dmitrij Kapitelman „Russische Spezialitäten“ Hanser Berlin, Berlin 2025, 23 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
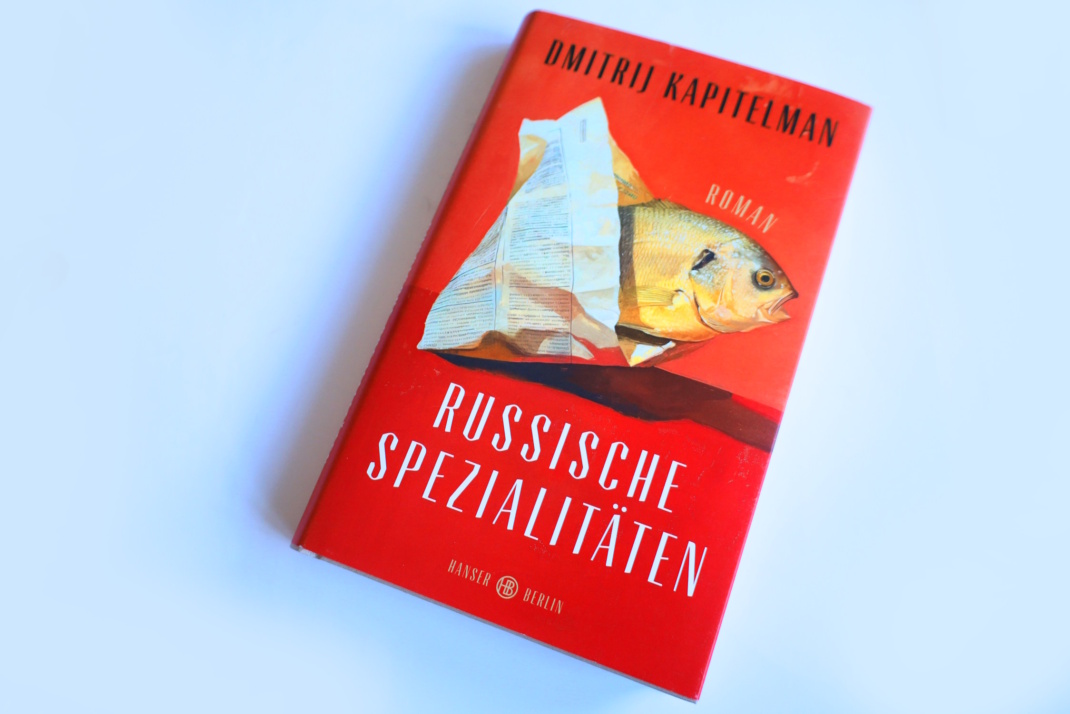























Keine Kommentare bisher