Zhuang Zhou gehört zu den bekanntesten chinesischen Philosophen. Das „Zhuangzi“ trägt seine Namen. Und hat das Denken dieses Daoisten bis heute bewahrt. Nur wenig ist über sein Leben (* um 365 v. Chr.; † 290 v. Chr.) bekannt. Der Leipziger Literaturverlag hat „Zhuangzi“ in der Übersetzung von Viktor Kalinke im Programm. Was der im Bergischen Land heimische Lehrer und Philosoph Michael Wittschier hier versucht, ist, Zung Zhou als Mensch in seinen konkreten Lebensumständen lebendig werden zu lassen.
Was nicht leicht ist. Wie lebte es sich im China vor über 2.000 Jahren? Dass er verheiratet war, ist bekannt. Und dass er ein Amt im Lackgarten innehatte, womit er sich seinen Lebensunterhalt verdiente. Doch anders als der viel berühmtere Konfuzius mied er die Nähe zu den Königen seiner Zeit, lehnte Ämter an ihrem Hofe ab. Was auch mit seinem geradezu radikalen Daoismus zu tun haben wird, dem im richtigen Maß zu leben eine hohe Kunst ist.
Andererseits: Für einen armen Menschen, der er wohl ein Leben lang auch war, ist das natürlich um so leichter. Den im Dao geht es immer um das richtige Maß, das Genug, das völlig ausreicht, das eigene Leben in Einklang zu bringen mit der umgebenden Welt. Und mit sich selbst.
Eine höchst aktuelle Geschichte, auch wenn es dem Leser nicht wirklich leicht fallen wird, die Gleichnisse und Bilder des Meisters zu verstehen. Seinen Schülern und Gesprächspartnern ging es wohl nicht anders. Denn auch im China dieser Zeit steckte das Schwarz-Weiß-Denken in den Köpfen der Menschen, das Zielstrebige, das Immerfort-Geschäftige, um Dinge zu erreichen und zu schaffen.
Verzichten und Sein-Lassen sind bis heute nicht die Dinge, nach denen Menschen streben. Im Gegenteil: Wer das von ihnen – auch nur scheinbar – verlangt, der erntet Stürme der Empörung. Und verliert Wahlen.
Ein Leben im Genug
Obwohl ein Leben im Genug, wie jeder erfährt, der es ausprobiert, glücklicher macht. Denn an die Stelle des ewigen Stroms immer neuer – unersättlicher – Wünsche tritt die Erfüllung der Gegenwart. Das würde Michael Wittschier natürlich anders ausdrücken. Eher in der Weise, wie Viktor Kalinke Zhuang Zhi übersetzt hat. Aber wie reagierten die Zeitgenossen tatsächlich auf diesen Mann? Fühlte er sich wirklich im Einklang mit seinem Leben?
Etliche seiner Sprüche erzählen davon, wie er um diesen Einklang rang. Wie er sich selbst immer wieder infrage stellte und sich als Lernender verstand – auch gegenüber den Menschen, die ihm Fragen stellten, auf die er keine Antwort wusste. Oft genug sucht er dann Bilder in der Natur, in der Selbstverständlichkeit, mit der Tiere und Pflanzen ihren Platz in der Welt einnehmen.
Theater und großes Brimborium sind ihm fremd. Nicht einmal an dem Tag, an dem seine Frau stirbt, klagt er wie alle anderen, sondern spielt Trommel und freut sich darüber, dass sie ihm schon vorausgegangen ist. Die Mächtigen reagierten erstaunlich gelassen auf diesen Burschen, der ja eine Lebenshaltung predigt, die den Mächtigen keine Macht gibt über ihn. Denn Macht bekommen sie nur, wenn sie uns bei unseren Ängsten und Wünschen und Eitelkeiten zu packen kriegen. Wer aber keine Wünsche hat, wie soll man den verführen oder bestechen? Mit was will man ihn kaufen?
Man ahnt, warum Wittschier versucht, diese Lebensgeschichte zu erzählen und gegenwärtig zu machen. Denn sie trifft einen wunden Punkt, den auch die Chinesen damals schon kannten: Wie findet der Mensch für sich das richtige Maß? Wie findet er Gleichmut, eine bis heute bewunderte Tugend? Nur, dass kaum jemand den Weg dahin weiß.
Daseinskunst
Und irgendwie scheint auch Zhuang Zi den Weg nicht wirklich zu wissen. Sondern eher zu suchen – auch im Sich-Verlieren „in der Handhabung des Dao“, so wie sich die Fische im Fluss verlieren und deshalb mit ihm eins sind. Keine leichte Kost für einen europäischen Leser, der noch viel härtnäckiger als die Schüler von Meister Zi zu fragen geneigt ist: Warum? Weshalb? Wie funktioniert das?
Wo doch zumindest zu ahnen ist, dass das etwas Erstrebenswertes sein könnte: mit sich und der Natur im Einklang zu leben und das Leben so zu nehmen, wie es ist, und nicht damit zu hadern. Und so unzufrieden zu sein damit, wie wir es heute fast alle sind, weil wir uns nicht genug beschenkt, belohnt, verwöhnt sehen. Obwohl es doch so wenig braucht, eins zu werden mit sich. Einfach indem man mit einem dieser unruhigen Freunde ziellos losgeht – „nichts zu suchen, das war mein Sinn“, um einmal Goethe zu zitieren, den Aufgeschlossensten unsere Dichter für östliche Lebenskunst. Daseinskunst. Die Fähigkeit, das eigene Leben als Teil des großen Fließens zu verstehen.
So betrachtet ist Wittschiers Erzählung ein Versuch, sich dem Denken Zhuang Zhous anzunähern, indem er dessen Gedanken mit den Fragmenten seines bekannten Lebens verflicht und ihn immer wieder Schülern und Weggenossen begegnen lässt, die ihn mit Fragen dazu bringen, immer wieder neu über das jedem gemäße Leben nachzudenken. Wie erlangt man „Einfachheit und Reinheit“? Und wann wird man – nur weil man alles besser machen will – zum Sklaven seiner Erfindungen?
Klingt sehr aktuell. Ist es wohl auch. Und Wittschiers Buch wohl ein kleiner Einstieg in die Gedankenwelt des chinesischen Philosophen, auch wenn so manche Antwort selbst verzwickt ist und zum Deuten herausfordert. Gerade uns, die wir so gern auf technische Lösungen für alles setzen und glauben, wir Menschen müssten die Natur beherrschen. Ein Gedanke, der Zhuang Zhou völlig fremd war. All sein Denken kreist – wie auch Wittschier andeutet – um ein Leben im Einklang mit der Natur.
Und damit auch mit sich selbst. Nur kommt man da ganz offensichtlich nicht mit fertigen Antworten hin, die man einfach auswendig lernt, sondern mit immer neuen Fragen. Und der Bereitschaft, sich selbst als Immer-Lernenden zu verstehen, zu schauen und auch die Fragen all derer ernst zu nehmen, die mit den einfachen Antworten des Meisters noch nicht zufrieden sind.
Zuletzt, als der greise Philosoph sein Ende nahen spürte, brach er auf ins Gebirge, um sich dort „auf den Weg ins südliche Blütenland“ zu begeben, endgültig eins zu werden mit der lebendigen Natur. Aber Wittschier ist sich sicher: „Die ‚Reise ins südliche Blütenland‘ endet nicht mit dem letzten Satz der vorliegenden Erzählung.“
Denn danach kann ja jeder selbst losgehen und sich auf die Suche machen nach dem Einklang mit sich und seiner Mitwelt.
Zhuang Zhou, Michael Wittschier, „Auf dem Weg ins südliche Blütenland“ Leipziger Literaturverlag, Leipzig 2024, 19,95 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
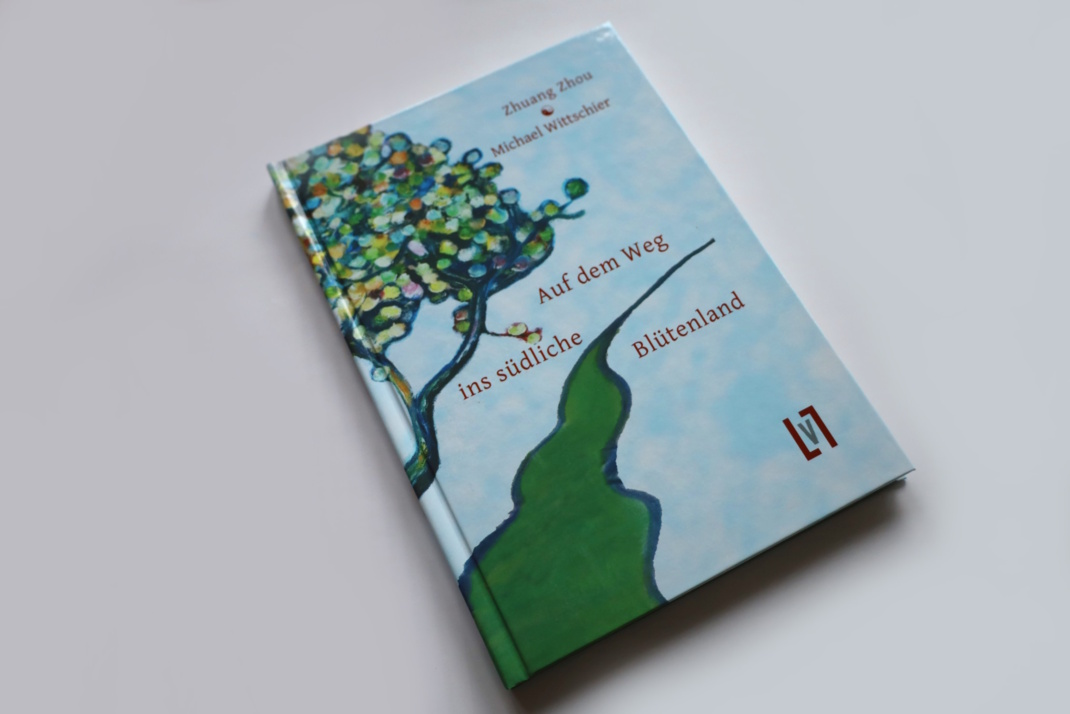













Keine Kommentare bisher