Am Ende ist es immer das eigene Leben, über das Autorinnen und Autoren erzählen. Und das ihrer Nächsten. Ihrer Väter und Mütter zum Beispiel. Denn so entstehen Schicksale und Geschichten. Und die Fragen, die uns bewegen. Was haben unsere Eltern uns mitgegeben? Bleibt überhaupt etwas? Oder kann man ihre Hinterlassenschaften einfach entsorgen? Das kann zu einer Herkulesarbeit werden, wie Marlen Hobrack nach dem frühen Tod ihrer Mutter selbst erfuhr.
In einem ihrer Bücher hatte sie sich schon einmal mit dem Leben ihrer Mutter beschäftigt. Das war in „Klassenbeste“. Der Titel spielte nicht ganz grundlos mit der Doppeldeutigkeit des Wortes Klasse. Eine Doppeldeutigkeit, die viele junge Menschen erleben, wenn sie versuchen, aus eher armen Verhältnissen irgendwie emporzukraxeln in einer Gesellschaft, in der Klassenunterschiede sich überall manifestieren. Nur merken das die Privilegierten schon lange nicht mehr. Die Betroffenen umso mehr.
Denn arme Verhältnisse prägen Denken und Verhalten schon in der Kindheit. Sie bilden Muster aus, die man im späteren Leben kaum noch loswird. Nicht nur negative. Etwa: Wer arm ist, zahlt seine Schulden. Bis zum letzten Cent. Das hat etwas mit Würde zu tun. Und im Grunde spürt Marlen Hobrack in diesem Buch auch der Würde ihrer Mutter nach. Auch wenn das erst einmal nicht so aussieht, als sie die vollgestopfte Wohnung betritt und sich daran macht, all die Dinge, die ihre Mutter in den letzten Jahren angehäuft hat, zu sortieren und zu entsorgen.
Niemandem etwas schuldig bleiben
Im Grunde schreibt sie das Buch, während sie in wochenlanger mühseliger Sortierarbeit die Wohnung ihrer Mutter nach und nach auflöst. Und es ist kein Müll, der die Wohnung verstopft. Es sind lauter Produkte, die ihre Mutter für reichlich Geld in Tele-Shopping-Kanälen bestellt hat, von vielem eine Menge, die kein normaler Mensch im Leben je aufbrauchen könnte.
Die Tochter ahnte es schon, denn sie hatte ihre Mutter schon in den Vorjahren dabei erlebt, wie sie immer wieder neue „Schnäppchen“ buchte, obwohl die früheren Bestellungen noch nicht abbezahlt waren. In Kladden und Schubladen häuften sich die offenen Rechnungen und Mahnungen. Gerichtsvollzieher waren regelmäßige Gäste.
Aber eins wird schnell klar: Die Mutter hat alle Rechnungen bezahlt, hat lieber neben ihrem Job als Justizbeamtin noch weitere Stellen als Putzfrau angenommen, um das Geld aufzubringen – und das, obwohl ihr Körper schon längst heftige Signale der Überforderung sandte. Erst die letzte, am Ende tödliche Krankheit, beendete dieses Rennen.
Und trotzdem wird das Aufräumen der Tochter nicht zu einer Abrechnung mit der Mutter. Denn sie weiß ja eigentlich, woher das alles kam. Und trotzdem bleibt die Frage, warum ihre Mutter damit nicht anders umgehen konnte und nie aufhören konnte, immer neue Produkte aus dem Tele-Shopping zu bestellen. Hat sich das vielleicht auch auf die Tochter übertragen? Sie kennt ja ähnliches von sich selbst. Es sind Zeiten des Frusts und der Überforderung, in denen die ewig strahlenden Verkäuferinnen im TV oder – heute – auf den Kanälen des Internets ihre Überredungskünste entfalten und man kauft, was auf dem Bildschirm so verführerisch aussieht. Selbst dann, wenn man das Zeug gar nicht braucht.
Horten in der Überflussgesellschaft
Auch die Mutter der Autorin brauchte es nicht. Sie stopfte all die Sendungen oft noch unausgepackt irgendwo in die Winkel der Wohnung. Schuf sich regelrecht einen Kokon aus völlig überflüssigen Produkten. Ein Kokon, der vor allem auch ein Hort war. Und vielleicht ist das Nachdenken über das Horten und das Anlegen eines Horts tatsächlich der Schlüssel zu so einem irrationalen Verhalten, das viel mehr Menschen in unserer Zeit betrifft, als man gemeinhin vermutet. Der Hort ist Schutzraum und Ersatz. Selbst wenn alles darin völlig nutzlos ist.
Und Marlen Hobrack hat sich auch belesen zum Thema, hat all die Sendungen geschaut, die sich mit diesem Problem einer Überflussgesellschaft beschäftigen, die keine Grenze und kein richtiges Maß mehr kennt. Man darf auch diesen Subtext mitlesen, der den Kern unserer völlig entfesselten Konsumgesellschaft betrifft, in dem der Sehnsucht der einen nach dem geheimnisvollen Glanz der Produkte die Verkäufer gegenüberstehen, die mittlerweile rund um die Uhr nichts anderes mehr machen, als in uns Konsumenten immer neue Wünsche nach immer mehr völlig nutzlosen Produkten auszulösen. Besonders bei denen, die abends einsam zu Hause sitzen und für die der bunte Bildschirm der einzige Kontakt nach draußen ist.
Das weiß eigentlich jeder, der seine monatlichen Einkäufe im Griff hat: Es gibt ein sauberes Maß dafür, was man tatsächlich braucht. Und wo das Verschwenden anfängt, das Hamstern von Produkten, die man ziemlich bald als lästigen Müll in der Wohnung herumliegen hat oder mit sauschlechtem Gewissen in der Tonne entsorgt, weil man genau weiß, wie belastend diese Maßlosigkeit für unsere Umwelt. Aber wer zügelt uns?
Was fehlt uns wirklich?
Oder – das ist ja die eigentliche Frage, die Marlen Hobrack beim Ausräumen der Wohnung beschäftigt: Was fehlt uns eigentlich, dass wir so leicht verführbar sind für all diese falschen Wünsche und das Anhäufen von Zeug, mit dem wir vielleicht noch glauben, damit unseren Status in einer von Neid erfüllten Gesellschaft zu markieren. Obwohl schon der Blick in die mit Schnickschnack gefüllten Vitrinen zeigt, dass nichts davon wirklich Stil hat oder davon zeugt, dass wir tatsächlich eine höhere Stufe auf der gesellschaftlichen Leute erklommen haben. Nun wirklich zu den „feinen Leuten“ gehören. Das teuer Angeschaffte wirkt billig.
Dass da eine Mangelgesellschaft wie die DDR, wo man tatsächlich kaufen musste, wenn es bestimmte Waren tatsächlich einmal gab, auch kontraproduktiv sein konnte, gehört bestimmt dazu. Ein Land, in dem man nicht einfach fröhlich drauflos bestellen konnte, verschonte einen vor der Überschuldung. Und es geht vielen so – die Schuldnerberatungen können ein Lied davon singen: Sie überschulden sich, weil sie einfach nicht wissen, wo die Grenze ist, wie man Maß hält und vor allem nur das kauft und auf Raten bezahlt, was man tatsächlich bracht.
Aber was braucht man tatsächlich? Was fehlt einem am Ende, wenn man in der verlassenen Wohnung der Mutter steht und eigentlich schon weiß, was man finden wird. „Dieses Buch ist eine glatte Lüge“, schreibt Marlen Hobrack am Ende. „Es ist Selbstbetrug, glaubte ich doch, es gehe in diesem Buch wesentlich um meine Mutter und ihre Dinge. Doch wenn überhaupt, so behandelt und verhandelt dieses Buch eine Beziehung. Zwischen einer Tochter und einer Mutter, zwischen zwei Menschen, denen es nicht gelingt, sich voneinander zu lösen.“
Die Kindheit der Mutter
Und auf einmal dürften sich auch viele Andere in dieser Beziehung wiederfinden, in diesem Gefühl, dass am Ende eben nicht alles gesagt und abgegolten ist. Gern auch gekoppelt mit dem Schuldgefühl, das Kinder oft mit sich herumschleppen: Die Liebe der Mutter nie genug erwider zu haben, ihr nicht all das zurückgegeben zu haben, was sie ihr Leben lang gegeben hat. Wir leben in Abhängigkeiten, die wir oft selbst gar nicht begriffen haben. Und in Rollen, derer wir uns oft gar nicht bewusst sind.
Auch Rollen der Überlegenheit, weil uns die Verhaltensweisen der Eltern unverständlich sind oder auch lästig. Denn natürlich wollen und müssen Kinder irgendwann selbstständig werden, selbst zu Eltern werden, die sich an ihre Kinder verschenken. Und zwar ohne zu erwarten, dass diese Liebe „abgegolten“ wird. Denn Liebe ist ja kein Tauschgeschäft.
Und manchmal ist Liebe auch eine nie wirklich eingestandene Bedürftigkeit. Man erfährt ja ganz und gar nicht beiläufig, dass die Mutter selbst eine ganz und gar lieblose Kindheit erlebt hat. Was wieder mit ihrer Mutter zu tun hat – aber auch dem abwesenden Vater. Immerhin wuchs sie in so einer typischen Nachkriegsfamilie auf. Mit „harter Hand erzogen“, wie das schön heißt. Und eben in Armut. Der man eben auch dann nicht entkommt, wenn man es dann irgendwann schafft, eine gut bezahlte Anstellung zu finden. Also endlich genug Geld hat, um nicht mehr mit dem letzten Pfennig bis zum Monatsersten planen zu müssen. Es ist ein völlig anderer Lebenszustand.
Aber trotzdem muss Marlen Hobrack am Ende eingestehen, dass sie ihre Mutter durch das mühsame Auflösen ihres Haushalts dennoch nicht entschlüsseln kann. Obwohl sie ihr an manchen Tagen durchaus nahe gewesen sein dürfte, ein wenig von dem verstanden haben dürfte, was das Leben ihrer Mutter am Ende auch derart einsam machte und zu einem einzigen Versuch, der Fluten von Bestellungen, Rechnungen und Mahnungen irgendwie durch noch mehr Arbeit mit einem eh schon geschundenen Körper Herr zu werden.
Wieder Ordnung schaffen
Manchmal findet die Autorin dadurch auch Zugang zu eigenen Verhaltensweisen, die dadurch etwas besser verständlich werden. Manchmal reicht das auch schon. Aber nicht alles lässt sich enträtseln. Der Hort, den die Mutter über die Jahre geschaffen hat, erzählt nicht alles über sie – auch nicht über ihre Bedürfnisse und Wünsche. Die Interpretation bleibt Interpretation. Und am Ende steht auch für Marlen Hobrack die Erkenntnis, dass das ganze Ausräumen und Entsorgen vor allem ihr selbst geholfen hat, wieder Ordnung im eigenen Gefühlsleben zu schaffen.
Das Leben der Mutter selbst lässt sich im Nachhinein nicht aufräumen. Ein bisschen besser verstehen vielleicht. Auch in den Dingen, in denen ein Gespräch niemals möglich war. Liebe und Missverständnis gehen in eins. Und trotzdem dürfte das Vielen sehr vertraut sein, die sich so mit dem Nachlass ihrer Eltern beschäftigen mussten.
Und darin vielleicht Antworten suchten, die es vorher im persönlichen Miteinander nie gab. Nie geben konnte, weil die Dinge, die wir um uns anhäufen, eben oft auch von etwas erzählen, was wir selbst nie benennen könnten. Manchmal aus ganz existenziellen Gründen.
So gesehen ein mutiges Buch. Eines, das versucht, die Kontrolle zu gewinnen über eine Beziehung, übe die wir Kinder nie die Kontrolle hatten. Auch das lernt man dabei, während man Marlen Hobrack regelrecht zuschaut, wie sie Müllsack um Müllsack stopft und die nützlichen Dinge alle in Kisten packt, die sie unten vor die Haustür stellt. Denn wirklich nutzlos war das alles ja nicht.
Nur viel zu viel für einen einzelnen Menschen, der seine Abende auf der Couch vom Fernseher verbrachte, wo einem immer fröhliche Menschen lauter Zauberdinge verkaufen, die das Leben in ein Wunder verwandeln sollen. Ein Leben, wie man es sich immer gewünscht hat.
Die Zauberdinge müssen dann die Kinder beräumen, die sich oft berechtigt fragen: Wer waren eigentlich diese Menschen, die meine Eltern waren?
Marlen Hobrack „Erbgut. Was von meiner Mutter bleibt“, HarperCollins, Hamburg 2024, 24 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
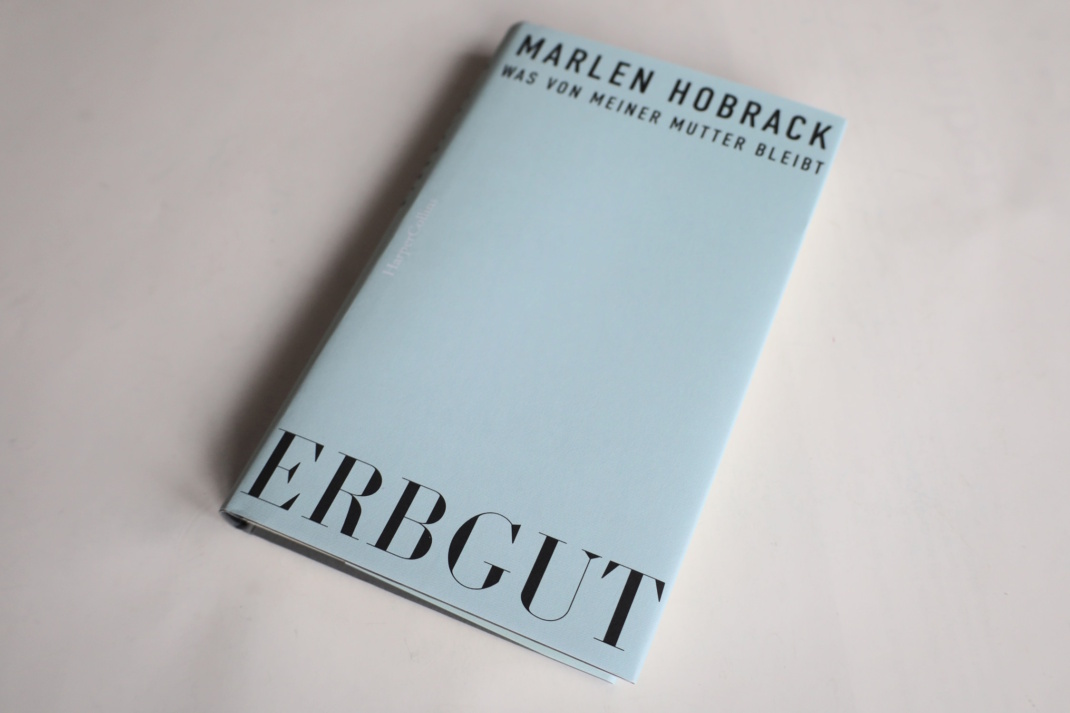














Keine Kommentare bisher