Vom 4. September bis zum 27. Oktober sind in der Galerie Pankow in Berlin Fotografien von Roger Melis (1940–2009) zu sehen, die ein Stück DDR zeigen, das inzwischen geradezu Legende ist: die Künstlerwelt vom Prenzlauer Berg. Roger Melis hat sie noch 1988/1989 fotografiert. Am 5. Oktober 1989 wurde in der Galerie „M“ in Marzahn eine Ausstellung mit Fotografien aus dieser Serie eröffnet. Kurz bevor mit dem Ende der DDR auch das Biotop Prenzlauer Berg Geschichte wurde.
Welche Bilder damals in dieser Ausstellung zu sehen waren, konnte nur bedingt rekonstruiert werden. Aber Adressliste und Fotografien von einem gemeinsamen Format gaben Herausgeber Mathias Bertram Hinweise darauf, welche Fotografien damals wohl gezeigt wurden.
Dass der 2009 verstorbene Roger Melis sich schon weit vor dieser Ausstellung einen Namen gemacht hatte mit dem Fotografieren von Schriftstellen, Malern, Lyrikerinnen, Dramatikern – das war bekannt. Etliche dieser Fotografien sind längst zu Ikonen geworden und prägen unser Bild von den Abgelichteten. Viele dieser Aufnahmen sind in dem 2008 bei Lehmstedt erschienenen Band „Künstlerporträts“ versammelt.
Aber die Bilder der Ausstellung von 1989 sind etwas Besonderes. Das wird auch dem heutigen Leser deutlich, wenn er einen der beiden Einleitungstexte, nämlich den von Uwe Kolbe, liest, der damals eine der bekanntesten Gestalten der Prenzlauer Berg-Szene war. Einer Szene, die auch damals schon von Mythen umrankt war, denn in dieser Dichte war das Phänomen Prenzlauer Berg DDR-weit einzigartig. Hier sammelte sich – in jahrzehntelang verwahrlosten Quartieren, ein buntes, kreatives Völkchen, das jenseits der offiziellen Schablonen versuchte, Kunst und Literatur zu machen. Und dabei auch Aufmüpfiges produzierte.
Ein Stück Utopie
Aber das war gar nicht der Kern dessen, was diese meist jungen Leute hier zusammenführte. Auch wenn die Szene emsigst von fantasielosen MfS-Beobachtern observiert wurde. Denn subversiv war in der DDR alles, was von der offiziellen Parteilinie abwich. Alles sollte geregelt und verwaltet sein. Aber dann bleibt nun einmal kein Platz mehr für wirklich eigensinnige Kunst, für Unabhängigkeit und Kreativität. Und so entstanden auch in anderen Städten der DDR solche kreativen Milieus, in denen sich alle irgendwie kannten, in denen man einander half und gemeinsam feierte.
Uwe Kolbe erzählt sehr atmosphärisch von diesem ganz besonderen Milieu im Prenzlauer Berg und von den Schicksalen einiger der Porträtierten. Und er versucht auch die schon früh geprägte Formel vom Berliner Montmartre zu entkräften. Denn sie trifft den Kern dieses besonderen Ortes nicht, der eben auch gerade wegen der desolaten Bausubstanz (in den Planungsbüros wurde ja längst auch der Abriss des Prenzlauer Bergs geplant) ein Raum war, an dem alternative Lebensentwürfe lebbar waren.
Zu denen die Eckkneipen genauso gehörten wie die halb inoffiziellen Theaterprojekte und die Mitarbeit an Samisdat-Zeitschriften, die heute ihrerseits Legende sind.
So betrachtet bildete der Prenzlauer Berg vor 1989 dennoch ein Stück Utopie in der durch und durch reglementierten DDR, einen Ort, an dem eben auch geträumt werden durfte und geträumt wurde. Von den Uffizien oder von einem Café in Paris. Und es sind nun einmal Künstlerinnen und Künstler, die diese Träume am Leben erhalten. Eine „Situation des Exils“ nennt es Kolbe, der 1986 mit „Bornholm II“ ja einen dieser Gedichtbände veröffentlichte, der diese Sehnsucht nach Weite im kleinen zugemauerten Land thematisierte.
Und da tut es eben gut, wenn man Leute kennt, mit denen man über seine Träume und Sehnsüchte reden kann, dass man einfach losgehen kann, um bei den Anderen vor der Tür zu stehen. Denn Telefon hatte ja fast keiner. Kurzfristig anmelden konnte man sich nicht. Also besuchte man einander auf gut Glück. Und weil das allen so ging, entstanden so viel dichtere Geflechte als sie heute möglich sind, gab es viel mehr intensive Begegnungen, die natürlich zur Legendenbildung beitrugen.
Auch der Schmerz …
„Apropos Freundschaft“, schreibt Kolbe, „Es gab sonst keinen Begriff zur Beschreibung des Umgangs miteinander. Dem gegenüber standen die Anderen, die Seite des Staats, die Welt der Funktionäre, gleich welcher Ebene.“
So entstand erst der Raum für Vielfalt. Aber auch für Trauer, wie Kolbe jetzt bei Wiederbetrachten der Fotografien feststellt: „Vor der begrenzten Auswahl dieser Werkgruppe des Fotografen das Gefühl, es ist alles wieder da. In Gesichter zu schauen, und alles ist wieder da. Auch der Schmerz.“
Denn auch der Prenzlauer Berg war kein heiler Ort. Längst war der Exodus aus der DDR eingeleitet. Es gingen Berühmte. Und es gingen viele, die in diesem Land nie zu Ruhm kommen konnten. Das hatte doppelte Konsequenzen, wie Kolbe feststellt: „Weggegangen hieß im offiziellen Ausstellungsbetrieb wie auch im Verlagswesen sonst sofort, dass es diesen oder jene nie gegeben hatte.“
Man lebte mit den Abschieden. Und dem Fremdsein im eigenen Land. „In Gesichter zu schauen, in deren Sehnsucht sich die eigene spiegelt, in ihrer Fremdheit die eigene Fremdheit. Die persönlichen Geschichten und die Kunstgeschichte sind allemal sehr verschiedene Veranstaltungen.“
Und es ist immer diese persönliche Geschichte, die Roger Melis suchte, wenn er die Menschen porträtierte, die in seinem Kiez lebten. Die er oft persönlich kannte oder durch Empfehlungen kennenlernte. Wie er das machte, das versucht der Kunsthistoriker Eugen Blume in seinem Text „Offenheit im Geschlossenen“ zu erfassen. Denn wer die Fotos anschaut, sieht, dass Melis hier etwas umgesetzt hat, was heute kaum noch möglich ist in einer Zeit, in der alle gelernt haben, die Maske aufzusetzen, und niemand sich mehr verletzlich zeigen möchte.
Sodass wir in Fluten banaler Bilder leben und aufmerken, wenn wir in diese Gesichter einer vergangenen Zeit schauen – und dabei einem Ernst begegnen, der nur sichtbar wird, wenn der Fotograf die Fotografierten auch ernst nimmt. So ernst, dass er sich alle Mühe gibt, sie aus Posen und Selbstdarstellungen herauszuholen.
Es geht immer ums Leben
Was dabei sichtbar wird, ist, dass es im Leben und im Kunstmachen immer um etwas geht. Etwas Wesentliches, das nun einmal erst sichtbar wird, wenn die Porträtierten nicht mehr versuchen, ein erwartbares Bild von sich zu geben. Blume schreibt von der „inzwischen allgegenwärtigen Propaganda des Falschen, des Künstlichen und Unechten“, das heute auch die Welt der Künstler bestimmt.
Denn wo alles Ware ist, wird auch das Persönlichste zur Ware. Da zeigt man sich nicht mehr verletzlich. Im Gegenteil: Wer sich verletzlich zeigt, erntet Hohn und Häme.
Und so werden diese Fotos von den Künstlerinnen und Künstlern des Prenzlauer Bergs selbst zu einer Utopie in Schwarz/Weiß – die Erinnerung an eine menschliche Ernsthaftigkeit, die man heute mit der Lupe suchen muss. Eine Ernsthaftigkeit, die immer auch zu den Triebkräften gehörte, die gegen die Erstarrung der DDR-Gesellschaft rebellierten. Und das bedeutet natürlich Tragik bis heute.
Denn dieser Anspruch an das Menschliche wurde nicht eingelöst. Darüber wollten die vom glitzernden Konsum Berauschten 1990 nichts (mehr) wissen. Oder kannten es auch vorher nicht. Denn das gehört natürlich auch dazu: Dass der Ruhm des Prenzlauer Bergs auch damals nur eine kleine, überschaubare Welt derjenigen erreichte, die sich dem gleichmachenden Staat nicht fügen wollten.
Einem Staat, der – so Blume – „eine subversive Kultur als Überlebensmittel“ hervorbrachte, „dessen couragiertes Personal bis heute unverdientermaßen weitgehend unbekannt geblieben ist“.
Die Unangepassten vom Prenzlauer Berg
Uwe Kolbe stellt dieses „Personal“ in seinem sehr nachdenklichen Text teilweise vor – natürlich aus seiner Perspektive. Es sind die Menschen, die für ihn die lebendige Welt bedeuteten, als er im Prenzlauer Berg lebte. Manche der Porträtierten kennt man tatsächlich – gerade was die Autorinnen und Autoren betrifft, wie Elke Erb, Peter Brasch oder Bert Papenfuß-Gorek. Aber Melis hat auch Grafikerinnen, Bildhauer und Maler abgelichtet – unter ihnen auch eine Legende wie Jürgen Böttcher, der sich als Künstler Strawalde nannte.
Und es stimmt ja: Auch nach der „Wende“ gehörte diesen so unzeitgemäßen Künstlern nicht die große Bühne. Da gibt es etwas nachzuholen, auch wiederzuentdecken. Und dazu regt dieser Band natürlich an, der jetzt erstmals in dieser Form den Unangepassten aus dem Prenzlauer Berg ein Gesicht gibt.
Und sie in einer Zusammenschau zeigt, die ahnen lässt, wie wichtig dieser fast utopische Ort im Herzen der DDR war. Gerade als Ort des gelebten Widerspruchs. Jedes einzelne Foto erzählt ja davon: Ein anderes Leben ist möglich, denkbar und gestaltbar.
Kunst kann sehr ernst sein, wenn sie wirklich das Eigentliche meint, was Menschen Würde und Zuversicht gibt.
Roger Melis „Die Künstler vom Prenzlauer Berg“ Lehmstedt Verlag, Leipzig 2024, 25 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
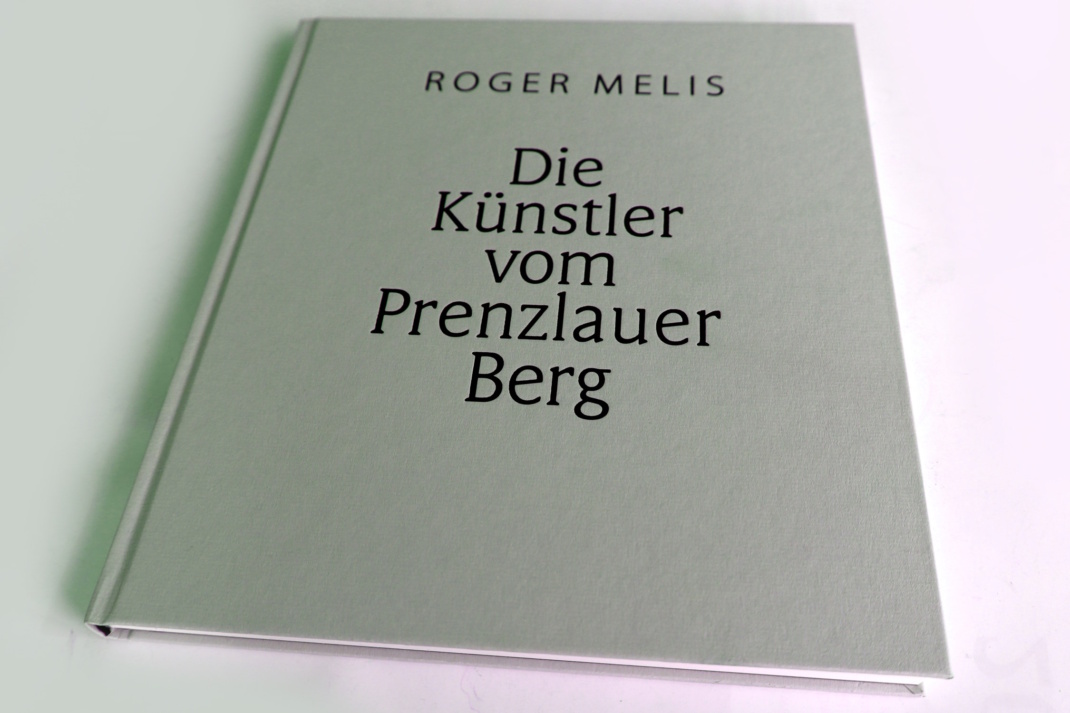





















Keine Kommentare bisher