Menschen entscheiden oft nicht rational. Sie lassen sich verführen, glauben nur zu gern falschen Versprechungen, schönen Märchen und Heilsversprechen. Und sie sind auch nur zu bereit, an die wildesten Legenden zu glauben, wenn es um Macht und Herrschaft geht. Es ist eine letztlich 10.000 Jahre alte Beziehung, die Alexander Rauch mit diesem Buch zu beleuchten versucht, auch wenn er sich vor allem auf Mythen der letzten 3.000 Jahre bezieht.
Die auch nicht alles Mythen sind. Der Begriff Mythos ist ein diffuser Begriff. Das versucht Rauch in seinem Buch auch ein wenig zu diskutieren.
Aber worum es tatsächlich geht, bringt der Wikipedia-Beitrag mit dieser Definition auf den Punkt: „Anders als verwandte Erzählformen wie Sage, Legende, Fabel oder Märchen gilt ein Mythos (sofern dieser Begriff nicht in seiner umgekehrten Bedeutung als ideologische Falle oder Lügengeschichte verwendet wird) als eine Erzählung, die Identität, übergreifende Erklärungen, Lebenssinn und religiöse Orientierung als eine weitgehend kohärente Art der Welterfahrung vermittelt.“
Es geht um Kohärenz, das Gefühl der Menschen, dass ihr Bild von der Welt mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Dass alles, was sie erleben, auch begreifbar ist und sinnvoll. Nur bringen Machtgefälle immer Dissonanzen, Konflikte und Irritationen mit sich. Das war schon immer so.
Weshalb sich Menschen schon früh Geschichten ausgedacht haben über den Ursprung vom Macht und Herrschaft. Hier haben sämtliche Götter ihren Ursprung, alle Religionen, sämtliche Rituale, mit denen Macht zelebriert wird.
Die Inszenierung von Macht
Alexander Rauchs Buch ist eine Reise in diese Welt – auch wenn die Grenzen fließend sind. Nicht jedes Ritual ist mythisch zu deuten, nicht jeder Mythos lebt ewig. Manches, was tradiert wird, ist längst seiner mythischen Deutung entledigt, während anderes die Menschen weiterhin in ihren Bann schlägt, weil es irgendein heimeliges Gefühl in ihnen wachruft. Weshalb man einen Begriff eigentlich vermisst, auch wenn er im Kapitel zum „barocken Gesamtkunstwerk“ und zum religiösen Theater anklingt: Inszenierung.
Das wird bei Rauchs schöner Analyse zu den Elementen des Sonnenkönigtums um Ludwig XIV. deutlich: Macht lebt von der Inszenierung. Sie gibt den Beherrschten ein Bild von der „Ordnung im Kosmos“. Und den Herrschenden ebenso. Die – jahrtausendelang als „gottgegeben“ verstandene – Ordnung legitimiert Macht. Und sie kaschiert die dunkle Seite der Macht: die Gewalt.
Ordnung heißt immer auch Unterordnung. Titel, Orden und Uniformen erzählen genau davon. Deswegen wurden Soldaten auch in Zeiten des Absolutismus prächtig ausstaffiert: Der Untertan wurde zum uniformierten Teil der Macht.
Man merkt auch bei Rauch: Nicht alles ist Mythos. Viele große Mythen der Macht sind längst zur Legende geworden. Was auch mit dem Niedergang der Religionen zu tun hat, die jahrhundertelang Träger mythischer Weltvorstellungen waren, Stabilisatoren irdischer Machtverhältnisse. Umstände, die dann – für Europa – die Reformation genauso infrage stellte wie etwas später die Aufklärung. Gerade letztere ganz zentral beschäftigt damit, alte Mythen zu demontieren und der Rationalität in Wissenschaft und Gesellschaft das Wort zu reden.
Populismus und Mythen
Was leider nicht das Ende mythischer Weltvorstellungen und Verführungen war. Die Verführer der Welt bewiesen ja danach, wie leicht es fällt, neue Machtverhältnisse mit neu erfundenen Mythen zu begründen, fein gemixt mit alten Vorurteilen. Denn Mythen haben einen enormen politischen Vorteil: Sie geben den Leuten eine Matrix, wie sie die Welt begreifen können. Ein simples, aber emotional aufgeladenes Bild.
Das erspart nicht nur die Mühe beim Erfassen einer hochkomplexen Wirklichkeit – es entlastet auch. Auch im Miteinander in der Gruppe. Denn Dissonanzern hält der Mensch nicht aus. Er will geliebt und akzeptiert sein. Im gemeinsamen Glauben – woran auch immer – wird man eins. Weshalb heute nicht nur Künstler (Genies) verehrt werden wie einst die Heiligen der römischen Kirche, sondern auch Politiker. Die modernen Medien machen es möglich. Populismus ist ohne moderne Mythen nicht denkbar. Er lebt geradezu davon.
Und damit gibt er den Menschen etwas, was mit dem Verschwinden der Religionen scheinbar verloren gegangen ist.
Das ist nämlich die andere Seite dessen, was Alexander Rauch erzählt: Dass Menschen verführbar sind durch Inszenierungen, dass sie „verzaubert“ werden wollen und mit der ruppigen Wirklichkeit gar nicht behelligt werden wollen. Das ist das Spielfeld für die Verführer, die Narzissten und Populisten. Und genau hier werden alte Mythen zum Instrumentarium und immer wieder revitalisiert.
Was den Blick etwas verändert: Nicht Mythen schaffen die Vorstellungen des Menschen von der Welt, sondern Menschen erschaffen Mythen, um Macht zu inszenieren. Und dabei greifen sie auf all die Requisiten zurück, die vergangene Generationen sich zurechtgebastelt haben – Kronen, Altäre, Throne, pompöse Bauten, Orden, theatrale Räume.
Inszenierung im geschlossenen Raum
Es überrascht nicht, dass auch Wagner mit seinem „Gesamtkunstwerk“ vorkommt in diesem Buch, mit seinen verdunkelten Räumen und dem versteckten Orchester. Die Inszenierung des Mythos bedingt den Ausschluss der Wirklichkeit. Er funktioniert nur im Raum seiner Inszenierung. Es gibt einige Stellen in Rauchs Reise durch die Mythen-Geschichte der Menschheit, die über den Mythos als sinnstiftende Geschichte hinausweisen und zeigen, dass Mythen vor allem Instrumente zur Inszenierung von Macht sind.
Oder mit den Worten Rauchs: „Geschichte zeigt, Mythen wurden und werden immer wieder neu gebildet, nicht selten, um Macht zu generieren, Überlegenheit und Unterdrückung zu legitimieren, Vorurteile zu festigen.“
Womit er sich selbst widerspricht, wenn er kurz zuvor schrieb, es wäre der Mythos, „der Tempel und Kathedralen gebaut hat“. Den auch seine Reise durch die Geschichte zeigt, dass es immer die Mächtigen waren, die sich Tempel und Kathedralen bauen ließen, um diese dann zu Symbolen des Mythos zu machen. Gebaut haben sie sowieso andere, wie schon Brecht feststellte: „Wer baute das siebentorige Theben?“
Die Requisitenkiste der Geschichte
Die Mächtigen spannten die armen Teufel ein, um die riesigen Symbole der Macht aus dem Boden zu stampfen. Und Rauch nennt einige Reiche, in denen so Macht demonstrativ in bombastischen Tempeln zelebriert wurde – stets in Verbindung mit einem Überlegenheits-Mythos, der die Herrschaft der gerade Mächtigen als göttlich, gottgegeben, „historisch“ bemäntelte und dabei jedes Mal tief in die Klamottenkiste der Geschichte griff.
Auch bei Wagner und den Nazis war das so, die ohne die alten germanischen Götter- und Heldensagen gar nicht auskamen. Das wetterleuchtet heute noch im Wortbombast der neuen Völkischen.
Da und dort deckt Rauch die Herkunft einiger Rituale und Symbole auf – bis hin zum wohlgenährten Bundesadler –, deren Herkunft aus alten Mythen uns gar nicht mehr bewusst ist. Als wäre es verschüttet. Was aber so ganz die Sache nicht trifft, den gerade solche Symbole zeigen, dass sie auch ohne Mythos funktionieren und Macht bedeuten.
So gesehen ist es ein Buch, das zum Nachdenken anregt. Auch über die Frage, wie leicht verführbar wir sind – nicht nur für neue Mythen, sondern auch durch die Inszenierungen von Macht, Herrschaft und Überlegenheit. Und wie schwer es dabei fällt, die von der Aufklärung postulierte rationale Ebene immer wieder zurückzugewinnen. Und sich vom Bombast einer Inszenierung nicht schon wieder ins Bockshorn jagen zu lassen.
Alexander Rauch „Mythos und Macht“ Edition Hamouda, Leipzig 2024, 20 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
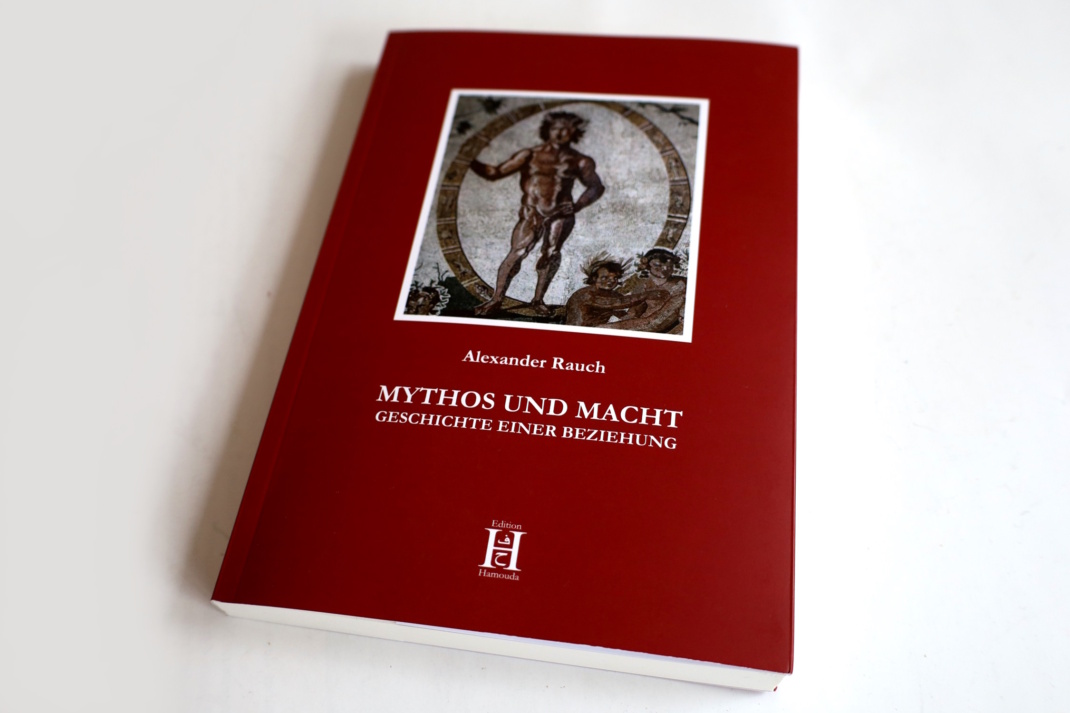
























Keine Kommentare bisher