Nein, das trägt keine kafkaesken Züge, wenn sich im deutschen Kinderfernsehen Panzer mit Marschflugkörpern unterhalten. Das hat eher etwas von poststalinistischer Rhetorik („Der Friede muss bewaffnet sein“) und hollywoodesker Comic-Verniedlichung. Eigenartig wirkt es schon, wenn „der Taurus“ kritisiert wird, dass er „nicht in die Ukraine will“.
Das finden Sie eigenartig? Nun, eigentlich ist es so was von lächerlich, wenn es nicht solch einen ernsthaften Hintergrund gäbe. Wenn die „Welt aus den Fugen“ zu geraten droht, wofür sollte dann Zeit sein, was ist zu tun, wenn (Kriegs-) Bedrohungen immer näherrücken, ein ganzes Volk „wehrtüchtig“ werden soll und es oft in der innergesellschaftlichen Kommunikation bereits zu sein scheint?
„Um sein Leben schreiben“ – so heißt das neueste Werk vom literarischen Philosophen und Bestsellerautoren Rüdiger Safranski (*1945), der die großen Intellektuellen (Goethe, Schiller, Nietzsche) porträtierte und die großen Epochen („Romantik – eine deutsche Affäre“) dokumentierte und sprachlich eindrucksvoll bebilderte.
Jetzt also Franz Kafka, der hundertjährig tote Expressionist aus Prag, jahrelang unentdeckt, verschmäht und geschmäht, der Geheimnisvolle, der Verrückte ohne feste Frau, der Einsame – versteckt unter den Menschen, der unter der autoritären Knute des allmächtigen Vaters – um sein Leben geschrieben hat.
„Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur, ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein.“ Mit dieser zitierten Tagebucheintragung Kafkas, 1913, gerichtet an die damalige Geliebte Felice Bauer, eröffnet Safranski seinen biografischen Abriss der Lebens- und Werkstationen des deutsch-tschechischen Ausnahmeschriftstellers. Diese Aussage Kafkas wirkt wie eine Autosuggestion und gleichzeitig als Abwehrhaltung gegenüber den Menschen (insbesondere weiblicher Verehrerinnen), wohl auch, um zu signalisieren: Bitte erwartet nicht zu viel von mir!
Denn das „arbeitet“ Safranski auf den 268 Seiten der gedruckten Ausgabe in seinem unverwechselbaren Stil geradezu meisterhaft „heraus“. Kafkas Schreibintention als Selbstvergewisserung und „Firewall“ gegen die Ängste des Lebens und der Zeit. Dreifach sind diese zu nennen. Die Angst vor der allzu großen Nähe in Anwesenheit von Liebe, die er mit Selbstabwertung einerseits und Gefühlserpressung zu überdecken sucht.
Eifersucht nicht als Gefühl, sondern als Abwehrmechanismus entwickelt … „Dir gefällt mein Buch ebenso wenig wie Dir damals mein Bild gefallen hat. Das wäre ja nicht so arg, denn was dort steht, sind zum größten Teil alte Sachen, aber immerhin doch noch immer ein Stück von mir und also ein Dir fremdes Stück von mir … Aber Du sagst nichts, kündigst zwar einmal an, etwas zu sagen, sagtest es aber nicht.“ Schreibt er wiederum an Felice, nachdem sie ihn nicht in gewünschter Weise geantwortet hatte.
Angst hat Kafka auch vor dem wachsenden Antisemitismus der Zeit. Schützt sich mit dem Unter- und Auftauchen in der jüdischen Gemeinde Prags, trägt dort seine Werke, seine Entwürfe und poetischen Skizzen vor. Fühlt sich dort aufgehoben, wo man ihn nicht fordert und er sich nicht überfordert fühlt. Er bei den Unterlegenen ist, die in Isolation ihre religiöse Autonomie praktizieren.
„Etwas Unverdorbenes glaubte Kafka in ihnen zu spüren. Sie hatten diese von Kafka idealisierte Gemeinsamkeit des Bodens, der Luft, des Gebots. Sie gehörten nicht nur zusammen, sondern sie verkörperten eine gemeinsame Geschichte, mit Bruchstücken der biblischen Tradition, die sie in einer Mischung aus Feierlichkeit und Klamotte in ihren Stücken vergegenwärtigten.“ (S. 38) Von dieser Natürlichkeit fühlte sich Kafka angezogen, konnte beobachten, ohne selbst gemustert und in die intellektuelle Exotenschublade gesteckt zu werden.
Somit ist Kafkas Beziehung zum Judentum nicht unbedingt ein orthodox-rituelles, sondern hat eher etwas vom Wunsch nach sozialer Integration. Der studierte und promovierte Jurist ging – wie längst bekannt – nur ungern der Alltagsbeschäftigung in der Versicherungsgesellschaft nach, erarbeitete sich dort den Freiraum für seine lebens-not-wendige Passion: das Schreiben. Dort lebte er auf, dort konnte es nicht genug einsam um ihn sein.
„Oft dachte ich schon daran, daß es die beste Lebensweise für mich wäre, mit Schreibzeug und einer Lampe im innersten Raum eines ausgedehnten abgesperrten Kellers zu sein. Das Essen brächte man mir, stellte es immer weit von meinem Raum entfernt hinter der äußersten Tür des Kellers nieder. Der Weg um das Essen, im Schlafrock, durch alle Kellergewölbe hindurch wäre mein einziger Spaziergang. Dann kehrte ich zu meinem Tisch zurück, würde langsam und mit Bedacht essen und wieder gleich zu schreiben anfangen. Was ich dann schreiben würde! Aus welchen Tiefen ich es hervorreißen würde!“ (S. 94).
Das erinnert nicht nur an eigene Erfahrungen, sondern viel mehr noch an zwei berühmte Zeitgenossen Kafkas. Nietzsche („Flamme bin ich sicherlich …“) und noch mehr an Rainer Maria Rilke, der sich aus jahrelangen, quälenden Kreativ-Blockaden nur mit radikaler Leidenschaft und Intensität des Ichs herausschreiben konnte („Denn das Wort muss Mensch werden. Das ist das Geheimnis der Welt.“). Mit Rilke verband Kafka auch die Entzauberung des vorhandenen Sprachmissbrauchs, eine Ent-Romantisierung der Welt, eine ernüchternde Poesie, die neu-poetisch zu werden versuchte. (Rilke: „Die Dinge singen hör’ ich so gern …“)
Nicht zu vergessen bleibt bei Kafka – laut Safranski – dessen gebrochenes Verhältnis zu Autoritäten, namentlich zum Vater Herrmann Kafka. „Du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Furcht vor Dir. Ich wusste Dir, wie gewöhnlich, nichts zu antworten, zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor Dir habe, zum Teil deshalb, weil zur Begründung dieser Furcht zu viele Einzelheiten gehören, als dass ich sie im Reden halbwegs zusammenhalten könnte.
Und wenn ich hier versuche, Dir schriftlich zu antworten, so wird es doch nur sehr unvollständig sein, weil auch im Schreiben die Furcht und ihre Folgen mich Dir gegenüber behindern und weil die Größe des Stoffs über mein Gedächtnis und meinen Verstand weit hinausgeht.“
Mit diesen Worten beginnt der bekannte und berühmte „Brief an den Vater“ (1919), in dem Kafka in manchmal verwirrender, manchmal anklagender wie auch devoter Weise der Hass-Liebe gegenüber dem pragmatischen Familienoberhaupt Ausdruck zu verleihen bemüht ist. Der Wunsch, dem Vater zu gefallen, wird stets und ständig konterkariert von einer diffusen Wut ob dessen Ignoranz und intellektueller Fehlorientierung. Wer kennt es nicht, das Gefühl der Ohnmacht, von denen nicht beachtet oder missverstanden zu werden, von denen man sich Anerkennung und Liebe erhofft?
„Leg es auf den Nachttisch“ bekam Kafka vom Vater zu hören, wenn er, der ambitionierte Jungschriftsteller, seine Versuche gelesen haben wollte. Aber so entstand Weltliteratur: „Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt.“ So beginnt Kafkas berühmtestes Werk „Die Verwandlung“ (1912).
Ein Mensch wird zum Käfer, zum hässlichen Ungeziefer, wert, hinausgekehrt zu werden. Beinahe autobiografisch. Metaphorisch. Blieb dem ängstlichen Mitmenschen Franz Kafka nur ein Ausweg: Um sein Leben (zu) schreiben.
Rüdiger Safranski Kafka. Um sein Leben schreiben, Hanser-Literaturverlag, München 2024, 26 Euro.
„Überm Schreibtisch links: Um sein Leben schreiben“ erschien erstmals im am 05.04.2024 fertiggestellten ePaper LZ 123 der LEIPZIGER ZEITUNG.
Sie wollen zukünftig einmal im Monat unser neues ePaper erhalten? Hier können Sie es buchen.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:


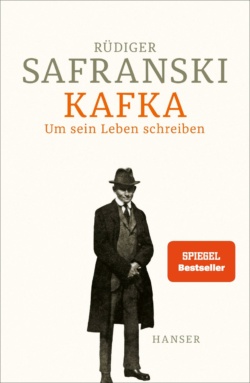













Keine Kommentare bisher