Wenn heutzutage in den Nachrichten vom Westen die Rede ist, wissen scheinbar alle, wovon die Rede ist. In politischen Reden werden die Werte des Westens angepriesen, wird die westliche Zivilisation gefeiert. Und immer ist so ein Klang dabei, dass man es mit der Spitze der Zivilisation zu tun hat, einer ganz besonderen Wertegemeinschaft.
Doch das Bild bekommt Risse. Und das aus guten Gründen. Denn das Bild ist ein Konstrukt, dessen Geschichte Naoíse Mac Sweeney in diesem Buch nachspürt.
Und falsch ist das Bild sowieso. Fast könnte man – in Anlehnung an Dirk Oschmann – schreiben: Der Westen, eine westliche Erfindung. Menschen schaffen sich ihre Selbstbilder, eine große Erzählung, wie es die Professorin für Klassische Archäologie an der Uni Wien nennt. Ihr Buch erschien 2023 in London. Und wie die in London geborene Autorin ist es ein Wesen zwischen den Welten.
Das werden selbst die Klassischen Archäologen so empfinden, die sich für gewöhnlich auch wenig Gedanken darüber machen, wie eigentlich die Selbstbilder von Nationen und „Wertegemeinschaften“ entstanden sind. Dabei wissen sie alle, dass das Selbstbild des Forschers bestimmt, wie er auf Geschichte schaut.
Denn das war ja auch die Vorgeschichte der wissenschaftlich arbeitenden Archäologie. Eine Vorgeschichte, die Naoíse Mac Sweeney im Grunde beleuchtet und seziert, indem sie eben auch die historischen Erzählungen früherer Zeitalter demontiert, in denen einst honorige Chronisten ihren Platz in der Welt und in der Geschichte definierten. Sie definierten Freund und Feind, bastelten Genealogien und hatten keine Scheu, die Stammbäume ihrer Herrscher bis ins alte Troja zu erfinden.
Die Erfindung des Westens
Aber es steckt eben noch mehr in diesen alten Geschichtsdarstellungen: die Geburt einer Idee vom Westen als eines besonderen Raumes mit einer gemeinsamen Geschichte, gemeinsamen Herkunft und gemeinsamen Werten. Eine Idee, die heute in den Köpfen der meisten Menschen in den Ländern des Westens steckt, ohne dass sie diese Selbsterzählung noch hinterfragen. Die meisten glauben sogar, dass diese Erzählung schon uralt ist und bereits an der Wiege Europas so erzählt wurde.
Eine scheinbar so schöne Geschichte, die die Staaten (West-)Europas und Nordamerikas mit der Geschichte des klassischen Griechenlands und Roms verbindet, dass man in der Regel übersieht, dass diese Erzählung in dieser Form sehr jung ist und sich auch die Europäer bis in die Neuzeit hinein völlig andere Geschichten über sich selbst erzählten.
Das eingeklammerte „West“ vor Europa ist jetzt schon meine Zugabe, denn darauf geht Naoíse Mac Sweeney in ihrem sehr kenntnisreichen Buch nicht ein: dass die Osteuropäer in der Erzählung vom Westen eigentlich nicht vorkommen. Welches Bild sie vom Westen haben, dürfte durchaus Stoff für ein eigenes Buch bieten. Aber natürlich fällt einem die Leerstelle auf, wenn man das Buch von Mac Sweeney aus deutscher oder gar ostdeutscher Perspektive liest.
Denn hier war schon immer die Nahtstelle zum Osten.
Erben Roms und Griechenlands?
Naoíse Mac Sweeney nimmt im Grunde – da auch dort aufgewachsen – die angelsächsische Perspektive ein, also die Position des Landes, das immer im Kern der Geschichte vom Westen stand. Jedenfalls ab dem Zeitpunkt, als diese Geschichte völlig neu erzählt wurde. Denn in der Form, wie wir sie heute kennen, wurde sie erst ab dem 17. Jahrhundert erzählt.
Und im 19. Jahrhundert dann endgültig zum vermarkteten Selbstbild all jener Staaten, die sich damals als wirtschaftlich führende Nationen mit einer gemeinsamen Kultur verstanden.
Eine Kultur, deren Entwicklung bis ins antike Rom und ins klassische Griechenland gedacht war als ununterbrochene Linie der Weiterentwicklung und des gemeinsamen Erbes. Dass das so aber nie war, das macht Mac Sweeney anhand von 14 Biografien deutlich von Menschen, die zu ihrer Zeit sehr symptomatisch waren für die Sicht auf die Welt, in der sie lebten. Das hat mit Herkunft und Identität zu tun, wie die Autorin schon im Vorwort feststellt. Aber auch mit Akzeptanz und Außenseitertum.
Und ex sind meist die Außenseiter, welche die Wirklichkeit mit klarerem Blick sehen als die etablierten Professoren und Staatsphilosophen. Was schon im alten Griechenland beginnt, wo sich Naoíse Mac Sweeney eines Historikers annimmt, der nur zu gern als Kronzeuge für die westliche Erzählung herhalten muss und als Chronist eben jenes klassischen Griechenlands, das in den Gymnasien und Hochschulen der westlichen Welt seit dem 19. Jahrhundert exzessiv rezipiert wurde.
Doch Herodot lässt sich eigentlich nicht für diese Geschichtsinterpretation ausnutzen, kann Mac Sweeney feststellen. Tatsächlich war er der wohl einflussreichste Kritiker eben jenes so viel gepriesenen Athens, aus dem Herodot – weil kein gebürtiger Athener – wohl fliehen musste. Auf einmal erfährt man mit Herodot, dass dieses so gepriesene Athen seiner Zeit ein durchaus schon rassistisches Athen war, in dem imperiale Träume vorherrschten und sich die wohlhabene (eingeborene) Elite für den Gipfel der Zivilisation hielt.
Und sich natürlich ihre Sicht auf die Welt erschuf.
Politik schreibt sich ihre Geschichte
Denn diese Selbstbilder sind immer Schöpfungen, Um-Schreibungen von Geschichte, bis alles so hübsch nach einem permanenten Entwicklungsprozess zum Größeren, Besseren, Besten aussieht.
Und das passiert bis heute, wie Naoíse Mac Sweeney feststellt: „Man muss nicht unbedingt böswillig und verlogen sein, um die Geschichte im Sinne der eigenen politischen Agenda umzuschreiben, und man muss sie auch nicht verfälschen, um dies zu tun. Das Umschreiben der Vergangenheit kann auch so geschehen, dass man Tatsachen berücksichtigt, die aus einer konventionellen Erzählung zuvor stets verbannt worden waren.“
Oder indem man Tatsachen einfach ausblendet, nur noch das zitiert, was in die scheinbar so logische Selbsterzählung passt. Und dann einfach auch ausblendet, dass die griechische Geschichtslinie in Europa fast 1.000 Jahre lang überhaupt keine Rolle spielte.
Warum? Weil sie zur Geschichte der Anderen gehörte – in diesem Fall zur Geschichte des Byzantinischen Reiches und zur Rezeptions-Geschichte der islamischen Welt, wo die griechischen Denker studiert und kommentiert wurden, als sich die (west-)europäischen Herrscherhäuser noch fiktive Stammbäume bastelten, die sie zu direkten Erben Roms und Trojas stilisierten.
Dass die scheinbar so gemeinsame Geschichte noch viel komplizierter wird, wenn man auch noch das Christentum versucht, da hinein zu flechten, wird zum Beispiel deutlicher, wenn Naoíse Mac Sweeney am Beispiel des byzantinischen Kaisers Theodor Laskaris zeigt, wie zersplittert und feindselig sich die Christen über Jahrhunderte gegenüber standen und befehdeten.
Oft war diese Feindschaft viel wichtiger und nachhaltiger als die gegen den sogenannten Orient, der sich natürlich auch als ein zutiefst westliches Konstrukt erweist.
Die Welt endete nicht am Mittelmeer
Und selbst in der Renaissance, die oft auch als Geburtsstunde des modernen Europas interpretiert wird, herrschten noch ganz andere Perspektiven vor, war selbst die Sicht auf die eigene Geschichte viel weitgreifender, als es in der (west-)europäischen Engsicht auch heute immer noch aussieht. Denn wirklich geändert hat sich ja an der Darstellung des Siegeszugs der westlichen Zivilisation auch in der Schule nicht.
Dass Rom sich ganz und gar nicht als eine homogene Nation in Europa verstand, wird selbst am Beispiel der von Naoíse Mac Sweeney porträtierten Autorin Tullia d’Aragona deutlich, für die die Welt, in der sie als Italienerin lebte, eben nicht am Mittelmeer endete.
Weshalb die Kontur der modernen Erzählung vom Westen tatsächlich erst im 17. Jahrhundert greifbar wird. Und das nicht ganz zufällig. Denn jetzt mauserten sich die Staaten Westeuropas zu Kolonialmächten. Ihnen genügte nicht nur die Entdeckung der Welt. Sie mussten sie auch noch erobern und ausbeuten.
Und nicht grundlos steht ausgerechnet England als Kolonialmacht und „Werkstatt der Welt“ am Anfang dieser ausgefeilten Geschichte, die – wie Naoíse Mac Sweeney immer deutlicher herausarbeitet – eben auch eine Geschichte von Macht, Vorherrschaft, Dominanz und Unterdrückung ist. Wer fremde Völker beherrschen, ausbeuten und versklaven möchte, braucht dazu eine Geschichte der Überlegenheit. Und die lieferten fortan allerlei begabte und unbegabte Denker.
Aber eben auch Politiker, für welche das Narrativ vom Westen eben zugleich die Begründung dafür war, weltweit Macht auszuüben und die „Segnungen des Fortschritts“ auch Völkern aufzunötigen, die diese gar nicht wollten. Es ist eine urkapitalistische Erzählung der Dominanz und der Entgrenzung. Verbunden mit zwei Phänomenen, die sich bis heute dahinter verstecken: Kolonialismus und Rassismus.
Ein Konstrukt von Überlegenheit
Kolonialismus und Rassismus stecken so tief in der Geschichte der vermeintlich überlegenen westlichen Zivilisation, dass sie für weiße und reiche Mitglieder dieser Gesellschaft praktisch unsichtbar sind. Selbst und gerade dann, wenn sie davon profitieren. Und sogar dann, wenn sie davon überhaupt nicht profitieren wie die armen und ausgebeuteten Bewohner der westlichen Welt, die dadurch, dass sie sich zur „höherwertigen“ weißen „Rasse“ zählen dürfen, scheinbar Teil haben an der Überlegenheit des Westens – und mit den rassistischen Stereotypen immer auch gleich noch ein Feindbild haben, das sie verachten oder bekämpfen dürfen.
Dass sich die einst kolonisierten Länder inzwischen wehren und eigene Erzählungen entwickeln, in denen dann „der Westen“ oft selbst zum Feindbild wird, ist eigentlich erwartbar und Hintergrund vieler traumatischer Ereignisse der jüngeren Zeit. Was nichts daran ändert, dass die Erzählung vom Westen längst falsch geworden ist und sie die komplexe Wirklichkeit nicht wirklich zeigen kann.
Was vor allem Menschen merken, die nun auf einmal zwischen den Welten leben müssen. So wie es der Autor Edward Said schon im 20. Jahrhundert thematisiert hat. Denn die einstigen Kolonialreiche haben sich allesamt aufgelöst – manche friedlich, andere in blutigen Exzessen. Und parallel dazu leben immer mehr Menschen aus den einstigen Kolonien in den Ländern der einstigen Kolonialmächte, machen Karriere, können sogar Premierminister werden.
Und dennoch erleben sie die negativen Folgen der falschen Erzählung vom Westen – sind im neuen Heimatland genauso fremd wie im Land ihrer Herkunft. Ein Prozess, der weltweit vonstattengeht. Und der alle Märchen von „unterlegenen Rassen“ längst widerlegt hat.
Der Glanz falscher Bilder der Vergangenheit
Doch die Selbsterzählung der Weißen wirkt weiter. Denn es ist eine Erzählung von Überlegenheit, an der ihre Erzähler mit aller Kraft festhalten, wie man etwa am Beispiel der begabten Dichterin Phillis Wheatley erfährt, von der die weißen Bewohner der Neuenglandstaaten erst meinten, eine Sklavin könne gar nicht so begabt mit griechischer Dichtung umgehen. Und als ihr (in England gedrucktes) Buch dann Erfolg hatte, verweigerten ihr die weißen Verleger trotzdem weitere Buchpublikationen.
Rassismus funktioniert – tiefgreifend und lang wirkend. Und er sitzt so fest in den Köpfen der Weißen, dass es bis in die jüngste Zeit gedauert hat, das falsche Selbstbild des Westens überhaupt erst einmal infrage zu stellen.
Und da geht es an die Substanz, wie man in den zunehmend krisenhaften Demokratien dieser Ländergruppe sehen kann. Denn die Populisten und Rechtsradikalen holen ja Wählerstimmen, indem sie den Menschen versprechen, das Land zurückzukatapultieren in eine Zeit, als es noch weiß, homogen und überlegen war.
Oder mit den Worten von Naoíse Mac Sweeney: „Diese Leute würden am liebsten die Uhr zurückdrehen, einen großen Teil des gesellschaftlichen Wandels im vergangenen Jahrhundert rückgängig machen und den Westen wiederum in seine ruhmreichen Tage der Weltherrschaft einsetzen.“
Doch genau mit der Methode „stellen sich diese Leute gegen die Prinzipien, die den Kern des zeitgenössischen Westens bilden, und propagieren stattdessen die überholten Grundsätze eines Westens, der eindeutig der Vergangenhreit angehört. Und wenn sie uns in schrillen Tönen auffordern, die westliche Zivilisation zu verteidigen, so rufen sie in Wahrheit zur Verteidigung einer moralisch bankrotten Fiktion auf.“
Mit Betonung auf Fiktion. Denn in einer Welt, in der es längst ganze Staatengruppen gibt, die den Westen mit wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit herausfordern, wird es keine westliche Hegemonie mehr geben können.
Zeit für eine neue Erzählung
Womit das immanente koloniale Denken über die anderen Weltgegenden sich nur zu deutlich als Fiktion erweist. Was natürlich die Frage nicht ausschließt, was denn nun den heutigen Westen tatsächlich im Positiven ausmacht? Demokratie und Freiheitsrechte gehören ganz eindeutig dazu, auch wenn hier der Verweis auf die elitäre Demokratie Athens ziemlich brüchig ist. Denn beides ist genauso wie die Entwicklung der modernen Wissenschaft ein Kind der Aufklärung, die – mit dem Verweis auf den „wissenschaftlichen Rassismus“ – durchaus zwiespältig ist.
Aber das heißt ja nicht, dass Teile der Geschichte tatsächlich in die Zukunft tragen und das Wesen – und die Attraktion – des Westens ausmachen.
Was ja – so Naoíse Mac Sweeney – eben bedeutet, dass es längst schon Zeit ist für eine moderne, realistischere Geschichte des Westens, die die Komplexität der eigenen Geschichte genauso akzeptiert wie die Komplexität einer Welt, in der es keinen Raum mehr gibt für ein wie auch immer geartetes Überlegenheitsdenken. „Und was könnte westlicher sein, als die Form der Geschichte neu zu interpretieren?“, fragt Naoíse Mac Sweeney.
Den Blick also zu weiten, dass viel mehr zur europäischen/westlichen Geschichte gehört als die schmale Erzählung vom Aufstieg der westlichen Zivilisation. Das hat übrigens auch Europa immer bereichert. Renaissance und Aufklärung sind ohne die Rezeption außereuropäischen Wissens nicht denkbar.
Weshalb Naoíse Mac Sweeney am Ende auch noch den chinesischen Versuch etwas genauer beleuchtet, Kulturen für etwas Statisches, Unveränderliches zu erklären und damit ein Gegenbild zum Bild des Westens zu schaffen, das noch viel verstörender ist, weil es Veränderung und kulturelle Transfers geradezu für unmöglich erklärt – wider besseres Wissen.
Damit macht China auch Politik. So, wie mit Großen Ezählungen immer wieder Politik betrieben wird, während die historischen Fakten und Belege einfach beschnitten werden, bis das Geschichtsbild zum politischen Wunschdenken passt. Ein Vorgang, der natürlich die Historikerin zutiefst verstört, zeichnet sich die moderne Geschichtswissenschaft ja geradezu dadurch aus, dass sie die kulturellen Transfers im geschichtlichen Prozess sichtbar macht.
Ohne die es keine der vielen blühenden Kulturen in der Geschichte gegeben hätte. Selbst Griechenland und Rom, die so oft als Wurzeln der westlichen Identität behauptet wurden, waren Produkte intensiver kultureller Transfers über den ganzen Mittelmeerraum hinweg.
So betrachtet sind die ersten Kapitel im Buch für viele Leserinnen und Leser natürlich auch eine farbenreiche Begegnung mit Geschichtsepochen, die ihren Reichtum tatsächlich erst entfalten, wenn man über Stadtmauern, Küsten und fiktive Kontinentalgrenzen hinausschaut.
Naoíse Mac Sweeney „Der Westen. Die neue Geschichte einer alten Idee“ Propyläen, Berlin 2023, 34 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
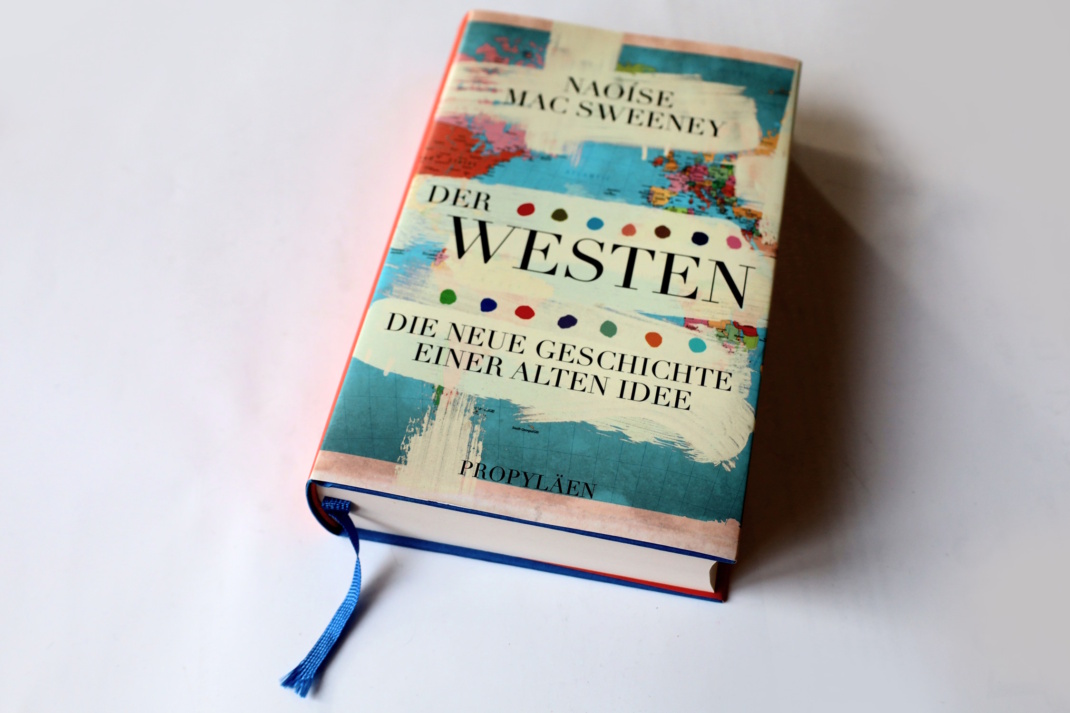

























Keine Kommentare bisher