Dieses Buch – beziehungsweise ein Ausschnitt davon – hat schon die Jury des Alfred-Döblin-Preises überzeugt, den der Leipziger Autor Jan Kuhlbrodt in diesem Jahr zugesprochen bekam. Auch weil Kuhlbrodt in diesem Buch von sich selbst erzählt. Intensiv und ungeschminkt. Und aus jener Not heraus geschrieben, aus der genau jene Literatur entsteht, die ihre Leserinnen und Leser tatsächlich berührt. Weil es ums Eigentliche geht.
Und das merkt man spätestens, wenn einem die Endlichkeit des Lebens mit voller Wucht ins Gesicht schlägt. Oder man auf dem Flur des Krankenhauses der Diagnose nicht mehr ausweichen kann. Eine Diagnose, die Jan Kuhlbrodt eigentlich schon erwartet hatte, wie er schreibt. Dazu hatten sich die Symptome im Lauf der Zeit viel zu deutlich gezeigt. Da half auch das Wissen nichts, dass die Multiple Sklerose nur in 5 Prozent der Fälle vererbt wird. Aber in seinem Fall war es wohl so. Auch wenn er sich in der Rückbesinnung immer wieder auf Szenen in seinem Leben versteift, wo er sich die Krankheit möglicherweise zugezogen haben könnte.
Unser Gehirn ist ja so gestrickt: Es sucht immer nach irgendwelchen Erklärungen für das, was uns passiert, versucht einen Sinn hineinzudenken in die krummen Linien unseres Lebens. Darin ist es brillant. Und das weiß Jan Kulhlbrodt. Dazu hat er sich selbst zu lange mit dem Nachdenken über die Welt und sein Schicksal beschäftigt. Denn dazu wird man ja gezwungen, wenn man erfährt – und trotzdem nicht wahrhaben will – dass die ersten Alarmzeichen des Körpers ankündigen, dass sich der eigene Bewegungsradius nach und nach immer mehr verengen wird.
Eine Welt voller Barrieren
Mit der Niederschrift dieser Reflexionen über sein Leben begann Jan Kuhlbrodt noch in der Corona-Zeit, in jenen langen Monaten, als es den anderen Menschen da draußen, die ihre Beine noch gedankenlos zum Gehen, Spazieren, Springen und Schlendern benutzen konnten, nicht viel anders ging. Auch sie an ihre eigenen vier Wände gefesselt und nur noch mit ihren technischen Geräten mit der Mitwelt verbunden.
Nur dass es für den studierten Philosophen und Soziologen, der noch vor Kurzem als Lehrbeauftragter an der HMT und als Gastprofessor am Literaturinstitut tätig war, inzwischen der Normalzustand geworden war. Selbst die Zeit, als er sich noch mühsam mit Krücken fortbewegen konnte, ist Vergangenheit. Jetzt ist es ein roter Rollstuhl, der ihm noch ein bisschen Bewegung ermöglicht. Aber selbst die Zeit mit Krücken war eine Erfahrung, die Menschen ohne eingeschränkte Bewegungsfreiheit so nie machen. Das schildert er konkret am Beispiel des überhaupt nicht barrierefreien Literaturinstituts. Als wäre das Thema ausgerechnet bei den Menschen, die sich in ihren Texten mit den menschlichen Höhen und Tiefen beschäftigen, noch nicht angekommen.
Vielleicht aber auch nur bei der Bauveraltung der Uni Leipzig, zu der das Literaturinstitut gehört.
Aber Kuhlbrodt schildert die Kletterpartie ins Innere des Literaturinstituts so anschaulich, dass man nicht nur mitfühlt, sondern auch begreift, welche Hindernisse sich auftürmen, wenn andere Menschen ihren Kopf nur in den Wolken haben und die kleinen Kalamitäten der Wirklichkeit einfach nicht wahrnehmen.
Der Traum vom Weltraum
Davon kann Kulhlbrodt mittlerweile etliche Geschichten erzählen. Auch wenn es ihm nicht um eine Anklage geht. Sondern um sich selbst. Was bleibt als Erinnerung, wenn man so – festgebannt im eigenen Zimmer – über das eigene Leben nachdenkt? Wo waren die Wendepunkte? Wo ist man den falschen Geschichten auf den Leim gegangen? Immerhin wuchs Kuhlbrodt ja auch in diesem ummauerten Ländchen DDR auf, wo schon die Jungen in der Schule mit falschen Versprechungen zu Berufsoffizieren geworben wurden. War es wirklich der Traum vom Weltraum, der den Autor dazu brachte, mit 13 Jahren zuzustimmen?
Oder hat dieser Traum, befeuert von den Romanen Stanislaw Lems, gar nichts zu tun mit der Verlogenheit eines Landes, das alle, wirklich alle seine kritischen Kinder und Jugendlichen vor den Kopf stieß? Sie nach Auswegen aus diesem Land suchen ließ, auch wenn es nur welche in der Phantasie waren? Trakls Gedichte zum Beispiel, die für Kuhlbrodt eine wesentliche Rolle gespielt haben.
Und welche Rolle spielen eigentlich die Eltern? Obwohl der Vater längst abwesend ist und nur noch die Mutter in Chemnitz der wichtigste Orientierungspunkt ist für den Jungen, der nur noch selten heimkehrt und aufmerksam feststellt, wie die Krankheit auch seine einst stolze Mutter zu Boden zwingt.
Vielleicht führt der Titel „Krüppelpassion“ auch ein wenig in die Irre. Er assoziiert das verächtliche Bild, das frühere Generationen hatten, wenn sie auf Menschen mit Behinderungen (herab)schauten. Und die Behinderung mit dem Menschen gleichsetzten. Obwohl der Mensch nicht die Behinderung ist. Schon gar nicht in der Selbstreflexion. Denn auch wenn das Gehen längst zu einer nicht mehr greifbaren Erinnerung geworden ist, hat der Kopf nie aufgehört, das eigene Dasein zu reflektieren. In kurzen Zwischenkapiteln bringt es Kuhlbrodt auf den Punkt: „Am Ende meiner Entwicklung steht dieser Begriff: Erkenntnis. Ich erkenne am Gang meinen Zustand. (…)“
Und er beobachtet die Gedankenlosen, die gehen können und sich dessen meist gar nicht bewusst sind. Auch nicht, welche Freiheit das Gehenkönnen bedeutet.
Was macht das mit einem?
Wie festgebrannt in der Erinnerung ist der Tag, an dem er zum letzten Mal den Anstieg in der Antonienstraße hinauffuhr mit dem Fahrrad, ahnend, dass es die letzte Fahrt sein würde. Das Leben fühlt sich völlig anders an, wenn man weiß, dass wichtige Körperfunktionen nach und nach einfach nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Eigentlich etwas, das andere Leute auch erleben – aber erst im hohen Alter. Aber wer schreibt schon darüber? Wer registriert, was das mit einem macht?
Das tun wohl nur die, für die das Leben schon immer der wichtigste Stoff war, um drüber zu reden. Und zu schreiben. Das Wesentliche, Betroffenmachende daran zu packen. Das, was uns darin aufmerken lässt. Und so ganz ohne Grund hat sich Jan Kuhlbrodt dann nicht darangemacht, dieses Buch zu schreiben, dessen Untertitel erst auf dem inneren Titelblatt steht: „Vom Gehen.“
Was schon immer ein mehrdeutiger, symbolischer Begriff war. Denn darin steckt nicht nur der Lauf unseres Lebens, der Gang der Zeit (so zufällig sind ja die Bilder unserer Sprache nicht), sondern auch das eigene Aufrecht-Gehen, das Wissen darum, die eigenen Schritte zu lenken und damit dem eigenen Leben eine Richtung zu geben.
„Er spricht ohne Luft zu holen. Spricht und spricht, als ginge es um sein Leben, das zu retten ihm enorm wichtig erscheint.“ Noch so ein Bild. Denn um was geht es, wenn wir durch unser Leben gehen? Geht es überhaupt um etwas? Dieses Buch ist eigentlich ein einziges „Ja“. Auch wenn es uns nicht mit billigen Vorschlägen kommt, was wir würdigen sollten und was tun, um dem Vergänglichen (auch da steckt das Gehen drin) einen Sinn zu geben?
Eine Vergänglichkeit, die der Autor auch in der Welt selbst sieht. „Wir sind hineingeboren in etwas, was mit uns entsteht, so lange wir es kennenlernen, das aber nichtsdestotrotz in großen Teilen schon da ist. Und es wird bleiben, wenn wir daraus verschwinden.“
Das Vergängliche
Eine Feststellung, die einen nicht groß juckt, wenn man noch jung ist und über Hecken springen kann. Die aber ein völlig anderes Gewicht bekommt, wenn unser Körper uns signalisiert, dass das bald vorbei sein könnte. Auch wenn wir nicht wissen, wann. Aber auf einmal wird all das, was wir so fröhlich erkundet und kennengelernt haben, zu einem Geschenk auf Zeit. Weshalb das Buch natürlich auch voller Abschiede ist. Auch von der Lust, dicke Bücher bis zu Ende zu lesen. Obwohl sich der in sein Zimmer Verbannte zwischen Bergen von Büchern aufhält, die er aber meist nur anliest, irgendwo aufschlägt und dann über einzelne Sätze nachdenkt. Dinge, die andere einst geschrieben haben und die sich nun, mit der Erfahrung des Autors, völlig anders lesen.
Unser Blick verändert die Texte, die wir lesen. Der Text entsteht tatsächlich erst beim Gelesenwerden. Oder beim Vorgelesenwerden. Eine Lebenserfahrung eines fleißigen Autors, der seit 2001 regelmäßig Bücher veröffentlicht hat und auch mehrere Literaturpreise verliehen bekam. Auch das Erinnerung. Selbst eine Fahrt nach Weimar ist inzwischen eine aufwendige Exkursion geworden.
„Ich reise inzwischen im Kopf und schwimme auf Papier.“
Womit sich wieder Kreise begegnen, kann er doch für sein Leben rekapitulieren, dass ihm das Reisen immer schon schwer gemacht wurde: Erst war es die Mauer, die ihm das Reisen in die Welt verhinderte, dann war es die Armut, nun ist es die Krankheit. Und wie das so ist mit Büchern: Man muss sie gar nicht zu Ende lesen, um auf Reisen zu gehen. Man kann mittendrin abheben und will gar nicht wissen, wie die Sache im Buch ausgeht. Was freilich auch wieder ein starkes Bild für den Lauf des Lebens ist: Wir stecken immer mittendrin und wissen alle nicht, wie es endet.
Und selbst wenn wir es – wie Jan Kuhlbrodt – ärztlich attestiert bekommen haben –, wir wissen es trotzdem nicht. Denn nicht das Ende ist die Reise, sondern das Untwerwegssein.
Keine Delfine
Leben ist immer jetzt. Das klingt als Subtext immer wieder an. Egal, wie heftig die Einschränkungen inzwischen sind. Das Gefühl, dass es dennoch weitergeht, ist präsent. Es treibt auch den Autor an, der sich hier hingesetzt hat und bewusst hütet davor, sentimental zu werden. Einmal untersagt er es sich regelrecht. Denn die gedankliche Beschäftigung mit dem vergehenden Leben hat ihn auch zutiefst nüchtern gemacht: „Wir sind alle Sterbebegleiter, und Keiner wird der Letzte sein, der stirbt.“
So endet die Geschichte – ohne Ende. Denn da kommt immer noch etwas. Und wenn es nur wieder ein Anlass ist, wie es so viele gibt in unserem Leben. Der Anlass, mit dem er angefangen hat, über seine „Widerfahrnis“ zu schreiben: „Letzten Monat ist meine Mutter gestorben. Sie starb mit der gleichen Krankheit, wie ich sie mit mir durchs Leben schleppe.“
Womit auch schon sein Blick auf die Krankheit einjustiert ist. Sie geschieht einem. So wie einem auch alles andere im Leben geschieht. Und nicht immer sind wir Herr der Ereignisse, souverän in unserem Handeln. Auch deshalb denkt der Autor immer wieder auch über Widerfahrnisse aus seiner Kindheit zurück: Was geschieht uns, ohne dass wir wissen, wie wir uns wehren können? Wo wurde uns ein Meer voller Delfine versprochen? Und dann war da zwar das Meer, aber keine Delfine?
Das reicht schon völlig. Das geht ans Eingemachte. Und endet immer wieder auch mit diesem Befremdetsein über die jungen Gesichter auf alten Fotos. Das müssen andere Menschen sein, die aber den selben Namen tragen. Aber wie fügt sich das zusammen?
Vielleicht wirklich als ein Tagebuch voller Reflexionen, die sich alle ums Gehen drehen. Um das Vergangene und das Vergehende. Man sitzt mittendrin, festgepinnt im bücherverstellten Zimmer. Aber die Sache geht trotzdem weiter. Auch wenn wir nur noch im Kopf verreisen. Aber da sind uns keine Grenzen gesetzt.
Und die besorgte Nachfrage des Freundes aus der Straßenbahn, als er sich nach der Arretierung des Rollstuhls erkundigt, bekommt eine ganz andere Dimension: „Hast du die Bremsen drin?“
Die Frage beantworte mal jeder, wie er gerade geht oder sitzt in seinem Leben.
Jan Kuhlbrodt „Krüppelpassion“, Gans Verlag, Berlin 2023, 30 Euro
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
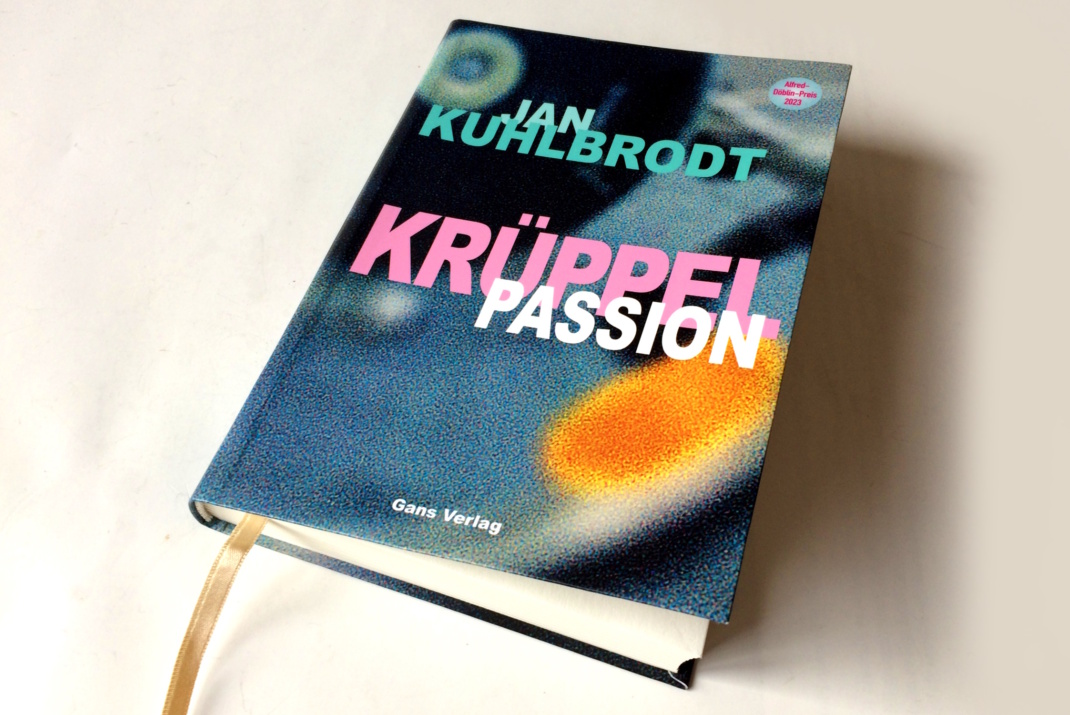
























Keine Kommentare bisher