Nachdem es mit seiner opulenten Familiengeschichte „Havemann“ so viel Ärger gab und das Buch nur noch gekürzt und stellenweise geschwärzt herauskommen konnte und auch der Roman „Speedy“ ohne die Schützenhilfe von Clemens J. Setz nicht so bald erschienen wäre, hat Florian Havemann seinen neuen Roman „Bankrott“ gleich mal im eigenen Verlag veröffentlicht. „Ein Berliner Verlag mit New Yorker Verbindungen.“ Ein Vexierspiel.
Denn damit wird der Autor nicht nur zum Selbstverleger, sondern zum Verleger seiner selbst. Und weil er damit auch die Verantwortung für das Buch hat, schaut er seinem Autoren gleich mal über die Schulter, mischt sich ein und wird so selbst zum Teil der Erzählung, die über das Fragment nie hinauskommt. Was auch daran liegt, dass der Autor nicht wirklich weiß, was er mit dem Stoff eigentlich anfangen soll. Oder ob das überhaupt ein Stoff ist, dieser medial aufgewirbelte Bankrott eines brandenburgischen Bauunternehmers, mit dem der Autor in einer Art alter Freundschaft verbunden ist.
Doch während Taff, wie er ihn nennt, die Nach„wende“zeit genutzt hat, um sich erst als Umzugsunternehmer und dann als Bauunternehmer einen gewissen Reichtum zu erwerben und eine polnische Schönheit zur Frau zu nehmen, hat der Autor ganz ersichtliche Probleme, als Schriftsteller einen Fuß auf die Erde zu bekommen.
Weshalb er dann auch glaubt, in Taffs Pleite den Stoff für einen Roman zu sehen, und dem Leben seines alten Freundes nun hinterher recherchiert, wie das eigentlich eher Privatdetektive oder Stalker machen. Das Ergebnis ist ein großes Sammelsurium auf der Computerfestplatte mit aufgezeichneten Gesprächen, Erlebnissen, Überlegungen, Selbstbetrachtungen, Zweifeln und etlichen sexuellen Eskapaden. Der Roman ist nie erschienen, die Festplatte irgendwann abgestürzt, die Dateien wurden wieder hergestellt und jetzt – mit neuen Einschüben versehen – neu sortiert.
Der Schriftsteller als Voyeur?
Scheinbar ist es Taffs Geschichte, in der – fragmentarisch – sein jäher Absturz geschildert wird, nachdem eine namenlose Zeitung seine Millionen-Steuerschuld in die Welt setzte. Mit üblen Folgen. Denn ist der Ruf erst ruiniert, kommen die Gläubiger, bleiben Aufträge aus, sinkt die Zahlungsmoral.
In gewisser Weise ist die Romanidee durchaus ein Bild der ostdeutschen Gesellschaft mit einer Aufsteigergeschichte im Mittelpunkt, die im jähen Absturz endet. Ohne dass diesem Taff die Mittel gegeben sind, sich gegen die Abwärtsspirale zu wehren. Denn sein ganzes Kapital steckt in der Firma. Seine Frau Marina lässt sich von ihm scheiden. Und dieser ominöse Schriftstellerfreund taucht auf, um aus der Geschichte nun auf seine Weise Kapital zu schlagen, sie als Roman zu verwursten.
Würden Romanautoren wirklich so arbeiten, unsere Bestsellerlisten wären mit Unsäglichem gefüllt.
Aber ist es nicht wirklich so? Oder spiegelt sich darin Florian Havemanns eigene Erfahrung mit „Havemann“? Aus welchem Stoff machen Schriftsteller eigentlich ihre Romane? Und wann wird man eigentlich ein Schriftsteller? Ist das ein Habitus? Eine Marotte? Oder tatsächlich ein ernsthafter Beruf?
Und woher nehmen sie ihren Stoff? Sollte das nicht aus ihrem eigenen Erleben schöpfen? Kannibalisieren sie tatsächlich die Geschichten, die sie mit ihren Bekannten und Freunden und Liebsten erleben? Oder denken die sich das alles aus? Durchaus eine spannende Frage – insbesondere für Literaturtheoretiker, die sich seit Jahrzehnten über die Frage auslassen können, wieviel Flaubert nun in Madame Bovary steckt. Eine Frage, die sich zwar ein Flaubert stellen kann. Aber wen sonst geht das eigentlich an? Oder: Wie viel Substanz hat die Frage eigentlich?
Die Tragödie des Schriftstellers
Erst recht, wenn man weiß, wie sehr sich Flaubert zeitlebens regelrecht abgeschottet hat, um seine Geschichten zu verfassen. Abschottung als einzige Möglichkeit, die eigenen (Kopf-)Welten erschaffen zu können. In denen sich dann Leser wiedererkennen können. Gemeint fühlen können. Natürlich ist das so: Ohne dass ein Autor sich wirklich ganz gibt, entsteht keine lebendige Geschichte.
Ohne das kommt auch kein Roman ins Rollen. Es ist schon erstaunlich, aber an diese Stelle kommt Havemanns erzählender Autor nie. Was er über Taff und seine Frauen und seinen Abstieg erfährt, bleibt Fragment, Szene, Erörterung. Sollte er wirklich einen Roman draus machen wollen, hätte er schon nach den ersten Gesprächen mit seinem Taff feststellen müssen, dass er in diese Figur nicht hineinschlüpfen kann. So wenig wie in all die anderen Figuren, die er auftreten lässt. Im Grunde schildert Havemann hier die Tragödie des Schriftstellers, der den Sprung über den Abgrund nie schafft. Der die Distanz zu seinem Stoff auch nie überwindet.
Er bleibt – bis zum Schluss – der Beobachter, Protokollant, Sammler, der sich fortwährend Gedanken darüber macht, wie er seine Geschichte nun anpacken müsste. Theoretisch scheint ihm alles klar. Nur diese leidige Praxis, in der dann aus einem spröden Stoff tatsächlich eine mitreißende Geschichte wird, die bewältigt er nicht. Oder genauer: An die wagt er sich nicht einmal. Denn selbst wenn man in der so störrischen Realität einen guten Stoff findet, bleibt es einem eben doch nicht erspart, diesen Stoff in eine schlüssige, lebendige Geschichte zu verwandeln. Das, was man dann Roman nennen kann.
Was Florian Havemann auch nicht tut. Und er lässt seinen Helden, der nicht mal das Zeug zum Helden hat, nicht mal zum Frauenverführer, am Ende des Öfteren darüber sinnieren, ob die Bankrott-Geschichte, die er da zu schreiben versucht, nicht letztendlich die Geschichte seines eigenen Bankrotts als Schriftsteller ist.
Seine wiederholte Behauptung, er sei Schriftsteller, also doch eher eine Anmaßung ist, weil er es partout nicht fertigbringt, das so akribisch Gesammelte zur schlüssigen Geschichte werden zu lassen.
Vielleicht auch, weil ihm gerade die wichtigste Flaubertsche Eigenschaft fehlt: Sich ganz und gar in seinen Romanhelden hineinversetzen zu können.
Die Medien einer exhibitionistischen Gesellschaft
Was auch noch eine weitere Ebene hat, denn am Ende landet der so glücklos scheiternde Autor als Journalist bei der namenlosen Zeitung, die den Skandal um den insolventen Bauunternehmer erst ins Rollen brachte und ihn damit erst zum Futter für die Boulevardpresse gemacht hat, die ja geradezu darauf lauert, dass sie Menschen als Futter vorgesetzt bekommt, um sie öffentlich bloßzustellen und zum Monster zu machen.
Womit dann auch das in den Blick rückt, was man gern als „Macht der Medien“ missversteht, auch wenn es nur die Skandalisierungslust einer bestimmten Medien-Unart ist, die so mancher Kanzler dann geradezu als unersetzlich fürs Regieren versteht. Aber diese verächtliche Spielart des Zeitungsmachens hat nun einmal auch ihren Türöffner. Und das ist der den meisten Menschen eigene Voyeurismus. Den der Autor in diesem Sammelsurium der Beobachtungen natürlich bedient.
Während er gleichzeitig die andere Seite des Voyeurismus zeigt, denn der lebt davon, dass es auch viele Menschen gibt, die sich nur zu gern in der Aufmerksamkeit der – gaffenden – Menge aalen. „Es gibt den Exhibitionismus der Starken, der Reichen und Erfolgreichen, Angeberei, Aufschneiderei, das Protzen und Motzen: Wer hat den dicksten Mercedes, wer am meisten Geld in der Tasche, wer den größten Schwanz, wer kann die tollsten Weiber stemmen? …“
Wir leben in einer Gesellschaft des Talmi, des falschen Scheins und der falschen Sensationen. Und damit auch der falschen Geschichten. Ganze Zeitschriftenreihen leben davon, diverse Fernsehsender auch. Eine Schein-Welt, der sich auch der von Florian Havemann entworfene Autor nicht entziehen kann. Denn diese Fixierung auf das Zur-Schau-Stellen verbaut natürlich den Blick auf den Menschen dahinter.
Der Glanz des schönen Scheins
Auch das gehört zum Bankrott seines Schriftsteller-Sein-Wollens (auch das eine Form des Exhibitionismus), dass er zu seiner Figur Taff nie ein wirklich nahes, verstehendes Verhältnis gewinnt. Er bleibt bis zum Schluss Voyeur, auch wenn er sich zu Anfang vornimmt: „Aber ich will natürlich auch diesen Exhibitionismus eines Schwachen in meinem Roman haben, der mir so viel näher ist …“ Nur wird er dabei in seinen sehr intimen Protokollen selbst zum Exhibitionisten. Während er seinem Helden Taff nicht ansatzweise nahe kommt, weder seine Beweggründe versteht, noch ihn tatsächlich als leidende Figur begreift. Er schaut auf ihn wie der Voyeur durchs Schlüsselloch.
Und sieht dabei auch nur ganz theoretisch, dass dieser Taff die Regeln der exhibitionistischen Gesellschaft begriffen hat. Und danach handelt. Denn es zählt nun einmal der schöne Schein. Und der Glanz des Geldes und des Erfolges. So wie ein ganzes Unternehmen vernichtet werden kann, wenn falsche Gerüchte darüber in die Zeitung lanciert werden. So kann dieser Taff auch wieder auferstehen, wenn dieselbe Zeitung das Gegenteil berichtet und sich die Steuerschulden als Irrtum erweisen. Eine Art Unternehmermärchen, bei dem der scheinbar gescheiterte Taff glorios zu altem Glanz kommt. Und das am Ende den Harmlosesten von allen die Würde, den Stolz und das Leben kosten – den irrenden Finanzbeamten.
„Warum gibt es im Bankrott kein positives Bild vom Schreiben?“, lässt Havemann seinen Autor fragen. „Ganz einfach, weil ich das Schreiben in keinem positiven Licht gesehen habe. Und auch immer noch nicht sehe. Daran hat sich nichts geändert. Die Literatur als Beitrag zum Wahren, Guten und Schönen, dazu habe ich mich auch nicht durchschummeln können.“
Was er übrigens niederschreibt, nachdem er – im Nachdenken über den Journalismus – noch einmal betonte, dass er „zu meiner schriftstellerischen Begabung auch noch ein gewisses Talent entwickelt habe, die Fähigkeit, zwischen Wichtigem und Unwichtigem zu unterscheiden.“
Ein verhinderter Michael Kohlhaas
Das Sammelsurium, dass hier von der gecrashten Festplatte gerettet wurde, und auch die eingefügten Erweiterungen erzählen aber just davon, dass dieser Autor über all diese Eigenschaften nicht verfügt. Dass seine Erzählung also in erster Linie eine exhibitionistische ist. Vielleicht ein ziemlich gewichtiger Schwinger gegen die Eitelkeiten eines Literaturbetriebes, der selbst den Exhibitionismus bis ins Extrem betreibt.
Eine mögliche Interpretation. Auch wenn Florian Havemann auch noch andere Möglichkeiten anbietet – etwa die Widerstandsgeschichte à la Michael Kohlhaas, mit der ein gescheiterter Unternehmer zeitweilig versucht, das erlittene Unrecht in eine gesellschaftliche Bewegung zu transformieren, den Zorn also all jener einzusammeln, die sich in dieser ostdeutschen Provinz unrecht behandelt und betrogen gefühlt haben. Doch auch aus dieser Sammlungsbewegung wird nichts, weil selbst dieser Taff schnell merkt, was für seltsame Leute da auf einmal auftauchen und die „Bewegung“ manipulieren möchten.
Es ist ja nicht so, dass diese Geschichte nicht mehrere Möglichkeiten böte, zu eskalieren und den Autor mitzureißen in Sphären, in denen er vom Voyeur zum Reiter seiner Story wird. Aber das passiert nicht. Was auch wieder eine Geschichte ist, nämlich die der Angst des Schreibenden vor der eigenen Geschichte.
Denn wer sich nicht – bildlich gesprochen – in Madame Bovary zu verwandeln traut, erfährt nun einmal nicht, was tatsächlich passiert, wenn die Heldin zu leben beginnt, wozu sie fähig ist und vor allem, was an Sehnsüchten und Vorstellungen im Autor selbst schlummern. Literatur ist immer auch eine Art Nacktheit vor einem neugierigen Publikum. Was nicht heißt, dass sich darin alle entblößen müssen, was hier freilich in einem geradezu pittoresken Finale eine Menge Leute machen – vor allem Frauen.
Was bleibt? Eine ziemlich dicke Fragmentsammlung, aus der auch ein Gustave Flaubert ganz bestimmt keinen Roman destillieren würde. Schon deshalb, weil Bauunternehmer aus der ostdeutschen Provinz vielleicht nicht wirklich die Spezies sind, aus der man wirklich eindrucksvolle Romanfiguren machen könnte.
Florian Havemann „Bankrott“, Freunde & Friends, Berlin 2023, 25 Euro.
Tipp: Zur Leipziger Buchmesse liest Florian Havemann am 27. April um 14.30 Uhr in der #Buchbar in Halle 2 aus seinem Roman “Bankrott”.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
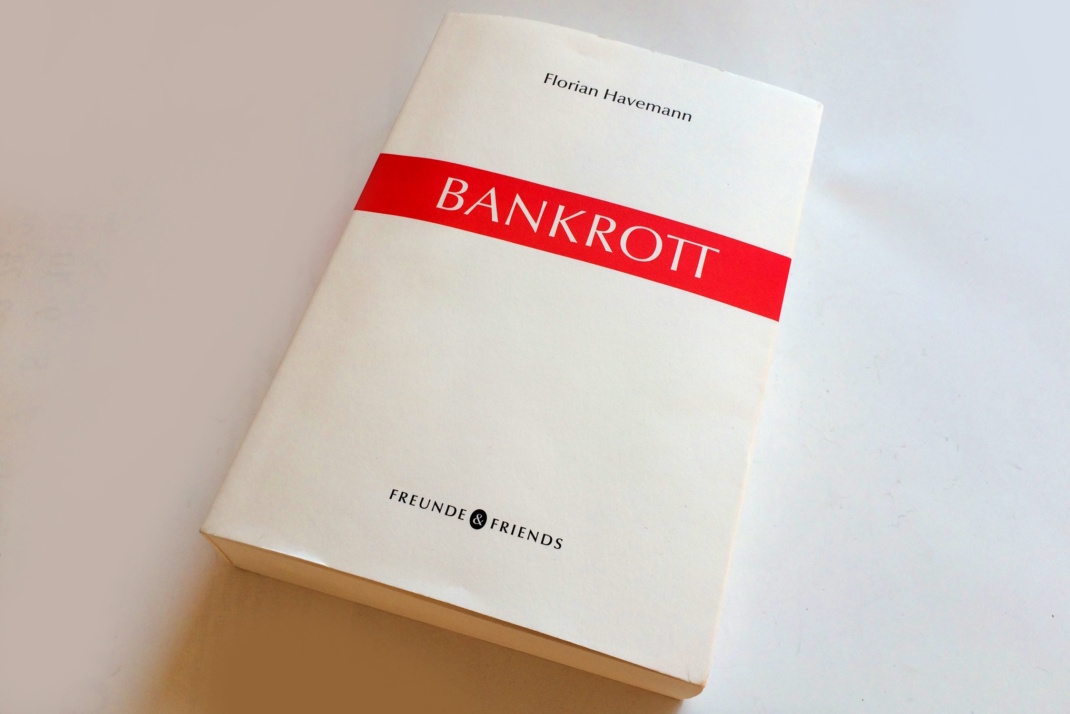
















Keine Kommentare bisher