Am Ende kann man ihn sich beinah vorstellen, wie er da am Schreibtisch sitzt und versucht, die Geräusche seines Wohnblocks in Geschichten zu verwandeln: „Natürlich rauscht der Wind in seinen Ohren, rauscht im linken Ohr, rauscht im rechten Ohr. Und er hört jemand singen üben, vielleicht in der Wohnung über ihm, vielleicht viel weiter entfernt, einen alten Choral, einen uralten Choral, ‚facis mirabilia‘ versteht er.“
Vielleicht sitzt Patrick Beck tatsächlich so da in einem Dresdner Wohnblock, durch den der Wind pfeift. Neben sich die Schreibtischlampe mit dem Kippschalter und dem schwarzen Kabel. Ein Stillleben. Strom an, Strom aus. Was wäre, wenn dieser Wohnblock sich nun auf einmal losreißt mit dem Wind, und davon schwimmt, raus ins Meer? Zu einer Fahrt ins Unbegreifliche. Unfassbare. Um dann vielleicht nach Jahren, zerschunden von Wellen und Wind, auf einer Klippe zu stranden. Irgendwo vor einer felsigen Küste?
Die Bewohner haben sich irgendwie eingerichtet, leben ihr gewohntes Leben fort, auch wenn überall im Haus Risse auftauchen, sich unten im Keller der Müll ablagert, seltsame Metallteile in den Wänden gefunden werden, Expeditionen aufbrechen, um eine Hütte am Strand aufzusuchen … Es geht ziemlich fantasievoll zu in diesem Debütroman des Dresdner Autors Patrick Beck. Auch sehr fragmentarisch, denn die Kapitelnummerierung lässt zumindest vermuten, dass hier die Aufzeichnungen des Kapitäns ordentlich durcheinander geraten sind und ein Großteil der Aufzeichnungen gar verloren ging.
Vielleicht vom Winde verweht. Und gerade in den ersten Kapiteln weht der Wind tüchtig, schleppt nicht nur den ganzen Wohnblock aufs Meer hinaus, sondern verhindert gar, dass die Bewohner das Gebäude überhaupt noch verlassen können.
Die Namenlosen
Trotzdem scheinen sie es jahrelang darin auszuhalten, auf dem Dach gar fleißig Gemüse zu ziehen und an den grasbewachsenen Wänden ihre Schafe und Ziegen zu weiden. In einzelnen Kapiteln kommen unterschiedliche Stimmen zu Wort, die jede völlig andere Geschichten erzählen. Doch die Erzähler bleiben namenlos. Sodass die Erzählungen über dieses ins Meer abgetriebene Gebäude durchaus mythische Züge annehmen. So wie Menschen sich ja über Jahrtausende Geschichten erzählten. Die Erzähler verschwinden hinter dem Erzählten. Und was erzählt wird, nimmt immer seltsamere Züge an.
Da ist die Interpretation, dass tatsächlich der Autor Abend für Abend beim Schein seiner Schreibtischlampe sitzt und versucht, die Gesprächsfetzen, die im Haus unterwegs sind, in kleine Geschichten zu verwandeln, durchaus nicht so fern liegend. Aber auch eine andere Interpretation bietet Patrick Beck an: das in die Meere hinausgetriebene Haus als Bild für das ganz irdische, verworrene menschliche Dasein. Mitsamt dem Gefühl, das ja einen großen Teil unseres aktuellen gesellschaftlichen Empfindens ausmacht: dass man nämlich nicht viel ändern kann an den Dingen, wie sie sind. Dass der Mensch in seiner angemaßten Größe gar keine Macht hat, die Welt zu verändern und ziemlich ernüchtert den Dingen zuschauen muss, wie sie sind und sich verändern.
Auch all die Dinge, die der Mensch selbst hervorgebracht hat, der nun merkt, dass sie sich verselbstständigt haben und ihm nun als entfremdete und nicht mehr beherrschbare Phänomene gegenüber stehen. Was ja durchaus ein befremdender Zustand ist, wie schon Goethe im „Zauberlehrling“ zeigte. Nur, dass es diesmal der ganzen (Haus-)Gemeinschaft an den Kragen geht.
Jetzt beherrschen uns die Dinge …
„… wir haben es nur noch nicht gemerkt, wir haben die Dinge geschaffen, um nicht wegzufliegen, um uns gegen den Wind zu stemmen, die Dinge haben wir geschaffen, um den Wind zu beherrschen. Jetzt beherrschen uns die Dinge, und das ist eben falsch, das war von vornherein falsch, sich gegen den Wind stemmen zu wollen, den Wind bekämpfen zu wollen, den Wind beherrschen zu wollen …“ (Seite 80/81)
Das ist eine Interpretation, die durchaus naheliegt. Die auch in Teilen erklärt, warum die diversen Erzählerstimmen so fatalistisch klingen, als hätte man am eigenen Schicksal von vornherein nichts ändern können, sei eher hilflos den Elementen ausgeliefert.
Was ja durchaus für viele Menschen – nicht nur die Bewohner der Plattenbausiedlungen, durch die der Wind pfeift, – ihre Lebenserfahrung ist. Eher schleudert sie das Leben dorthin, wo sie sich nun wiederfinden, als dass sie je die Möglichkeit gehabt hätten, ihren Lebensweg tatsächlich selbst zu bestimmen. Dann wird natürlich auch das Erzählen zu etwas Fatalistischem, in dem sich die Erzählenden verlaufen wie in einem Dickicht. Mit lauter Mutmaßungen, warum die Dinge so sind.
Vielleicht aber lässt sich die Sache noch viel größer denken. Denn dieses Grundgefühl, in eine Welt geworfen zu sein, die viel zu groß und rätselhaft ist, als dass wir sie beherrschen könnten, ist ja ein uraltes. Und da hat es natürlich erst recht eine mythische Dimension. So klingt das schon früh in diesem Roman aus Gewisper an: „Und da ist uns bewusst geworden, dass wir allein sind, dass wir ganz allein sind, ob wir nun hundert oder tausend oder eine Million oder eine Milliarde sind, wir sind immer ganz allein“, liest man auf Seite 34.
Trotzdem ganz allein
Das kann man als fatal sehen. Oder als Gewahrwerden, dass es da draußen tatsächlich niemanden gibt, der die Menschheit retten wird, wenn sich ihr eigenes Haus, die Erde, in eine brennende Müllkippe verwandelt. Niemanden. Keinen Gott und keine Aliens. „Wir sind ganz nah am Meer und am Himmel und am Wind, aber trotzdem ganz allein. Wenn wir kein Wasser mehr haben, dann wird niemand kommen und uns neues bringen. Und dieses Alleinsein in diesem Haus auf der Klippe mussten wir aushalten, ertragen, und dieses Aushalten und Ertragen des Alleinseins war noch viel fürchterlicher als das Alleinsein.“
Wenn man diesen Roman der Winde so liest, wird das davon gewehte Haus zu einem Sinnbild für eine Gesellschaft, die tatsächlich so langsam ahnt, dass es tatsächlich niemanden da draußen gibt im Universum, der dann mit Rettungsbooten und Carepaketen kommt, wenn wir diesen einzigen uns verfügbaren Planeten unbelebbar gemacht haben. Dass wir gerade unser Zuhause zerstören, den Elementen preisgegeben haben und jetzt allein, ganz allein damit umgehen müssten.
Beide Interpretationen bieten sich an. Was nicht heißen muss, dass Beck darauf hingeschrieben hat. Denn dass das Haus nicht wirklich in Wind und Wellen schwimmt, wird mit den späteren Erzählungen im Buch immer deutlicher. Monologen, die letztlich vom gestrandeten Leben in einem Wohnblock erzählen, der zwar auf festem Land steht, mit kahl geschorenen Wiesen drumherum und dem Lärm der Hausmeister mit ihren Laubbläsern und Sägen, und trotzdem weitab von der lebendigen Welt, schon längst abgetrieben und gestrandet, so wie sich auch die Menschen fühlen, die darin leben.
Gestrandet
So wie augenscheinlich der Erzähler, der dem Vergehen des Tages zuschaut und sich Gedanken macht über all die anderen, die mit ihm in diesem gestrandeten Haus leben. Und sich bemühen, den Lärm von draußen irgendwie auszublenden, weil sie daran nichts ändern können, weil ihr Einspruch nichts bewirken würde.
„Aber dann hat sie auch ihren Körper eingeklammert. Jetzt war ihr Geist noch übrig. Auch hier hat sie eine Unruhe wiedergefunden, die Unruhe der Säge. Ein wildes Hin- und Herschlagen des Geistes. Auch das hat sie eingeklammert. Ein ganz ruhiger Geist ist übrig geblieben. Der sich selbst beobachtet hat. Die komplette Ruhe. Ein absolutes Ich.“
Womit man bei Fichte und Novalis wäre. Und der Einsamkeit des modernen Menschen, der begreifen muss, dass er letztlich ganz auf sich und die Welt verwiesen ist, wie sie in seinem Bewusstsein entsteht. Und das können durchaus beklemmende Bilder sein, Empfindungen von einem Verlorensein, die so ein Bild von einem windumtosten Haus ergeben, das abgetrieben ist in die Weite der See. Kein Ufer in Sicht. Und wenn doch, dann ist es unerreichbar. Und keiner ist da, der weiß, wie man so ein Haus in den Winden segeln kann und einen Ort findet, den man wiedererkennt.
Das dürfte durchaus das Lebensgefühl vieler Neuzeitbewohner wiedergeben. Ohne Kompass und Sextant abgetrieben in eine Leere, die einem die Machtlosigkeit über das eigene Schicksal gnadenlos um die Ohren wehen lässt.
Patrick Beck „Windheim“, Leipziger Literaturverlag, Leipzig 2023, 19,95 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
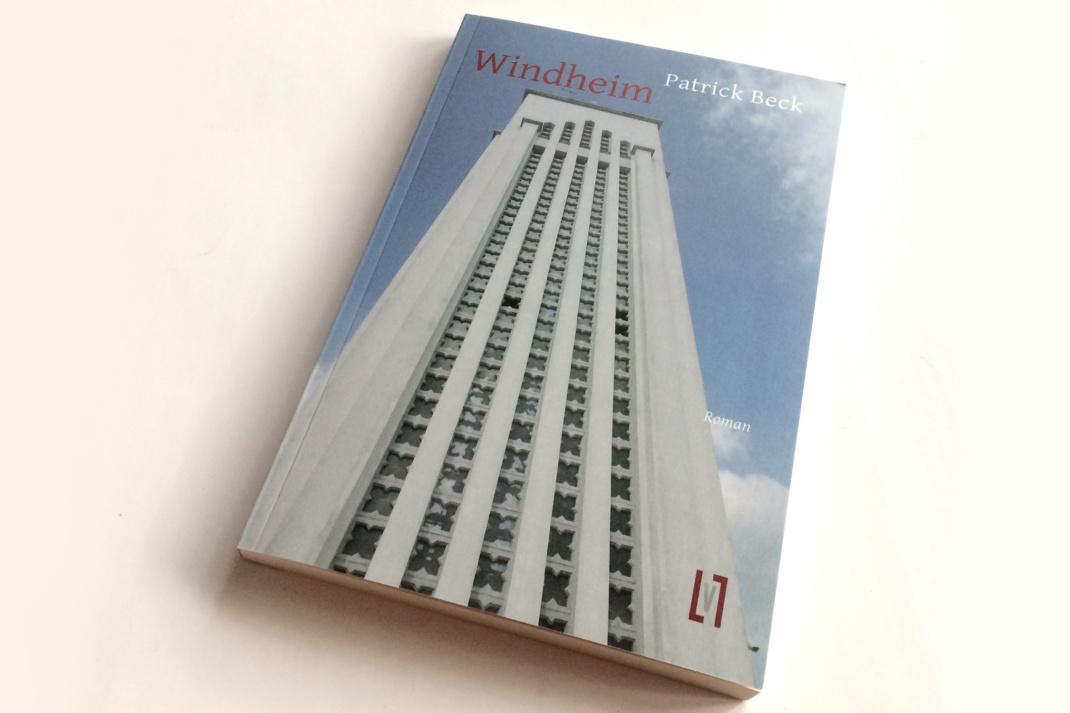



















Keine Kommentare bisher