Der in Dresden heimische Thelem Verlag hat sich etwas getraut, was durchaus mutig ist in einer Zeit, da die Menschen ihre Stunden lieber mit nervenden Smartphones verbringen, als still vertieft in Bücher. Obgleich es sie noch gibt, die unbeirrt Lesenden. Auch in der Straßenbahn. Auch wenn das meist dicke, spannende Romane sind. Eher keine Gedichte, wie sie hier in einem der ersten Bände der neuen Reihe „fortfolgendes“ zu lesen sind.
Drei Bände hat Thelem in diesem neuen Imprint jetzt veröffentlicht. Darunter auch den zweiten Gedichtband von Friedrich Schollmeyer. Er ist ein Leipziger Autor und Philosoph. Sein erster Lyrikband hieß „Nach allerletzt“ und erschien 2018. Geboren wurde er 1988 in Dresden und hat in Jena und Leipzig Kulturwissenschaften, Philosophie, Soziologie und Pädagogik studiert.
Dichtung und Gedachtes
Man braucht also sehr stille Orte, um seine Gedichte zu lesen. Gedichte, die eher Gedankensplitter sind, Gedachtes in diesem Sinn, auch wenn Dichtung einst vom lateinischen dictare abstammte. Ein Lehnwort also, bei dem man nicht mehr daran denkt, dass es von Vorsagen und Niederschreiben kommt. Vorsagen auch im Sinn von Vorschreiben wie in Diktieren und Diktator. Das Wort hat Karrieren hinter sich. Erst seit 700 Jahren gilt es vor allem für (Vers-)Dichtung. Und Erdachtes, das dann aufgeschrieben wurde.
Seit Martin Opitz dann noch enger für lyrische Texte in Versform.
Ein langer Ausflug. Doch nichts ist selbstverständlich. Alles kann sich verändern. Was Schollmeyer schreibt, hätte Martin Opitz niemals als Gedicht empfunden. Es ist weder streng in Versen und Strophen gebaut, noch reimt es sich, noch hat es Rhythmus.
Literarische Formen verschmelzen. Grenzen sind fließend. Schon mit Lessing begann die deutsche Tradition der Sinn-Gedichte. Was nicht nur mit Sinn zu tun hat, sondern auch mit Sinnen: der Lust am Nachdenken und Gedanken-Stolpern. Sprache bietet sich dazu an. Sie lockt in Abgründe und Stolperfallen. Ein Gedanke genügt, und im Kopf beginnt sich ein ganzer Faden abzuwickeln. Genau das macht Schollmeyer. So wie in „Augenblickmal“: Der Einstieg liegt vielen nur zu oft auf der Zunge. Gedankenlos sagt man es hin, wenn man mit der Meinung anderer Leute nicht übereinstimmt. „Es liegt im Auge des Betrachters.“
Meist bleibt es dabei. Einer zuckt die Schultern und wendet sich ab. Missverständnis auf den Punkt gebracht. Wir leben ja auch in einer Zeit zunehmend gestörter Kommunikation.
Und Schollmeyer? – Er nimmt den Faden auf: „Es liegt im Auge des Betrachters gut / Allzu gut, so liegt es an ihm / es sanft auszuheben, verdächtigend schön / zurecht geschnittenem Federbett. / Es vorzustellen, zu umgehen / wie Ansichtssache anzusehen.“
Sehen und Anschauen
Da steckt der Philosoph drin, der einen hingeflapsten Spruch so nicht stehen lassen kann. Und es steckt der aufmerksame Benutzer einer Sprache drin, der in den scheinbar so banalen Sprüchen die Mehr-Bedeutung der Worte sieht und weiterdenkt. Denn was wir betrachten, ist Ansichtssache. Sache zum Ansehen und damit umzugehen. Es geht ums Sehen und Anschauen. Nur noch als Wortmarken aus dem weiterführenden Text erwähnt: Augenscheinwerfer, Strahlen, Helle, Augenweide, Netzhaut. Der Augen-Blick stand ja schon im Titel.
Dass das hier keine Landschafts- und Naturgedichte sein können, machen schon Schollmeyers Kapitelüberschriften deutlich: „in humanum“, „in dividuum“, „in tempus“, „in love“. Da denkt einer (nicht ganz systematisch) über das Mensch-Sein nach (und natürlich in „in love“ über die Liebe und das, was für gewöhnlich passiert, wenn es dann doch auseinandergeht).
Und wie das bei Philosophen ist, wenn sie nicht gar den deutschen Säulenheiligen mit ihrem Man, dem Es und dem Weltgeist nachbeten, sie werden persönlich. Denn die einzig verlässliche Perspektive ist die eigene, das Ich, das die Welt betrachtet und sich darin oft genug verloren, verstört, verunsichert, traurig, ratlos und nachdenklich wiederfindet. Das geht nicht erst in „in dividuum“ los. Das ist Grundhaltung bei Schollmeyer, der die ganzen Zweifel und Unsicherheiten kennt, die entstehen, wenn man zu viel nachdenkt über sich, die Liebe, das Eins- und das Entzweitsein.
Wer hat da den Schlüssel? Wer kennt diese Denk-Fallen nicht? „Liebst Du mich / auch wenn ich nicht / so strahlend bin?“, fragt er gleich im ersten Gedicht. „Zu weilen wäre genug / dass Du nicht gehst.“
Sage man das mal und bekomme dafür keine Verstörung serviert. Denn immer schaut ja nur ein Ich auf ein anderes, nicht ahnend, was darin vorgeht. Wie kann man da vertrauen, wenn man jedes Wort und jede Geste auf die Goldwaage legt? Und immer im Zweifel über sich selbst steckt, wissend, dass alles imperfekt und behelfsmäßig ist – das ganze Leben. Und trotzdem schaut man sich selbst die ganze Zeit an, mit diesem anerzogenen Kontrolleur im Kopf: Mache ich denn alles richtig?
Oder wie in „Aus dem Leben eines Tonträgers“: „Ich habe mich in Betracht gezogen / Schon stehe ich unter Verdacht / Der Schatten wirft so / dass ich nur sehe / was er mich lässt.“
Verloren in der Zeit
Es ist ganz und gar nicht bequem, ein nachdenklicher Philosoph zu sein. Da wird dann eben so mancher Text auch zu einer philosophischen Exkursion, einem Nachdenken über Gott und die Welt, das, was ist und wie es einer er-lebt. Das werden zwangsläufig existenzialistische Texte. Die bis dahin gehen, wo auch die Astronomen bedauernd feststellen: Da sind die Grenzen unserer Erkenntnismöglichkeiten. So wie in „Handzeichen“: „Was bedeutet Leben / wenn die Zeit / wenn alle Zeit / hier und jetzt versammelt ist?“
Da kann so mancher Text schon ins Fatalistische, aber auch ins Melancholische münden. Denn wenn einer erst einmal so beharrlich übers Existieren nachdenkt, dann ist das Vergehen nicht weit. „Mitten im Vergehen der Zeit / sind wir ihr Überbleibsel schon“, schreibt er in „In den Abgrund und nichts gesehen“. Stimmt: Der Abgrund lauert überall. Auch wenn es keiner ist, sondern nur eine verpasste Gelegenheit, ein verweigerter Augen-Blick. Wobei er gerade hier, nachdem er so heftig über die Zeit nachgedacht hat, das ehrlichste Wort dafür findet: „Beim nächsten Mal …“
Denn auch wenn so mancher glaubt, er lebte im Augenblick: Es stimmt nicht. Wir leben alle in Erwartung des nächsten Mals. Das kann dann trotzdem schiefgehen. Gerade dann, wenn wir mit romantisch schillernden Augen in die Zukunft schauen und denken, sie müsste uns auch romantisch kommen: „Mein Lieben, wie zart es sich ahnt / wird Worte finden und suchen den Klang, / der mir alles war.“ („wieder alles werden“)
Man merkt: Auch in diesem sonst so über-aufmerksam nach-denkenden Philosophen steckt ein Romantiker, der den so schön klingenden Wörtern auf den Leim gehen kann. Obwohl er es besser weiß. „Ich bin der Lauf / meines Lebens nicht / dokumentiert, aber schlecht“, schreibt er in „Keine Lehre mehr“. Es lohnt sich, bei solchen Versen innezuhalten. Auch für all jene, die glauben, sie wären ihr Lebenslauf. Oder andere Leute wären, was in ihren Lebensläufen aufgelistet ist.
Wo wächst das Rettende?
Wer des Öfteren Gedichte liest, weiß, dass es so nicht ist. Dass wir uns sogar verlieren, wenn wir uns in die Schablonen üblicher Lebensläufe stecken lassen. Was uns wirklich bewegt, umtreibt, aufwühlt – die Dichter versuchen es irgendwie zu packen. Manchmal sind sie dicht dran. So wie Hölderlin, den Schollmeyer aufgreift mit einem seiner berühmtesten Verse aus „Patmos“.
Nur dass er in den Worten schon den doppelten Boden sieht: „Wächst aber auch das Rettende / Wo nichts als Wachstum / retten kann?“ Die ganze Hölderlinsche Zuversicht in Scherben. Obwohl Hölderlin sich so etwas beim Verwenden des Worten „wächst“ natürlich nicht dachte. Zu seiner Zeit war es ganz und gar noch positiv besetzt. Noch kein Schimmer davon, dass menschliche Entgrenzung mit einem falschen Wachstumsdenken die Welt zerstören könnte. Kann der Mensch aber, „weil keines je genügen kann“. Übermaß und Entgrenzung. „Verwagnis“ hat Schollmeyer dieses Gedicht genannt.
Das natürlich auch von einem Befremden erzählt. Denn dass man seine Zuversicht nicht auf den großen Retter setzen sollte, das ist ihm schon klar. Auch wenn so mancher Vers – gerade in „in tempus“ – sehr biblisch klingt. Das liegt ja manchmal auf der Zunge. „Wer stürzte denn nicht / da er fiel in die Welt / und aus ihr heraus / in hallende Weite …“, heißt es in „Mit dem Wind“.
Es wird sehr stürmisch, wenn wir uns – zumindest in Gedanken – dem Kosmos zuwenden, dem großen Sein, in dem wir durchaus verloren gehen können. In „Schnee zu Kuss“ darf die Geliebte ihn auch einen Romantiker schelten. Es steht tatsächlich so da. Aber da gibt es auch den Vers, der die ganzen kosmisch-dunklen Gedanken aufhebt. Denn so ist es im Leben: „Noch die Getrennten erwachen / zusammen verschlafen verschönt / Sonne bei leicht über Null / Vor uns ein Tag / Was wir auch tun / Unser Leben.“
Die Sache mit den Schwänen
Genau das. Das, was wir anschauen und wahrnehmen, ist unser Leben. Doch dafür müssen wir es auch anschauen. Gelegentlich und so oft wie möglich. Sonst ist es vorbei. „Verwage mich doch!“, ruft er in einem der dann doch total romantischen Nicht-mehr-Liebe-Gedichte („Verzittern“), in dem er auch Goethe noch anklingen lässt: „Verwahre Dich / Du bist so schön.“
Da hat die Verschollene wohl recht gehabt mit dem Romantiker.
Dabei wollen die Schönen oft einfach, dass einer den Frühstückstisch deckt und den Müll runterbringt. Die Schwäne müssen sich ihr Gedicht übrigens mit den Schwalben teilen. Und kommen nicht zum Zug, weil sie verschwimmen: „Ein anderes wird so wie so das Gedicht“. Denn um die Schwäne geht es gar nicht, sondern um das Gedankenwerk des Philosophen: alles erkennen zu wollen.
Nach-Sinn-Gedichte also. Als wären sie beim Spazierengehen entstanden. Beim Nach-Sinnen über Erlebtes, Gesehenes, Gespürtes, Gesagtes. So wie in „Du fehlst“. Das kennt so mancher. Denn nichts stellt uns mehr infrage: „Dann ziehe ich Dinge / Grund legend in Tracht / Breche hinaus in Gedanken …“
Manchmal kann man diese Gedanken nicht ausschalten. Dann drängen sie ins Gedicht. Und suchen nach Sinn. Werden zu Sinn-such-Gedichten. In denen auch Schwäne vorkommen können, ziemlich verschwommen, weil sich immer andere Gedanken dazwischenschieben und dem Gedicht eine völlig andere Wendung geben.
Friedrich Schollmeyer „Die Schwäne sind verschwommen“, Thelem Universitätsverlag, Dresden und München 2022, 16,80 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
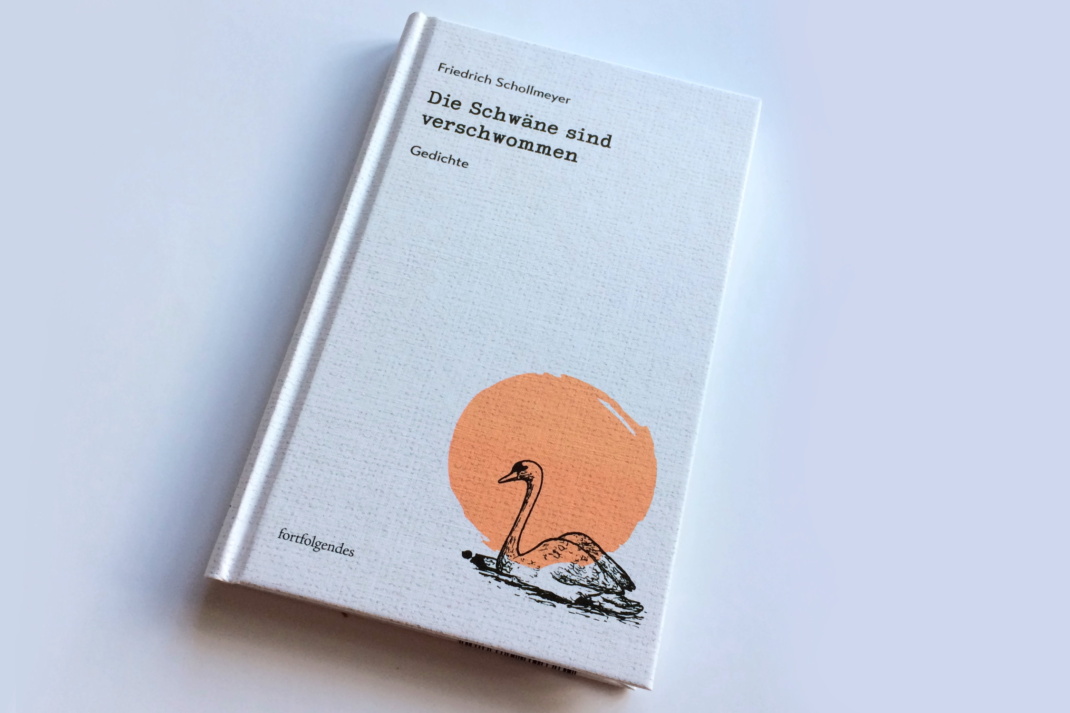

























Keine Kommentare bisher