Fast wäre man geneigt zu schreiben: „Hej, die kürzeste Geschichte Russlands hat doch Gustave Doré 1854 schon geschrieben und illustriert!“ Denn irgendwie scheint ja doch wieder alles nach altem Schema zu laufen, versucht sich ein Zar mit Kriegen gegen die Nachbarn zu profilieren. Und zu Hause sorgen die Palastwächter für Ruhe im Kreml. Aber natürlich läuft Geschichte nicht so einfach.
Auch wenn sie ihre Muster hat und ihre großen Narrative, die immer wieder auch die Gegenwart und die Aktionen der Menschen zu bestimmen scheinen. Solche Narrative kennen auch England und Deutschland, wie James Hawes in seinen zwei „kürzesten Geschichten“ über diese beiden Länder erzählen konnte.
Oft steckt die frühe Staatenbildung in diesen Geschichten. Genauso wie der lange Weg zur staatlichen Einheit und dem Land, das sich irgendwie seinen Platz zwischen all den anderen Ländern gesichert hat. Legendenbildung gehört zwingend dazu. Da werden Könige und Großfürsten zu geradezu mythischen Gestalten gemacht, alte Schlachten zur Geburtsstunde der Nation hochstilisiert und eine Art Nationalcharakter erfunden, der dann scheinbar alle Höhen und Tiefen in dieser Geschichte der Staatswerdung erklärt.
Wozu sind Kriege da?
Das ist auch bei den Russen so. Nur dass ihr Prozess, ihren Platz unter den Staaten Europas zu finden, augenscheinlich länger dauert als bei den kleineren Staaten im Westen. Und wesentlich blutiger verläuft. Und wenn man Mark Galeottis Interpretation all dieser oft sehr blutigen Kapitel liest, liegt der Eindruck natürlich nahe, dass dieser Prozess noch lange nicht beendet ist. Dass also auch Gustave Doré nur ein Zwischenkapitel erzählte – sehr bildhaft, sehr aus europäisch-französischer Perspektive. Damals noch unter dem Eindruck des gerade stattfindenden Krimkrieges.
Aber auch der Krimkrieg ist Teil dieser russischen Suche nach einem tragenden Narrativ, das das Land vielleicht einmal zur Ruhe kommen lässt, sich seiner selbst und seiner Unverwechselbarkeit bewusst werden lässt und nicht mehr besorgt darum, dass es von seinen Nachbarn bedroht oder gar aufgefressen werden könnte.
Und dabei schrieb der britische Historiker Mark Galeotti den Hauptteil seines Buches 2018 / 2019. Erschienen ist die „Short History of Russia“ 2021. Für die deutsche Ausgabe hat sie Galeotti noch einmal aktualisiert, den Schlusssatz hat er im März 2022 geschrieben, als Putins Überfall auf die Ukraine noch frisch war, die russischen Truppen aber schon ihre ersten Niederlagen erlebten.
Es passte nur zu gut in die Geschichte, die Galeotti schon 2021 erzählt hatte, die auf ihre Weise nur zu plausibel ist. Dass er sich dabei auf Kolleginnen und Kollegen aus der Historikerzunft stützt, die sich mit jedem einzelnen Kapitel der russischen Geschichte intensiv beschäftigt haben, merkt er unter jedem Kapitel extra an und empfiehlt den wirklich interessierten Lesern die veröffentlichten Standardwerke zum Weiterlesen.
Die Faszination Europa
Aber wer noch nicht in der Materie zu Hause ist, für den ist Galeottis Tour durch 1.000 Jahre russischer Geschichte da und dort ganz bestimmt eine Neuentdeckung. Und natürlich eine Antwort auf etliche Fragen, die auch in der Gegenwart immer wieder auftauchen. Gern auch vom russischen Präsidenten selbst beantwortet, der gerade in den letzten Jahren immer wieder damit auffiel, dass er sich seine eigene Version der russischen Geschichte zusammenbastelte, die dann zur Begründung all der Kriege wurde, die er bis heute schon angezettelt hat.
Acht Kriege zeigt die Karte auf Seite 232, die allein auf das Konto von Wladimir Putin gehen. Jeder erzählt im Grunde vom Versuch einer Großmacht, die sich durch Kriege und Strafaktionen zu profilieren versucht und gleichzeitig die alten Geschichten neu erzählt, mit denen sie sich den „Westen“ und all seine Ideen als Gegenentwurf zur eigenen Rolle als Bewahrer der eigentlichen christlichen Werte markiert. Auch Putins Propaganda vom dekadenten Europa ist nicht neu. Immer wieder begegnet man in der russischen Geschichte dieser halb faszinierten, halb mitleidigen Beschäftigung mit dem Westen.
Historiker um Historiker begegnet diesem seltsamen Phänomen, das die Bewunderung für europäische Technik und Kultur immer wieder paart mit Verachtung, dem gepflegten Gefühl von Ausgeschlossensein und dem Vorwurf tiefster Rückständigkeit über Jahrhunderte hin. Was Gründe hat – auch in der riesigen Ausdehnung des Landes, seiner jahrhundertelangen Zerstückelung und dem langen Festhalten an der Leibeigenschaft, die bis ins späte 19. Jahrhundert dafür sorgte, dass 96 Prozent der Russen noch immer in feudalen Fesseln leben mussten und nur eine winzige Elite tatsächlich an den kulturellen und intellektuellen Entwicklungen Europas teil hatte.
Die Angst vor den Zeiten der Wirren
Zar um Zar scheute davor zurück, die erstarrten Verhältnisse zu ändern. Denn die Bauernbefreiung hätte auch die Machtbasis und die Geldeinnahmen der Zaren ins Wanken gebracht. Und mutige Reformer gab es auf russischen Thronen zu wenige. Und so suchten die größten und berühmtesten Großfürsten, Zaren und Zarinnen ihren Ausweg fast immer darin, einen Löwenanteil der Steuereinnahmen in Armeen und Privatmilizen zu stecken, um damit ihre Macht im Inneren genauso zu festigen wie sie damit mal mehr, mal weniger erfolgreiche Kriege gegen die Nachbarn, aber auch diverse Usurpatoren führten.
Denn die russische Schwäche rief auch immer wieder allerlei Kriegsherren auf den Plan, die glaubten, dass Russland eine leichte Beute wäre. Und für die Mongolen, die die Rus tatsächlich über 200 Jahre lang beherrschten, war es auch ein Leichtes. Übrigens aus einem ähnlichen Grund, warum Italien oder Deutschland über Jahrhunderte Spielfeld diverser kriegslüsterner Monarchen war – denn die Rus als einheitliches Gebilde gab es über Jahrhunderte nicht.
Es gab zehn mehr oder weniger mächtige Fürstentümer, deren Fürsten ihre Stellung auf den legendären Rjurik zurückführten, hinter dem möglicherweise die tatsächlich historische Gestalt eines dänischen Adligen stand, der im Osten sein Glück und sein eigenes Fürstentum suchte. Die ältesten und einst mächtigsten dieser Fürstentümer waren die Kiewer Rus und das Fürstentum von Nowgorod. Es dauerte Jahrhunderte, bis das kleine Dorf Moskau sich zum neuen Mittelpunkt dieser Reiche entwickelte und das Fürstentum von Wladimir-Susdal quasi zum Vorläufer des späteren Zarentums.
Im Buch begegnet man all den Heldengestalten der russischen Geschichte, aber auch der historischen Dekonstruktion dieser alten Erzählungen. Und schon früh begegnet man Legenden, die schon zu ihrer Zeit echte „fake news“ waren, seien es die Briefe der „aufgeklärten“ Zarin Katharina II. an ihre westeuropäischen Briefpartner, wie gebildet und wohlhabend die Russen schon wären, seien es die falschen Dimitris, die immer dann auftauchten, wenn die Thronfolge wieder einmal unsicher war, sei der Glaube an die eigene Unbesiegbarkeit, der nach dem Sieg über Napoleon geschürt wurde.
Und er dann im Krimkrieg so gründlich baden ging, weil sich herausstellte, dass die russische Armee mit der modernen Technik der Kriegsgegner England und Frankreich nicht mithalten konnte.
Ein nicht reformierbares Land?
Eine nicht ganz neue Erfahrung für die russischen Herrscher, die im Lauf der Geschichte immer wieder riesige Anteile des Nationaleinkommens in ihre Armeen gepumpt hatten und damit die Bauern immer noch mehr ausgeplündert haben, ohne dass daneben eine tragfähige Wirtschaft entstand. Aber starke Armeen brauchen immer auch eine starke ökonomische Basis. Wenn sie aus dem laufenden Haushalt eines Landes finanziert werden müssen, das ganz auf landwirtschaftliche Produkte und Rohstoffe setzt, geht das sehr schnell an die Substanz. Das erlebten die Wladimire und Nikolause auf den Zarenthronen genauso wie die spätere Sowjetunion, an deren Reform sich der erst jüngst verstorbene Michael Gorbatschow ja bekanntlich die Zähne ausbiss.
Und es überrascht nicht, dass auch er quasi durch einen (friedlichen) Putsch aus der Macht gedrängt wurde und ein neuer Dimitri zum Herrscher aller Reußen wurde, auch wenn der in diesem Fall Boris hieß und das Land einer ökonomischen Ochsenkur unterzog, die am Ende einen neuen starken Mann an die Spitze brachte. Putins Aufstieg findet erstaunlich viele Parallelen in der Geschichte Russlands. Und das hat Gründe, strukturelle und historische.
Denn eine Demokratisierung und Selbstverwaltung, wie sie westeuropäische Staaten im Lauf der Geschichte allesamt entwickelt hatten, gab es in Russland nicht. Alles wurde zentral gesteuert und die Machtinstrumente der Herrscher waren von Anfang an eine starke Armee, eine zunehmend straffer ausgebaute Bürokratie und seit dem 19. Jahrhundert auch ein mächtiger Geheimdienst, der alle freiheitlichen und liberalen Bestrebungen unterdrückte und auch eliminierte.
Dass diese Strukturen dann unter den in der Revolution von 1917 siegreichen Bolschewiki wieder auferstanden, verblüfft natürlich. Auch Lenin hatte eigentlich eine andere Vision vom ersten sozialistischen Staat auf der Erde. Aber recht behalten hat am Ende Karl Marx, der schon 50 Jahre vorher festgestellt hatte, dass Russland mit seiner rückständigen Wirtschaft ganz bestimmt kein Kandidat für ein sozialistisches Experiment war.
Die Schule der Gewalt
Und wer immer noch glaubt, das, was da bis 1990 im Osten als Sozialismus oder Kommunismus praktiziert wurde, wäre tatsächlich das Original, merkt beim Lesen dieser kurzen Geschichte, dass da viel mehr vom alten, zentral und gewalttätig agierenden russischen Zarismus drin steckte, als die „führenden Genossen“ je zugegeben hätten. Auch wenn sie ihre Thronfolgen am Ende ähnlich organisierten wie die teils dramatischen Thronfolgen in der Zarenzeit. Und sich genauso auf eine Nomenklatura stützten, die mehr mit dem alten Bojarenwesen zu tun hatte, als in der „Prawda“ zu lesen sein durfte.
Und letztlich verblüfft es auch nicht, dass Russland immer wieder zu den alten Formen der Machtausübung zurückkehrte, die immer wieder wie eine Rettung aus den „Zeiten der Wirren“ wirkte, die Russland in ein Chaos stürzten, weil ohne straffe Zentralgewalt scheinbar alles drunter und drüber ging. Putin galt vielen Russen tatsächlich als der Retter aus einer Zeit des Chaos der 1990er Jahre.
Nur bekommt man das eine eben nicht ohne das andere, einen neuen Gewaltherrscher nicht ohne Gewalt. Denn der Apparat, der solche Männer kürt und trägt, verlangt auch seine immer neuen Beweise, dass der auserkorene Mann bereit ist, Härte zu zeigen. Und das hat Putin von Anfang an getan, auch wenn das aus europäischer Perspektive alles so weit weg war, dass man es nicht wirklich für bemerkenswert hielt – sein über zehn Jahre geführter brutaler Krieg in Tschetschenien, der Einmarsch seiner Truppen in Georgien, der Einsatz Russlands ab 2015 in Syrien …
Selbst die Zugriffe auf die Krim und die Ostukraine 2014 hat man aus europäischer Sicht noch nicht als so bedrohlich wahrgenommen. Seit aber Putins Truppen versuchen, die Ukraine als ganzes zu erobern, wird auch den Westeuropäern klar, dass der Mann nicht nur von seiner ganz speziellen Version der russischen Geschichte besessen ist.
Jetzt bekommen auch seine schon länger geführten Cyberkriege und Propagandakriege gegen westliche Staaten eine andere Bedeutung. Denn wenn so ein Mann (und diejenigen, die ihm überhaupt erst zur Macht verholfen haben), überzeugt sind, wie einst Zar Nikolaus jede demokratische Bewegung im Westen bekämpfen zu müssen, dann schwingt sich das heutige Moskau wieder zur erzreaktionären Schutzmacht auf. Und nicht nur in Polen und den baltischen Ländern, in die in der Vergangenheit immer wieder russische Truppen eingefallen sind, werden alte Erinnerungen wach.
Gefangen in alten Heldengeschichten
Das gehört dann zu den nationalen Geschichten eben dieser Länder. Geschichten, die aus historischer Erfahrung geschmolzen wurden und damit auch heutiges Handeln prägen. Geschichten, die sich normalerweise aber auch ändern, ersetzt werden durch neue Narrative, die auch neue Erfahrungen aufnehmen. Wer heute noch mit den Narrativen des Wilhelminischen Reiches ans Rednerpult tritt, wirkt nun einmal wie ein Überbleibsel der Vergangenheit und nicht wie einer, der eine heute noch lebbare Geschichte erzählt.
Genauso aus der Zeit gefallen wirken natürlich auch Putins historische Schreibversuche. Denen man auch anmerkt, dass er nicht wirklich begriffen hat, dass sich Geschichte nicht wiederholt. Und wenn, dann meistens als Farce, wie Karl Marx ja schon schrieb, den Galeotti mehrfach zitiert.
Die entsprechende Stelle etwas ausführlicher: „Doch die Geschichte ist ein Fluss, der nie rückwärts fließt, und, um Marx ein allerletztes Mal zu zitieren, sie wiederholt sich ‘das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce’. Die Russen von heute sind nicht die Russen der 1970-er Jahre, und da die Sanktionen ihnen die direkte Verbindung nach Europa erschweren und der Kreml versucht, noch weitere zu kappen, wissen sie, was auf dem Spiel steht.“
Denn in der ganzen Geschichte steckt auch über Jahrhunderte der immer neue Versuch, sich nach Europa zu orientieren, dort zu lernen und ein Teil der europäischen Völkergemeinschaft zu werden. Auch die Idee des Sozialismus, die Lenin 1917 umsetzen wollte, war ja eine zutiefst westeuropäische Idee – die an den Realitäten eines Landes scheiterte, das dafür weder die ökonomische Basis noch die nötige Bildungselite hatte.
Statt Sozialismus gab es Kriegskommunismus und Roten Terror. Und so richtig hat das bis heute nicht aufgehört, weil die Machteliten in Moskau und Petersburg selbst einem inzwischen gebildeten Volk nicht zutrauen, sich selbst zu verwalten. Sodass man im Grunde immer noch ein System hat, das mit feudalen Abhängigkeiten regiert wird und bei dem „starke Männer“ (Silowiki) hinter den Kulissen bestimmen, wer Zar sein darf – oder eben nicht (mehr).
Wenn Vergangenheit zum Mythos wird
Aber all das wirkt immer rückständiger, erst recht im Vergleich mit all den osteuropäischen Staaten, die ihre eigenen Narrative sämtlich modernisiert haben und sich vehement gegen die Brutalität der Herrscher im Kreml wehren. Es ist, als müssten Nationen tatsächlich erst erwachsen werden und ihrer selbst bewusst, bis sie auf die paternalistischen Mythologien verzichten können. Und auf den falschen Glauben daran, die anderen wollten einen immerzu nur vernichten und auffressen. Das Heilige Russland also einfach auslöschen.
Aber so wird man nie gelassen, braucht immerzu eine riesige Armee und steckt den Reichtum des Landes in eine militärische Aufrüstung, die irgendwann die Frage mit sich bringt, gegen wen man mal wieder Krieg führen könnte, damit das Spielzeug mal zu Einsatz kommt.
Es bleibt eine tiefe Trauer um das russische Volk, das in all diesen Mythen und Geschichten immer nur Kanonenfutter, Leibeigener und Strafarbeiter war, in Massen eingesetzt, um die imperialen Träume der Herrscher im Kreml zu verwirklichen – seien es Bauern, die für Peter den Großen Sankt Petersburg aus dem Boden stampfen mussten, seien es die Heere der Zwangsarbeiter, die für Stalin die Industriellen Vorzeigebauwerke des Sozialismus bauen mussten.
Die Geschichte könnte auch anders weiter gehen, merkt Galeotti an. Sie muss nicht in den alten Narrativen stecken bleiben und immer neue sinnlose Schleifen drehen.
Ob sie in nächster Zeit anders erzählt wird, weiß niemand. Noch scheint alles, was passiert, die alten Erzählweisen zu bestätigen, weil es die Erzählungen jener Elite sind, die in Moskau regiert. Und die ihr Bild von russischer Geschichte auch zum maßgeblichen in Schulen und Lehrbüchern gemacht hat. Ganz wie in Orwells „1984“, der ja ebenfalls recht gut wusste, wie die Genossen tickten. Und der durchaus auch wusste, wie gefährlich es ist, wenn alte Narrative zum Maß der Gegenwart gemacht werden. Oder gar immer wieder umgeschrieben werden, bis nur noch die mythische Geschichte des Großen Bruders existiert.
Mark Galeotti „Die kürzeste Geschichte Russlands“, Ullstein, Berlin 2022, 12,99 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
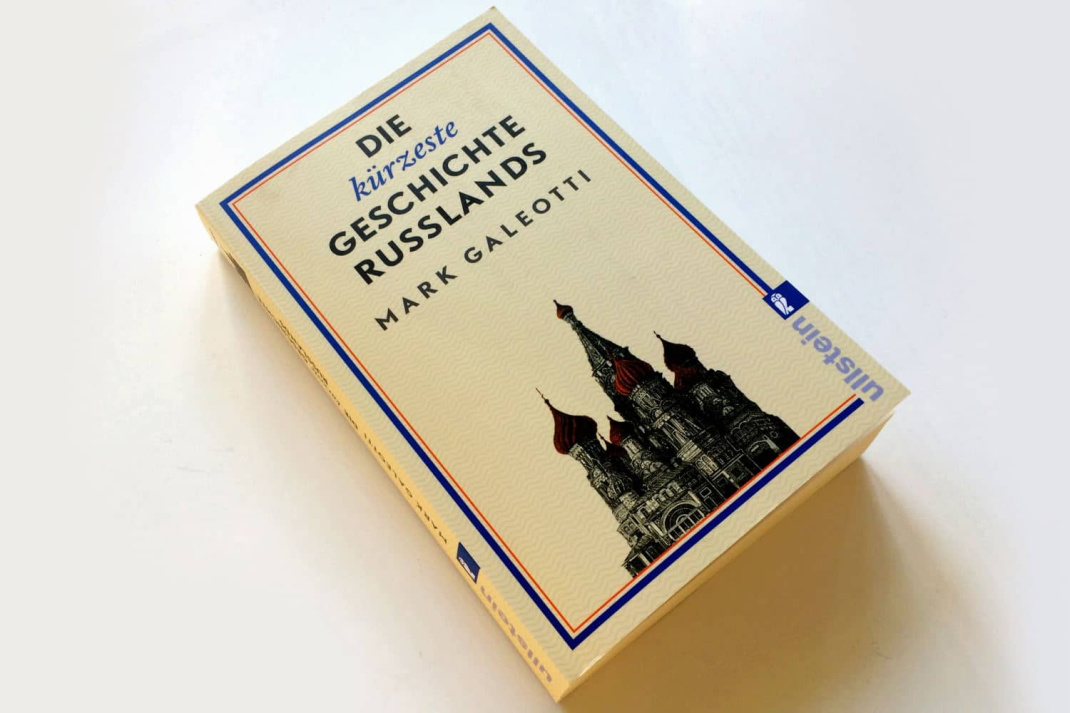























Keine Kommentare bisher