Es ist ein spannendes Buch – auch in seinem Scheitern. Dabei steckt es schon im ersten Satz von Ingolf U. Dalferth in seinem Vorwort, in dem er auf die „merkwürdigen Züge theologischer Staats- und Gesellschaftsreflexion“ eingeht, die immer wieder versucht, die verschiedenen Formen politischer Herrschaft „theologisch zu legitimieren“.
Dalferth ist selbst Theologe. Was er freilich tatsächlich in diesem Buch versucht, ist die Analyse einer gefährdeten Demokratie, die unter einer zunehmenden Zersplitterung der Öffentlichkeit leidet. Ohne eine öffentliche Debattenkultur zerbröselt die Demokratie.
Und natürlich hat er recht damit, wenn er schreibt: „Das Aufklärungsmythologem von der Mündigkeit der säkularen Vernunft war immer schon zu optimistisch. Es heute noch zu vertreten, kommt einer Selbsttäuschung gleich. Die Welt ist anders, als gedacht wird, die Wirklichkeit dunkler, die Vernunft dürftiger. Menschen sind krummes Holz, wie Kant sagte, und ein Konzept von Demokratie, das davon absieht und sich die Menschen so entwirft, wie man sie gerne hätte, ist wirklichkeitsfremd.“
Und das trifft gerade auf unsere heutige Konsumgesellschaft zu, in der auch Politik wie „heiße Ware“ verkauft wird – nicht mit Sachargumenten, sondern mit dem Anstacheln von Emotionen. Dalferth: „Doch das Publikum der Massengesellschaften besteht nicht aus selbstbestimmten Subjekten, sondern Konsumenten, die nicht durch Argumente, sondern Emotionen mobilisiert werden.“
Die notwendigen Grenzen der Freiheit
Hier spielt die Frage der Freiheit hinein und wie wir über Freiheit denken. Dalferth greift hier auf die alten Griechen zurück, die einen sehr deutlichen Unterschied definiert haben zwischen Demokratie und Ochlokratie. Beide scheinen auf dasselbe hinauszulaufen. Doch sie definieren Freiheit jeweils völlig anders. Und das, was etliche politische Spieler heute als Freiheit promoten, führt letztlich fast automatisch in eine Ochlokratie.
Insbesondere in dem Kapitel, in dem er die Vieldeutigkeit des aus der amerikanischen Verfassung stammenden „We, the People“ diskutiert, geht Dalferth auf den heute so oft anzutreffenden falschen Freiheitsbegriff ein. Denn auf den ersten Blick klingt es logisch, die eigene Freiheit dadurch zu definieren, dass sie schlicht da endet, wo sie die Freiheit der anderen tangiert.
Aber schon hier steckt ein Denkfehler, wie Dalferth feststellt: „Wer die Grenzen der eigenen Freiheit nur in der Freiheit der anderen sieht, der sieht die anderen nur als eine störende Begrenzung der eigenen Freiheit, die man hinzunehmen hat, um die anderen nicht zur permanenten Gefahr der eigenen Freiheit und des eigenen Lebens werden zu lassen.
Andere sind stets potenzielle Gegner, die man nur dadurch einigermaßen in Schach halten kann, dass man sich auf Kompromisse einlässt. Man schränkt die eigene Freiheit ein, um nicht alles zu verlieren. Ein so konstituiertes gemeinsames ‚Wir‘ ist stets ein brüchiges Gebilde, das durch die Furcht vor den anderen als das kleinere Übel legitimiert wird. Ideal wäre es, wenn man alles allein entscheiden könnte.“
So ziemlich jede Spielart des Populismus funktioniert genau so und definiert die Gesellschaft letztlich als eine immerfort von Konkurrenz und Überlebenskampf dominierte. Diese Denkweise über Freiheit setzt das Subjekt absolut und definiert Gesetze als Zwangsmaßnahmen.
Wenn „the People“ sich Gesetze gibt
Aber auch auf die Gesetze geht Dalferth ein. Recht ausführlich, weil er natürlich auch das imaginäre Dritte sucht, das eine Demokratie und den Bezugsrahmen für ihre Bürger definieren kann. Eine Stelle, an der er natürlich diskutiert, was eigentlich das Gefährdetsein des Menschen, Bürgers und – theologisch betrachtet – des Geschöpfes ausmacht, was ihn bedingt und einschränkt. Denn ohne freiwillige Selbstbeschränkungen funktionieren menschliche Gesellschaften nicht. Genau sie sind die Grundlagen der Freiheit.
„Hier hat das ‚We, the People‘ seinen unverzichtbaren Ort“, schreibt Dalferth. „Nur wer sich selbst Gesetze geben kann, ist frei, und nur wer beachtet, dass wir nicht frei sind, willkürlich über uns selbst zu bestimmen, sondern die Bedingungen zu respektieren haben, unter denen wir existieren, ist vernünftig im Gebrauch seiner Freiheit.“
Im nächsten Satz holt er dann zwar wieder „Gottes Gegenwart“ in den Text. Aber er braucht ihn nicht, auch wenn er viele Seiten darauf verwendet, ihn irgendwie doch ins Spiel zu bringen. Aber schon der Verweis auf die Gesetze macht deutlich, dass es Religion nicht braucht, um den Menschen in seinem In-die-Welt-Gesetztsein zu fassen.
Das können gläubige Menschen durchaus mit Gott erklären. Aber es gibt die scharfen Differenzen zwischen Gläubigen und Ungläubigen, Rationalen und an allerlei Dinge glaubenden Menschen so nicht. Siehe oben: die Menschen, wie sie sind. Oft eben auch unvernünftig, gutgläubig, in eine Filterblase abgetaucht, durch Emotionen getrieben, von Vorurteilen geplagt, von Krankheiten, Armut, Reichtum, Ängsten und Sorgen.
Demokratie braucht Fehlerkultur
Weshalb Demokratien eben nicht durch absolute Vernunft funktionieren. Was man sich ja wünschen kann. Aber das würde nicht funktionieren. Sie funktionieren durch Mehrheiten und Emotionen. Und sie funktionieren dadurch, dass sie den Mechanismus zur Selbstkorrektur haben, wenn sich die Ansicht einer Mehrheit auf einmal als falsch erweist. Sie sind nicht fehlerfrei. Können sie nicht sein.
Sie sind im guten Fall ein Weg, die menschliche Fragilität und Verletzlichkeit aufzufangen, wie Dalferth feststellt: „Unter den politischen Herrschaftsformen gibt es keine, die das besser ermöglichen und bestätigen würde als eine Demokratie, in der das Volk demos und nicht ochlos ist, seine Bedingtheit, Grenzen, Fragilität, Gefährdung und Verbesserungsnotwendigkeit also anerkennt und nicht ignoriert.“
Autokraten halten sich nie für verbesserungsnotwendig oder gar fehlbar, Demokraten schon. Weshalb die Demokratie die vernünftigere Regierungsform ist. Mit allen Fehlern, die immer menschliche Fehler sind. Und eben auch Fehler, die alle gemeinsam machen. Keiner ist außen vor oder „hat damit nichts zu tun“.
Oder mit den Worten Dalferths: „Demokratien bauen nicht auf Wahrheiten, sondern auf der geregelten Übergabe von Macht, sie kennen keine Majestäten, sondern Mehrheiten und Minderheiten. Die Mehrheiten sind aber nicht immer die, die recht haben, und die Minderheiten nicht die, die falschliegen.“
Demokraten brauchen gute Begründungen
Aber Veränderungen funktionieren nicht, wenn der öffentliche Diskurs nicht funktioniert. Der nicht immer vernünftig sein muss, wie Dalferth feststellt. Aber fair und gleichberechtigt muss er sein. Und alle im Gespräch Beteiligen müssen bereit sein, ihre Argumente zu begründen und auch die Argumente der anderen wenigstens verstehen zu wollen.
Wer nicht zuzuhören bereit ist, zerstört den Dialog. Leider ein Effekt, den die „social media“ befördern. Was sie nicht sind, ist eine Agora, auf der Menschen unterschiedlichster Positionen miteinander unter fairen Regeln diskutieren können. Das ist dort schlicht nicht möglich, schon weil viele Nutzer dieser Plattformen kaum noch mit anderen Positionen und Gruppen konfrontiert werden. Man bleibt in der eigenen Gruppe, wo Haltung und Weltsicht für absolut gesetzt werden. Und fällt wütend über jeden her, der anders denkt.
Das hat mit Demokratie nichts mehr zu tun. Demokratie hat auch viel mit Bescheidenheit und Demut zu tun. Was ja Dalferth dazu animiert, immer wieder eine religiöse Dimension ins Gespräch zu bringen. Aber auch das ist etwas, was ins Persönliche gehört. Vielleicht nicht ins Private, weil natürlich auch religiöse Menschen die Öffentlichkeit suchen und ihre Sichtweise respektiert sehen möchten.
Aber anders als es Dalferth diskutiert, war die Trennung von Staat und Kirche auch eine Herstellung von Gleichheit aller Bürger, der Ungläubigen, Zweifler, Theisten, Atheisten, Tiefreligiösen, Wundergläubigen, Klugen und der nicht so Rationalen. Denn so richtig haben viele Theologen noch nicht akzeptiert, dass in der Berufung auf die Vernunft (die Dalferth im Buch insbesondere mit Kants Kritik dazu thematisiert) keine Elitisierung der nichtgläubigen Ratio ist, sondern die Herstellung einer modernen Gleichheit, die religiös definierte Gesellschaften so nicht kennen. Und dass diese durchaus ihre Schattenseiten haben, merkt der Autor ja auch an.
Aber wenn die Aufklärung (oder mit Verweis auf Bertrand Binoche „die Aufklärungen“) eine wissenschaftliche Erkenntnis zur Folge hatte, dann war es die Erkenntnis der Fragilität unseres Daseins auf der Erde. Die menschliche Existenz ist von vornherein eine bedingte und eine prekäre. Niemand existiert aus sich selbst und ohne all die anderen. Egal, ob man sich als Geschöpf empfindet oder „nur“ als Mensch: Man ist (um diesmal Uwe Kolbe zu zitieren, der das etwas anders meinte) hineingeboren.
Die Überforderung des Da-Seins
Für Viele ist das ein lebenslanger Grund zum Staunen. Für viele aber auch eine Herausforderung und eine Überforderung. Denn um dieses Leben selbst auszufüllen, braucht man Kraft, Mut und die Bereitschaft, die Grenzen der eigenen Freiheit zu akzeptieren.
Grenzen, die – wie Dalferth feststellt – eben erst menschliche Freiheit ermöglichen. Erst in diesen Grenzen entsteht sie. Und deshalb haben es sich schon die frühen Zivilisationen angelegen sein lassen, sich Gesetze zu geben – gern mit Berufung auf ein Höheres Wesen, da funktionierte das besser.
Aber auch dann, wenn man alle Religion herausnimmt, bleiben diese Gesetze, die sich menschliche Gesellschaften selbst geben. Bis heute. Gesetze, die uns eben auch jeden Tag erzählen, dass wir auch irren können und „die Wahrheit“ nicht kennen.
Diese Gesetzgebung berücksichtigt eben, dass wir alle da sind, in all unserer Verschiedenheit. Vor dem Gesetz sind wir alle gleich. Aber auch nur dort. Die Demokratie setzt die Verschiedenheit der Menschen sogar geradezu voraus.
„Weil das so ist, sind wir nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir unterlassen“, schreibt Dalferth (ohne übrigens auf unsere Verantwortung in der aktuellen Klimakrise einzugehen). „Aber wir sind nicht verantwortlich dafür, dass wir da sind. (…) Wenigstens darüber brauchen wir uns nicht mehr zu streiten. Auch nicht darüber, dass wir dafür verantwortlich sind, wie wir da waren – in dem, was wir getan, und in dem, was wir unterlassen haben.“
Na hoppla: Auf einmal wird in der Freiheit unseres Seins die Verantwortung sichtbar – die wir für unser eigenes Leben haben und für die Gemeinschaft, in die wir hineingeboren wurden. Das kann schon eine gewaltige Last sein, wenn das schlechte Gewissen sich meldet. Es sind nicht die anderen schuld daran, wenn wir unser Leben nicht leben und keine Verantwortung für unser Tun übernehmen wollen.
Räume des respektvollen Umgangs
Einen Ausweg aus dem aktuellen Dilemma der öffentlichen Vernunft zeigt Dalferth erst einmal nicht auf. Aber er zeigt recht konsistent, wie sehr wir auf diese Herstellung des öffentlichen Raumes, in dem jeder zur Sprache kommen kann und das öffentliche Gespräch stattfinden kann, angewiesen sind.
Und wie gefährdet unsere Demokratie ist, wenn diese Räume des respektvollen Umgangs verloren gehen und durch Erregungsblasen ersetzt werden, in denen nicht das Gemeinsame, sondern das Anderssein dominiert, das Ausgrenzende.
Gerade weil alle so verschieden sind in ihrem Hineingeworfen sein in die Welt, „braucht es öffentliche Debatten um wichtige Themen und strittige Fragen.“ Erst in der Auseinandersetzung lernen wir und werden (hoffentlich) immer ein bisschen klüger, weil wir aus gemeinsamen Fehlern auch lernen.
Womit wir natürlich auf uns selbst zurückgeworfen sind. Das Buch wäre sogar viel schlanker und schlagkräftiger geworden ohne den Versuch, eine religiöse Dimension darin unterbringen zu wollen. Die braucht es nämlich gar nicht, auch wenn sie vielen Menschen durchs Leben hilft.
Ingolf U. Dalferth Die Krise der öffentlichen Vernunft Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2022, 25 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
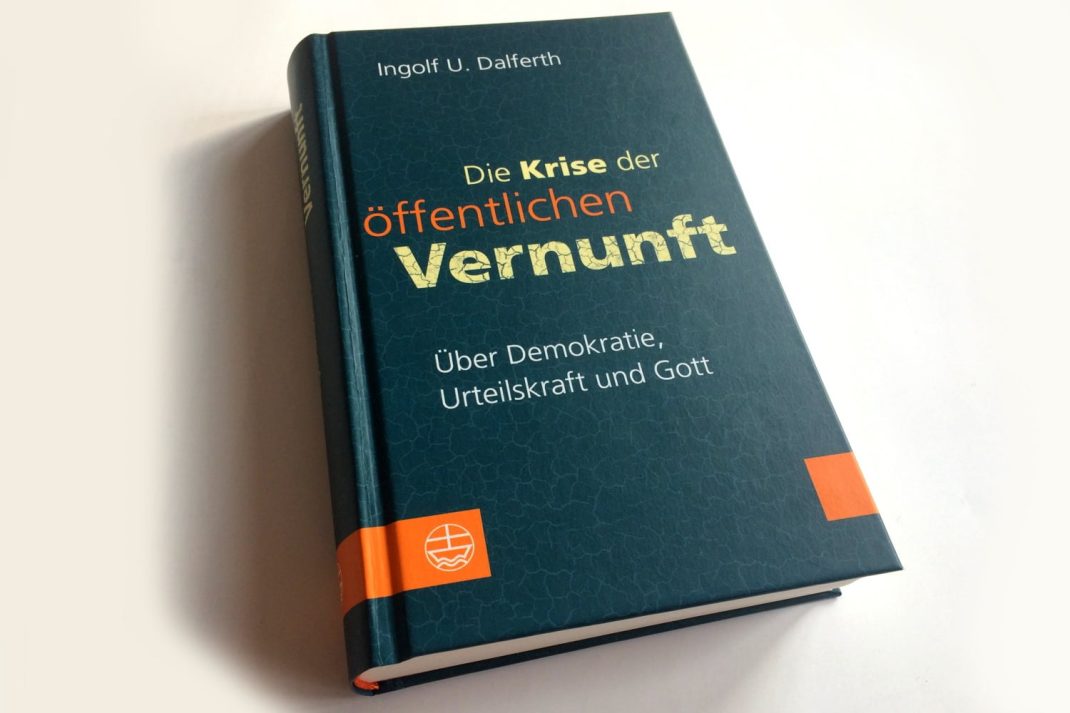

















Keine Kommentare bisher