Es ist eine verflixte Geschichte, auch eine tragische, die Carl-Christian Elze in seinem Romandebüt erzählt. Und es ist nicht die Geschichte, die der Klappentext verspricht – die Geschichte eines „fast erwachsenen Kindes“ und seines Wunsches „ein anderer zu sein“. Klar, den Wunsch haben viele, wenn sie 17 sind. Aber eigentlich steckt eine andere Frage dahinter.
Schein und Sein des spießigen Kleinbürgertums
Eine, die sich tatsächlich viele nicht beantworten. Es ist die Frage „Wer bin ich?“, die zwangsläufig auch die Frage „Wer möchte ich sein?“ einschließt.
Aber da frage mal wer mit 17 und finde jemanden, der einem das sagen kann. Schon gar in so einer Familie, in der der „Held“ der Geschichte aufwächst, Mutter, Gerd und Sohnemann. So eine richtige kleinbürgerliche Familie mit Garagenstolz und schönem Schein. Aber ganz offensichtlich unfähig, miteinander zu sprechen.
Denn scheinbar ist es nur Freudenberg selbst, dieser Sohn, der „nur gezwungenermaßen mit der Umwelt“ spricht. Aber was man von den Kontaktanbahnungen seiner Mutter und seines Vaters, der in dem Moment, als er vom Sohn nur noch mit Gerd angesprochen werden möchte, nur noch fremder wird, erfahren kann, ist geradezu grenzwertig.
Sprachlosigkeit in schönem Familienidyll
Obwohl: wahrscheinlich ist es auch sehr verbreitet. Familien, in denen schon frühzeitig etwas gründlich schiefgelaufen ist, als hätten sie alle nur ein mühsam aufrechterhaltenes Selbstbewusstsein, eine Fassade, die gegenüber der Mitwelt aufrechterhalten werden muss. Was im letzten Teil des Buches eine zentrale Rolle spielt, als Gerd alles deichselt, damit die Nachbarn im Dorf, von denen er – wenn die Wahrheit ans Tageslicht käme – geradezu die existenzielle Vernichtung erwartet, ja nicht erfahren, was Freudenberg tatsächlich getan hat. Oder auch nicht. Denn was wirklich passiert ist, will auch er nicht wissen.
Haben Kinder überhaupt die Chance, erwachsen zu werden, wenn es nicht mal ihre Eltern sind? Wenn am Abendbrottisch verkrampftes Schweigen herrscht, weil keiner sich traut, auch nur das Allernotwendigste zu sagen?
Es ist eine vertrackte Geschichte, weil sie mit Freudenberg einen jungen Mann in den Mittelpunkt stellt, der überhaupt nicht davon träumt, ein anderer zu sein. Dass er dann in die Klamotten eines verunglückten polnischen Jugendlichen schlüpft, passiert ihm eher, als dass er damit irgendeinen Plan verbindet. Er stolpert hinein in die Geschichte, merkt schon beim ersten Davonlaufen, dass er jetzt wohl etwas fürchterlich Falsches getan hat – und kann nicht mehr zurück.
Könnte er natürlich trotzdem. Aber genau das hat er nicht gelernt. Denn zu einem Ich wird man ja ernst, wenn man anfängt, sich das Recht zu nehmen, ein Ich zu sein. Sich also zu zeigen und auszuhalten, dass auch die eigenen Eltern damit nicht glücklich sind. Wobei das oft trügt. Denn dieses familiäre Schweigen, das man in Elzes Schilderungen atmosphärisch erleben kann, erzählt von drei Menschen an einem Tisch, die sich allesamt nicht trauen, aus der Deckung zu kommen.
Schönes Familienleben.
Aber wahrscheinlich in vielen Familien der Normalzustand eines schönen Scheins, in dem das, was die Nachbarn schwatzen könnten, immer viel wichtiger ist als das, was einen selbst bewegt, durchglüht und umtreibt. Weshalb so viele (wahrscheinlich nicht nur deutsche) Provinzen so piefig, verklemmt, verlogen und stockkonservativ sind. Locker schon gar nicht. Nirgendwo ist der Druck, eine erwartete Rolle zu spielen, größer.
Ein Leben ohne Inhalt
Selbst bei dem, was man so an jugendlichen Ausbruchsversuchen kennt. Nur hat dieser Freudenberg, dessen Vorname praktisch erst ganz am Ende wie beiläufig fällt, keine Freunde, kein eigenes Leben jenseits seines langweiligen Kinderzimmers und der Sprachlosigkeit im Umgang mit den Eltern. Er ist nicht einmal er selbst, scheint sich auch selbst bis fast zum Schluss als Freudenberg zu denken, ein Schauspieler in einer fremden Rolle – von Anfang an.
Wer so durchs Leben geht, wird natürlich zum Spielball, gerät in Ereignisse, die er nicht beherrscht. In peinliche Situationen sowieso, weil so ein Leben durch Peinlichkeiten strukturiert wird. Denn darin ist alles, was einen den Blicken Anderer aussetzt – also nackt dastehen lässt – peinlich. Für manchen heißt das: ein Leben lang Rollenspiel, der Versuch, eine Maske auszufüllen, in der man sich immerzu unpassend, zu klein, falsch vorkommt. Als maßte man sich etwas an, was einem nicht zusteht.
Denn eigentlich geht es ja in diesem verflixten 17. Jahr darum, sich selbst zu finden. Und das aus sich zu machen, was in einem steckt. Das ist kein leichter Prozess. Das wissen ja alle, die es durchgestanden haben – samt den heftigen Konflikten mit Eltern, die sich „maßlos enttäuscht“ zeigten.
Aber Freudenbergs Eltern können ja nicht einmal diese Enttäuschung zeigen, sie überspielen sie. Das Aufrechterhalten der Fassade ist wichtiger, auch wenn gerade Freudenbergs Mutter am Ende Gefühle offenbart. Nicht nur die einer heftigen Trauer um den für tot gehaltenen Sohn, sondern auch der Wut und der Verbitterung. Denn dass dieser Heimgekehrte nicht mal erzählen kann, warum ihm das passiert ist, das überfordert endgültig ihre Kräfte.
Leben wie ein Avatar
Es geht nicht nur um diesen jungen Mann, der auch am Ende nicht herauskommt aus seiner Sprachlosigkeit. Die eben nicht nur fehlende Fähigkeit zum Kommunizieren ist, sondern auch – das erzählen dann die letzten Szenen aus der Metallfabrik – unfähig ist, sich selbst zu schützen. Als spielte er gar keine Rolle in dieser Welt, als wäre da eine nicht zu überwindende Distanz zwischen dem, was er mit den Sinnen aufnimmt, und dem, was dann als Botschaft im Körper ankommt. Als wäre er nur ein Avatar, so wie in dem Spiel, das er auf der Seebrücke an der Ostsee spielt, wo er seinen virtuellen Rennfahrer Mal um Mal verunglücken lässt, während das virtuelle Publikum jubelt.
Eine Szene, die man nicht überlesen kann, weil sie die Geschichte, die Elze erzählt, mit der Wirklichkeit unserer Zeit verbindet, in der immer mehr (junge) Menschen abtauchen in virtuelle Welten, dort ihre „Abenteuer“ erleben und ihre Vorstellungen entwickeln von Resonanz, während sie in der realen Welt immer schlechter kommunizieren und ihre Gefühle zum Ausruck bringen können. Und sich manchmal auch genauso benehmen, als hätten sie einen ganzen Vorrat von Leben, die sie „verballern“ können.
Als wäre es die Mühe nicht wert, sich um das eigene Überleben zu sorgen.
Das Ergebnis: Ein Leben, in dem andere die Regeln bestimmen. Solche wie Gerd, der die Dinge am liebsten allein „regelt“. Weil er weiß, wie man „alles richtig“ macht und daraus auch ganz unübersehbar seine gewählte Gerd-Rolle spielt. Letztlich emotional deutlich auf Distanz – zu Frau und Sohn. Und damit eigentlich ein Fremder. So, wie wahrscheinlich viele Kinder ihre Väter erlebt haben, auch wenn dieser Typus wie aus dem letzten Jahrhundert zu stammen scheint: stolz darauf, das Regelwerk eines kleinen, geordneten Lebens zu beherrschen.
Undurchdringliche Vaterrollen
Vatertypen, an denen Kinder schon deshalb scheitern müssen, weil sie mit dem Menschen dahinter nicht in Berührung kommen können. Nur mit dem locker-flockigen Burschen zu tun bekommen, der selbst dann, wenn alle Erwartungen unter seinen Händen zerbröselt sind, so tut, als wäre alles bestens und er hätte die Dinge im Griff.
Und da bekommt dieser Freudenberg durch seine Passivität geradezu die Chance in die Hand, das Leben einmal selbst in die Hand zu nehmen – und er kann sie nicht nutzen. Er ist völlig davon überfordert. Pustekuchen vom Traum, „ein anderer zu sein“. Da helfen auch die Klamotten des Anderen nichts, wenn man selbst noch nichts ist.
Denn um ein Anderer zu werden, müsste man ja selbst erst einmal sein. Was nicht leicht ist, wenn man nie aus den (unausgesprochenen) Erwartungen der Eltern herauskommt, die einen enormen Druck aufbauen können, wenn es darum geht, „was aus dem Jungen einmal werden soll“. Ein Druck, der umso größer wird, je mehr er im Unausgesprochenen und Vorwurfsvollen bleibt.
Andere Kinder rebellieren dann wirklich und lassen es ordentlich krachen.
Aber nicht einmal das schafft Freudenberg. Denn was man dann mit der Zeit verinnerlicht, wenn man aus dieser Null-Rolle nicht herausfindet, ist eine permanente Scham, das Gefühl, nicht genügen zu können und sich mit allem, was man sagt oder tut, zu entblößen. Ja nicht erwischt werden, wird dann zur Lebenshaltung. Obwohl es keine Haltung ist. Denn sie kehrt natürlich alle Macht aus dem Leben, schreibt anderen eine Handlungsfähigkeit zu, die man selbst nicht fertigbringt. Oder sich nicht zutraut.
Die Retterin, die keine war
Da taucht dann zwar kurz auch eine aufmerksame Maja auf, mit der der so ungeplant in eine andere Rolle Gerutschte dann auch noch so etwas wie ein Liebesabenteuer erlebt. Aber natürlich ist es so wie in so vielen sehr deutschen Liebesgeschichten: Die Prinzessinnen können die sprachlosen Prinzen nicht retten. Und lassen sie ziemlich schnell allein mit ihrem Weltschmerz, der eigentlich auch nur eine gedankenschwere Nichtanwesenheit ist.
Steckt das wirklich alles in diesem Buch? Vielleicht. Wahrscheinlich wird es jeder Leser mit andere Augen lesen. Mancher wird die kleine, wortarme Welt wiedererkennen, in der so mancher irgendwie erwachsen werden muss. Mancher wird sich auch nur kopfschüttelnd durcharbeiten, weil dieser Freudenberg so unübersehbar viele Situationen verpeilt, in denen er einfach nur beherzt handeln könnte – nur die tief sitzende Scham hält ihn auch vor den menschlichsten Reaktionen zurück.
Und irgendwie ist auch das dumme Gefühl immer gegenwärtig, dass das ein ziemlich störrisches Abbild eines guten Teils unserer Gesellschaft ist – mitsamt ihrer Verkleidung, der mühsam behaupteten Fassade, die Dinge im Griff zu haben, und der geradezu zum Dogma gewordenen Angst davor, auch nur einmal die Kontrolle über die Dinge zu verlieren. Es ist eine Welt, in der man nicht gelassen sein kann. Genau so, im wörtlichen Sinn. Immerzu muss eine ziemlich schablonenhafte Erwartung erfüllt werden.
Eine Gesellschaft, die so stolz darauf ist, alles unter Kontrolle zu haben. Obwohl das die größte, wirkmächtigste aller Fiktionen ist.
Nicht-Held im eigenen Leben
Dieser Freudenberg findet eigentlich nie aus der Rolle des Beobachters heraus, als schaue er sich selbst zu bei dem, was ihm da alles passiert. Und das einzige Gefühl, das er dann tatsächlich als eigenes wahrnimmt, ist die Scham.
Und wäre da nicht die Vermutung, dass es vielen jungen Menschen so geht, müsste man eigentlich verzweifeln an diesem Burschen, dessen fehlende Souveränität endgültig klar wird, als ihn Gerd letztlich wie beiläufig mit Maik anspricht, was einen als Leser letztlich nur daran erinnert, dass dieser Nicht-Held eigentlich nicht vorhanden ist in seiner eigenen Geschichte.
Aber was wird aus Menschen, die ihr eigenes Leben nicht im wahrsten Wortsinne erleben?
Eine durchaus berechtigte Frage, die auch mit der Frage nach dem zu tun hat, woraus unsere Freiheit eigentlich besteht. Elze weiß das schon. Denn sein Nicht-Held fühlt sich ganz am Ende, nachdem ihn die völlige Dunkelheit überwältigt hat, zum ersten Mal im Leben frei.
Carl-Christian Elze „Freudenberg“, Edition AZUR, Dresden, Berlin 2022, 20 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
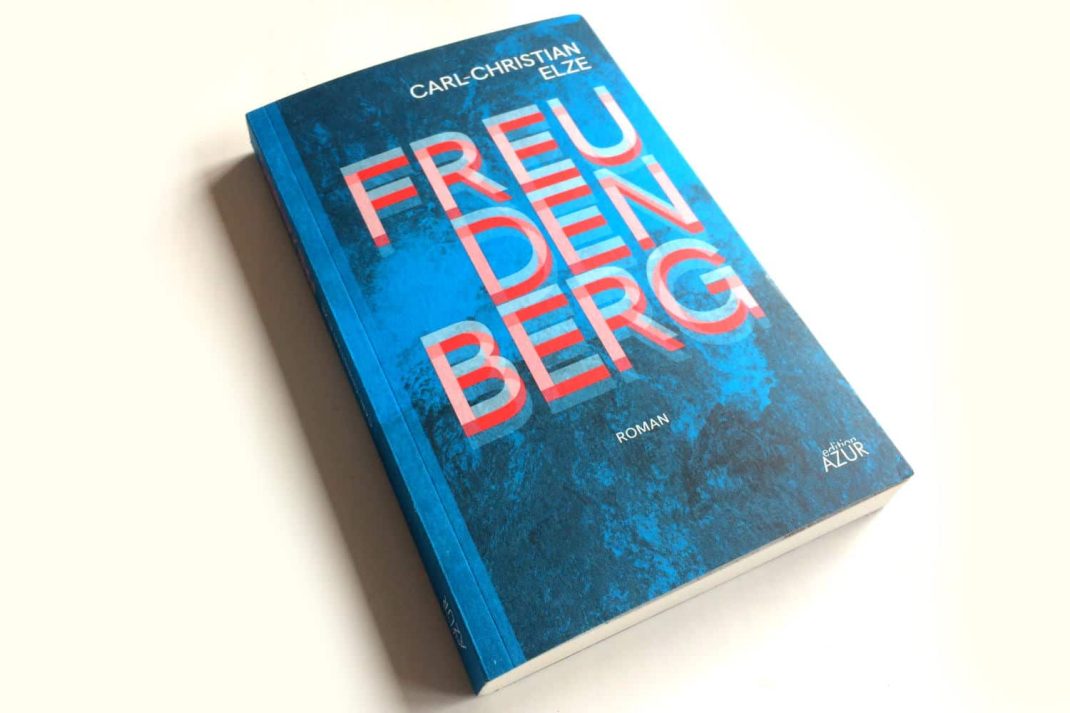













Keine Kommentare bisher