Man soll Bücher nicht durcheinander lesen. Natürlich soll man Bücher durcheinander lesen. Dann kommt es nämlich zu Begegnungen der unheimlichen Art. Und es kommt zusammen, was zusammengehört, auch wenn man es vorher nicht zusammengedacht hat: die Hexenprozesse in Salem, die puritanische Intoleranz, die Zensurpraxis in der DDR und der intolerante Wahnsinn des Stalinismus, dem auch die besten russischen Autoren zum Opfer fielen.
Die Bücher zur DDR-Zensurpraxis und zum nordamerikanischen Puritanismus werden wir an dieser Stelle noch besprechen. Es ist dabei schon verblüffend, wie „Gleichschaltung“ in völlig verschiedenen gesellschaftlichen Systemen funktioniert. Immer wieder funktioniert, muss man sagen. Als würden wir einfach nichts draus lernen wollen, wohin geschlossene Denksysteme, die sich selbst für auserwählt halten, am Ende alle führen.Die ersten, die darunter leiden, sind die Dissidenten, „Abweichler“, „Ketzer“, die eigenen Leute, die sich nicht wirklich wehren können, weil sie ja selbst „für die Sache“ glühen, in den Mitbrüdern und Genossen Gleichgesinnte und Freunde sehen, denen sie vertrauen – nur um dann zu erleben, dass sie die ersten sind, die an die Wand gestellt, nach Sibirien geschickt und vor die Tribunale gezerrt werden, wo sie sich dann auch noch „selbst beschuldigen“, wie das in den üblichen Erklärungen zum Stalinismus so oft heißt.
Wenn Stalin wütend ist
Einer, der das am eigenen Leib erlebte, war Andrej Platonow, dessen Werk nach einem Eingriff Stalins ab 1931 in der Sowjetunion bis zu Platonows Tod 1951 nicht mehr erscheinen durfte. Seine Bücher wurden erst in der Tauwetterperiode nach Chruschtschows Rede auf dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 einer großen Öffentlichkeit bekannt. In der DDR erschienen seine Werke in den 1980er Jahren – verblüffenderweise, muss man sagen.
Denn am Stalinismus, der in der DDR in einer gedämpften Form bis 1989 herrschte, hatte sich ja nichts geändert. Und daran, dass die SED-Führung eigentlich keine Beschäftigung mit den Auswüchsen des Stalinismus wünschte (Stichwort: „Sputnik“-Verbot) auch nicht.
Dass die Werkausgabe nicht vollständig war, spielte dabei eigentlich keine Rolle, denn jedes Buch aus der Tauwetter-Literatur, das es in die DDR schaffte, war wie ein Stück Glasnost: ernüchternd, erhellend, Bestätigung dafür, dass man nicht ganz und gar bescheuert war und der Kaiser tatsächlich nackt war.
Dass er Fehler machte – oder im Fall der Altherrenmannschaft im ZK der SED eben sie: All ihre Experimente mehr oder weniger gescheitert, undurchdacht, rücksichtslos durchgepeitscht. Im Falle Stalins auch noch mit roher Gewalt. Nicht ganz zufällig erzürnte der „große Führer“ ausgerechnet in dem Moment über einen Text von Platonow, als der die von Stalin ab 1929 durchgepeitschte Kollektivierung der Landwirtschaft kritisierte.
Willkür als Herrschaftsmethode
Stalins Politik, die Modernisierung Russlands auf den Knochen der Menschen durchzuprügeln, war fortan in mehreren Romanen Platonows Thema, auch wenn sie zu seinen Lebzeiten nicht gedruckt werden durften und der begnadete Autor eher das Leben einer verlorenen Seele lebte. Ganz ähnlich wie Bulgakow, der mit seinem Roman „Der Meister und Margarita“ ja das Teuflische am Stalinismus ebenso literarisch brillant in Szene setzte.
Und das war noch das „bessere“ Schicksal für die begabten Autoren des Landes. Andere – wie Platonows Freunde Boris Pilnjak und Andrej Nowikow – wurden erschossen. Aber selbst seine Kritiker – wie Alexej Seliwanowski oder Konstantin Bolschakow – waren nicht sicher und landeten vor den Gewehrläufen der stalinschen Justiz.
Beide waren beteiligt an einem „Werkstattgespräch“ des Verbands der sowjetischen Schriftsteller am 1. Februar 1932 mit Platonow, bei dem es im eingeübten Ritual von „Kritik und Selbstkritik“ im Grunde darum ging zu prüfen, ob dieser Platonow sich seit dem Stalinschen Rüffel nicht gebessert hat, wieder ein aufrechter Kommunist geworden ist, der aus seinen Fehlern gelernt hat und jetzt wieder überzeugte Werke im Sinne der aktuellen Politik schreibe.
Was Platonow natürlich nicht belegen konnte. Aber seine Unterwürfigkeitsreden lieferte er trotzdem ab, streute sich Asche aufs Haupt und ließ sich die Kritik seiner Schriftsteller-Genossen bereitwillig gefallen. Das Protokoll dieses „Werkstattabends“ hat sich erhalten und nimmt im Grunde den größten Teil dieses Buches ein.
Und das nicht ganz grundlos, denn das Gespräch fand genau in der Zeit statt, in der Platonow an seinem Roman arbeitete, der hier als „Der makedonische Offizier“ betitelt wird, aber nie über den fragmentarischen Anfang hinauskam.
Das Reich des Königs Osni
Dieses Fragment eröffnet das Buch und nimmt den Leser mit in eine typische Platonowsche Fiktion, mit einem Königreich weit, weit fort in ferner Vergangenheit, ungefähr in der Zeit Alexander des Großen, in dessen Heer der Held der Geschichte, Firs, Offizier war, ausgesandt, um das von hohen Bergen eingeschlossene Land Kutemalia auszukundschaften und Wege zu dessen Eroberung zu finden.
Aber in Kutemalia wurde er – wie praktisch alle Einwohner – mehr oder weniger zum Sklaven, vor der schnellen Hinrichtung dadurch bewahrt, dass er Bewässerungstechniker (wie Platonow selbst) war und damit wertvoll für König Osni, der sein Volk mit dem Paradies auf Erden beglücken will und dazu natürlich – in dieser Wüstengegend – jede Menge Wasser braucht.
Dass der russische Geheimdienst schon in diesem Fragment roch, worauf Platonow da zielte, merkt man spätestens an der Stelle, an der Firs den berühmten Philosophen Klusi trifft, der ihm erklärt, wie die „psychiatrische Form der Völkerbeherrschung“ funktioniert.
Denn sie ist die „höchste, wirkliche Freiheit der Menschen, weil alle Gesetze des Staates unverzüglich absterben und das allgemeine Leben überraschend ist in seinem Schicksal, unerwartet, unvorhersehbar und voll von enthusiastischer Interessantheit: Jeder kann täglich sterben und für unsterblich erklärt werden, in Abhängigkeit vom Schwanken des königlichen Geistes, von seiner magischen Psychose“.
Eine Stelle, die schon prägnant vorwegnahm, mit welcher Willkür Stalin in den nächsten Jahren gerade unter der sowjetischen Intelligenzija wüten würde. Niemand war sicher. Und selbst die gehärtetsten Stalinisten landeten vor dem Erschießungskommando.
Die Angst war allgegenwärtig, das Misstrauen aller gegen alle ebenso, und das Ergebnis war: Der Wille des „großen Führers“ war unergründlich. Niemand konnte sicher sein, den Willen des Königs tatsächlich erkannt zu haben. So wird Macht undurchschaubar und unenträtselbar.
Der eingesperrte Gorki
Und Platonow geht ja in seinem Romanfragment noch weiter, er attestiert seinem König Firs geradezu einen Wahnsinn, den seine glühenden Verehrer, die sich vor dem Palast geißeln, als unerreichbar hohe Genialität verehren. In Kusni vermutet Michael Leetz, der das Buch übersetzt und herausgegeben hat, eine Personifikation Gorkis, den Platonow verehrt hat und von dem er sich Hilfe erbat in der Zeit, als er praktisch ein stillschweigendes Publikationsverbot hatte und damit als Schriftsteller auch keine Einkünfte mehr.
Und so steht mit „Erste Begegnung mit Gorki“ auch ein vermutlich 1939 entstandener Text im Buch, in dem Platonow einen Besuch bei dem nach Moskau zurückgekehrten Gorki schildert, der so wahrscheinlich nie stattgefunden hat. Dazu ist die Schilderung selbst wieder viel zu sehr Platonow – geradezu eine Parabel auf den zum Nationaldichter erhobenen Gorki, den einst Lenin schon lieber ins Ausland schickte, weil er die tatsächlichen Vorgänge im neuen sozialistischen Reich zu kritisch sah.
Und seine Rückkehr machte Gorki eben noch lange nicht zu dem mächtigen Gewissen der Nation, das in der Lage gewesen wäre, einem wütenden Stalin Paroli zu bieten. Im Gegenteil: Platonow schildert Gorkis Haus wie ein freiwilliges/unfreiwilliges Gefängnis, in dem ein unwilliges Türschloss dafür sorgt, dass das Hereinkommen genauso schwierig ist wie das Herauskommen. Eine Metapher, die auch DDR-Bürger nur zu leicht entschlüsseln konnten.
„Menschenmaterial“ und „Naturressourcen“
In der Summe werden die von Leetz zusammengestellten Texte natürlich deutlich mehr als nur die Ergänzung zum kurzen Romanfragment „Der makedonische Offizier“, von dem eine Geheimdienstnotiz zumindest vermuten lässt, dass Firs noch einen großen Sklavenaufstand auslösen wird. Dass das post-stalinistische Imperium weit nach Platonows Tod ganz friedlich zerfallen würde, konnte Platonow nicht ahnen.
Leetz geht auch noch auf die – wieder typischen platonowschen – Warnungen vor der ökologischen Katastrophe ein, die das rücksichtslose Unterwerfen der Natur auch im stalinschen Reich mit sich bringen würde. Aber dieses Thema hat in anderen Romanen und Erzählungen Platonows eine viel zentralere Rolle.
Hier scheint es eher organischer Teil der Geschichte zu sein und beleuchtet einen Aspekt, der meist übersehen wird bei der kritischen Betrachtung der modernen Ideologien: Dass diese den (versklavten) Menschen genauso nur als „Material“ betrachten wie die Reichtümer der Natur – und mit beiden „Ressourcen“ rücksichtslos, gefühllos und mörderisch umgehen.
Ein Punkt, der übrigens sehr nachdenklich macht, denn damit verbleibt Platonows Zeichnung eines unmenschlichen Königreiches ja nicht mehr im geschlossenen Universum des König Osni. Dann wird diese Art Versklavung von Menschen und Erde zur Parabel auf etwas, was uns alle betrifft.
Bis hin zur Frage, ob wir da nicht auch so mancher Ideologie von Freiheit anhängen, die im Kern doch wieder nur eine Maske für Ausbeutung, Beherrschung und tatsächliche Unfreiheit ist. Denn so, wie wir mit der Erde, dem Klima und der zerstörten Natur umgehen, erzählt das nicht gerade davon, dass wir tatsächlich im Reich der Freiheit leben. Aber dass wir viel zu leicht verführbar sind von Ideologien, die genauso närrisch und rücksichtslos sind wie die Launen und Einfälle König Osnis.
Das technokratische Denken in Ost wie West
Dass „Der Makedonische Offizier“ in der einst bei Volk und Welt edierten Ausgabe in der DDR nicht mehr erschien, hat diesmal nicht mit Zensur zu tun, sondern damit, dass das Fragment erst nach 1990 in Russland veröffentlicht wurde. Aber sichtlich ergänzt es die schon publizierten Werke Platonows. So auch das 2019 noch einmal von Michael Leetz neu übersetze und veröffentliche „Dshan oder Die erste sozialistische Tragödie“.
Und so wie „Dshan“ ist auch „Der makedonische Offizier“ letztlich als Parabel viel größer als dieses stalinistische Königreich hinter den Bergen. Eigentlich sind Platonows Romane Warnungen, die heute noch immer ihre Gültigkeit beweisen.
Da kann ich diese Rezension auch mit den letzten Sätzen aus der Rezension zu „Dshan“ beenden: „‚Dshan‘ ist ein märchenhaft dichtes Stück Literatur, das beim aufmerksamen Lesen erstaunlich viele Parallelen in die Gegenwart aufweist, die ganz unübersehbar ihre technokratische Rücksichtslosigkeit gegenüber der Natur, den Tieren aber auch den Menschen nicht abgelegt hat. Und die Verlorenen und Schlafenden leben heute in Wohlstands-Wüsten, in denen sie sich aber unüberhörbar genauso trostlos und verloren fühlen wie die Traumlosen in der Sary-Kanysch.“
Nur auf den wahnsinnigen König Osni zu zeigen, lenkt von der eigentlichen Tragödie ab, die überall passiert, wo Menschen sich für auserwählt und begnadet halten und denen überlegen, die noch nicht vom heiligen Osni (oder wie immer der neue Säulenheilige heißt) erleuchtet sind.
Andrej Platonow Der makedonische Offizier, Suhrkamp Verlag, Berlin 2021, 24 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
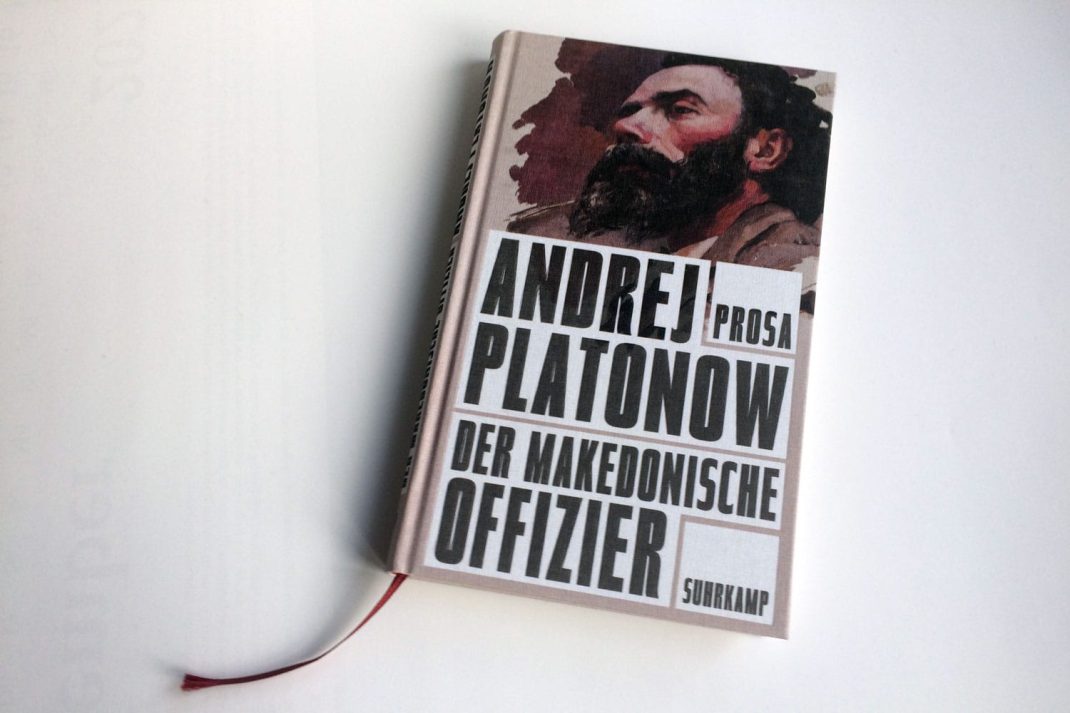















Keine Kommentare bisher