Wenn Arne Born mit seinem Buch „Literaturgeschichte der deutschen Einheit 1989–2000“ 2019 etwas gelungen ist, dann etwas, was der Literaturwissenschaftler eigentlich gar nicht beabsichtigt hatte: zu zeigen, dass es ein deutsch-deutsches Gespräch auf Augenhöhe nie gegeben hat. Literatur ist ein sehr guter Seismograph für die Missstände einer Gesellschaft. Auch dann, wenn die Bücher nie in den „Spiegel“-Bestseller-Listen auftauchen. Gerade dann.
Denn gerade die viel gerühmten „Spiegel“-Bestseller-Listen erzählen nicht von dem, was wirklich wichtig ist oder literarisch besondere Klasse oder hochbrisant oder intensiv. Sie bringen eigentlich nur eine Ware: die gut verkäufliche, die Massenware, die manchmal exzellent sein kann, keine Frage. Doch der wöchentliche Blick auf diese Liste zeigt eigentlich auch: Zur großen Debatte, zum wirklich auch schmerzhaften Nachdenken über den Zustand unserer Gesellschaft lädt dort nichts ein. Gar nicht.Auch wenn da aktuell Deutschlands berühmtester Wanderer Hape Kerkeling, Deutschlands berühmtester Förster Peter Wohlleben und Deutschlands berühmtester Arzt-Satiriker Eckart von Hirschhausen stehen. Alle drei nette Leute, wohlbekannt aus Funk und Fernsehen, Klammer auf: Funk und Fernsehen West. Denn der Osten hat keine solchen Berühmtheiten. Warum, darauf geht ja Cerstin Gammelin in ihrem Buch „Die Unterschätzten“ ein.
Und so wie es keine bekannten Köpfe von streiterprobten ostdeutschen Intellektuellen gibt, die in der deutsch-deutschen Debatte tatsächlich gefragt sind und Haltung zeigen, so gibt es auch keine Medien, in denen die deutsch-deutschen Debatten überhaupt stattfinden könnten. Und es braucht schon Bücher wie diese, um wenigstens noch einmal nachzuerleben, warum die Ostdeutschen mit einem ganz anderen Gepäck in die Deutsche Einheit gekommen sind als ihre westdeutschen Verwandten, die ihr Leben nicht ändern mussten.
Und auch nie wirklich darüber nachdenken mussten, ob die Ostdeutschen nun dazugehören (dürfen) oder nicht. Denn während die Ostdeutschen über die Deutsche Einheit abstimmen durften – nämlich mit dem Wahlergebnis vom März 1990 – wurden die Westdeutschen nie gefragt. Für sie landeten die einstigen DDR-Bürger in einer Art Warteschleife der Nichtwahrnehmung. Irgendwie im Vorzimmer, wo man sie schmoren lassen kann bis zum Sanktnimmerleinstag.
Cerstin Gammelin benennt es schon richtig: Das ist genau der Leerraum in der öffentlichen Wahrnehmung, den seit Jahren erfolgreich die Rechtsradikalen besetzen.
Wer nicht miteinander redet, wird auch nie erwachsen.
Wobei das Wort „infantil“ für die deutsch-deutschen Beziehungen eher untertrieben klingt. Man fühlt sich eher wie in der „Truman-Show“: Man kommt aus der einmal von den „Siegern der Geschichte“ verordneten Fremdsicht nicht heraus. Man passt sich entweder an und übernimmt kritiklos die Generalerzählung der westdeutschen Mehrheitsgesellschaft (und vergisst die eigene komplett), oder man wird zum Ewiggestrigen oder Nörgler oder Nicht-in-der-Demokratie-Angekommenen. Und was der Klebeetiketten mehr sind.
Und deshalb fand Arne Born auch nur drei ernst zu nehmende Romane von westdeutschen Autoren zur deutschen Einheit / „Wende“ / Friedlichen Revolution, die sich tatsächlich ernsthaft mit dem beschäftigten, was 1989/1990 geschah. Einer davon war Jan Grohs 2001 erschienener Roman „Colón“, der schon damals schwer zu bekommen war, denn er erschien in der kleinen Edition Octopus in Münster. Nun, 20 Jahre später, hat ihn Jan Groh in seinem eigenen Verlag Sol et Chant wieder aufgelegt. Mit denselben Problemen wie 2001: Man findet ihn in den großen Buchhandlungen nicht. Am besten bestellt man ihn direkt im Verlag.
Und wenn man die Jahre um 1989 im Osten miterlebt hat, schnallt man sich am besten an, denn dieses dicke Buch ist tatsächlich eine Zeitreise, zurück in ein Land, das auch deshalb unterging, weil die Macht arrogant, ignorant und blind geworden war. Was nur ein Aspekt ist, aber selbst der kommt in den üblichen westdeutschen Untersuchungen zum Thema nie vor, weil man in den westdeutschen Geschichtslehrstühlen keinen Sinn hat für die Funktionsweisen von Macht. Blinde Flecken gibt es nicht nur im Osten.
Nur dass im Osten das Wissen tief verankert ist, welche Macht die von der SED installierte Stasi hatte und wie sie das tägliche Leben bestimmte, jeden Widerspruch unterdrückte und kriminalisierte und damit – frei nach Majakowski – „meinem Lied auf die Kehle trat“. Nur so am Rande: Auch Majakowski ist ein sträflichst unterschätzter Dichter, der in seinen Gedichten schon sehr genau beschrieb, wie das ist, wenn die neu eingesetzten Funktionäre den Sängern und Menschen das (Selber-)Denken verbieten.
Groh hat in seinem Buch einen naiven Hamburger zum Helden gemacht. Ludger Braun, der sich nach dem überraschenden Tod seines Bruders Gernot von dessen Freunden dazu drängen lässt, in die Rolle des Bruders zu schlüpfen, der die Ostberlinerin Rachel heiraten und ihr damit einen legalen Weg aus der DDR ermöglichen wollte.
Die Stärke von Grohs Roman ist tatsächlich, dass er völlig vermeidet, irgendeinen allwissenden Westdeutschen agieren zu lassen. Den Eindruck bekommt man ja meist, wenn man die westdeutschen Aufarbeitungen zur „Wende“ sieht: Dass im Westen immer schon alle wussten, was im Osten falschlief, und 1990 sowieso auch bestens wussten, wie man die Sache deichseln muss und den Ostdeutschen die lang ersehnte Einheit verkaufen kann.
Und nun sind sie 30 Jahre später noch immer undankbar. Aus der Sicht westdeutscher Chefredaktionen einfach unvorstellbar. Hat man denn nicht die ganze blühende Landschaft da drüben bezahlt? Nein. Hat man nicht. Bestenfalls hat man sich mit Kohl’scher Chuzpe losgekauft, sich die ganze ernsthafte Beschäftigung mit diesem 45 Jahre lang abhanden gekommenen Landesteil erspart. Einheit gut, alles gut.
Was auch daran liegt, dass hier Leute urteilten und werteten, die nie wirklich betroffen waren. Die auch nie erlebten, was Jan Groh seinen naiven Helden erleben lässt, den er von seiner Freundin Franzi einen Träumer nennen lässt. Was eine Untertreibung ist. Oder eine kleine Irreführung. Denn so verliebt diese Franzi in Ludger ist, scheint sie ihn dennoch nicht zu kennen. Denn dieser Ludger ist eindeutig nicht der üblich gezeichnete Typ des coolen, immer selbstbewussten Westdeutschen. Im Gegenteil.
Mit ihm hat ein autoritärer Vater, der vor allem seinen Sohn Gernot protegierte, wohl ganze Arbeit geleistet und ihm einen Packen an Unsicherheit, Selbstzweifel und Ziellosigkeit mitgegeben ins Leben, einen regelrechten Knacks, von dem ich mal vermute, dass damit genauso viele Westdeutsche ringen wie Ostdeutsche. Weshalb so vieles, was uns als erstrebenswert versucht wird anzudrehen, auch nichts als Show, Maskerade, Schminke ist. Was übrigens auch Folgen hat für Politik und Befindlichkeit und Machtverteilung im Westen.
Aber das nur am Rande.
Mit seiner tiefen Verunsicherung aber ist dieser Ludger genau der Fang, über den sich eine im Manipulieren profilierte Staatssicherheit von Herzen freut. Ist zwar ein falscher Ausdruck, denn Freude bringt man mit diesem sich als strenger Erzieher und Zuchtmeister eines ganzen Volkes verstehenden Geheimdienst wirklich nicht in Einklang.
Und Freude erlebt Ludger auch nicht, sondern jede Menge Angst und Demütigung. Und Groh verschont seine Leser/-innen nicht, schildert detailreich und genau, wie es sich angefühlt haben muss, in eine verschärfte Kontrolle an der Grenze zu Ostberlin zu geraten, ohne Ahnung, warum man jetzt selbst herausgewunken und gefilzt wurde und warum diese Uniformierten in diesen tristen Kellergängen einen auch noch ausfragten, regelrecht verhörten.
An der Stelle dürften sich vielleicht viele Leser/-innen, die diese Ängste damals im S-Bahnhof Friedrichstraße erlebt haben, direkt erinnert fühlen an ihre eigene Ohnmacht und die Hilflosigkeit, in der sie auf einmal einer fremden Macht ausgeliefert waren, von der sie nicht wussten, was die eigentlich durfte und ob man da heil wieder rauskam oder in irgendeinem Knast im Osten landete.
Und das ist erst der Anfang, an dem Ludger noch lange nicht ahnt, dass die Stasi ihn längst auf dem Kieker hat und alle seine Schritte beobachtet, so, wie auch fast alles um die kleine Lebensgemeinschaft rund um Rachel scheinbar lückenlose registriert wird. Da helfen auch nicht die Tricks mit Briefen mit getürkten Absendern. Der Geheimdienstapparat überwacht nicht nur den kompletten Telefonverkehr, sondern auch die Post. Auch wenn das wahre Ausmaß erst ab 1990 wirklich bekannt wurde.
Nach Ludgers Heirat, zu der er tatsächlich mit dem Pass seines (toten) Bruders Gernot nach Ostberlin eingereist ist, schnappt die Falle zu und er erlebt in einem Verhörraum der Stasi, wie diese mit Menschen umging, die in ihre Gewalt geraten sind. In diesem Fall sogar mit Folgen, die man eigentlich mit Logik nicht verstehen kann – die aber längst zum Repertoire aller modernen Geheimpolizeien gehören.
Sie spielen mit Zuckerbrot und Peitsche, zeigen dem Wehrlosen, zu welcher Brutalität sie in der Lage sind und schmeicheln sich dann ein, indem sie die Erniedrigten und Verprügelten zu ihren Partnern machen. Ludger wird zum Zuträger gemacht. Und noch schlimmer: Er gehorcht den Befehlen seines neuen „Vorgesetzten“, reist auf Weisung nach Ostberlin, um der Stasi nun direkt Berichte aus der Gruppe um Rachel zu liefern.
Doch die ganze Sache handelt im Sommer und Frühherbst 1989. Während Ludger so langsam die ärmliche, und doch selbstbewusste Welt von Rachel und ihren Freunden kennenlernt, kommt die Ausreisewelle über Ungarn ins Rollen, erfolgt Genschers Auftritt in der Botschaft in Prag, rollen die Züge der Ausreisewilligen und lädt Ludgers Quälgeist ihn ausgerechnet am 7. Oktober nach Ostberlin ein, ein Tag, an dem die Grenzen eigentlich geschlossen sind.
Und am Ende landet Ludger mitten in den Prügelorgien der ostdeutschen Polizei, die die Demonstrierenden im Prenzlauer Berg einkesselt und einsammelt, um sie hinterher stunden- und tagelang zu inhaftieren und zu erniedrigen.
Es war dieser Moment, der in der DDR noch einmal mit aller Brutalität sichtbar machte, dass die Machthaber in Berlin durchaus Pläne hatten, jeden Protest im Land mit Gewalt niederzuschlagen. Eigentlich ein Moment, in dem man normalerweise richtig wütend geworden wäre an Ludgers Stelle. Doch der wehrt sich nicht, lässt sich noch weiter erniedrigen und glaubt tatsächlich an die selbstlose Hilfe seines Stasi-Begleiters.
Nicht ahnend, dass er einen Monat später, am 4. November, als die große von Kulturschaffenden auf dem Alexanderplatz organisierte Kundgebung stattfindet, in einer noch schlimmeren Situation landet, aus der ihm nur noch die panische Flucht zurück in den Osten bleibt, wo er dann für Tage untertaucht.
Es ist gleich wie eine doppelte Erlösung, dass am Ende dieser 9. November passiert, der die Ereignisse dann tatsächlich unumkehrbar macht, Ludger den Rückweg nach Westberlin eröffnet und gleichzeitig dem alten SED-Stasi-Apparat tatsächlich die Machtgrundlage entzieht.
Aus ostdeutscher Sicht erzählt der 9. November ja tatsächlich von Befreiung und Selbstermächtigung. Auch wenn der Zweifel nagt: War der Schabowski’sche Versprecher tatsächlich nur ein Versprecher? War das nicht ein letzter Versuch der alten Mächtigen, den Druck aus dem Kessel zu nehmen?
Ein Druck, den Ludger nicht so richtig erfassen will, obwohl ihm Rachel und ihre Freunde immer wieder erzählen, wie sehr die Dinge ins Rollen gekommen sind. Aber gerade deshalb ist dieser westdeutsche Held in der Narrenrolle so erhellend, denn dieselbe Unfähigkeit, die Entwicklungen im Osten vor dem Herbst 1989 zu begreifen, zeigen heute noch viele westdeutsche Kommentatoren.
Und hätte sich dieser Ludger gar noch früher erpressen lassen, hätte er tatsächlich noch viel mehr Schaden angerichtet, als er mit seiner Dienstwilligkeit dem Stasi-Offizier gegenüber tatsächlich anrichtet. Als er in der Nacht des 9. November den Osten verlässt, ist er zutiefst beschämt und mit Schuld beladen.
Und nur noch heilfroh, hier rauszukommen, denn jetzt hat er zumindest gefühlsmäßig begriffen, was für ein Land sich die ostdeutschen Machthaber da geschaffen haben. Es sieht nicht nur ramponiert und schäbig aus, sodass beim Wechsel am Grenzübergang regelrecht die Farben aus allen Dingen zu verschwinden scheinen, es hat auch eine zutiefst graue und unerbittliche Seele bekommen.
Im Grunde stellt Groh ja mit dieser in großen Teilen auch atemlosen wie bedrückenden Geschichte auch die Frage, wie sich eigentlich Westdeutsche verhalten hätten, wenn sie dieser Willkür ausgesetzt gewesen wären. Würden sie überhaupt merken, wenn staatliche Instanzen übergriffig werden und die Hilflosigkeit der Bürger missbrauchen?
Eine völlig offene Frage. Die man eigentlich mit einem trockenen „Nein“ beantworten kann, wenn man sieht, wie gleichgültig den meisten die Übergriffigkeit der NSA, des BND und diverser Digitalkonzerne ist, die heute mehr Daten über jeden Einzelnen sammeln, als es der Stasi je möglich war.
Wirklich Mitleid hat man mit diesem Ludger am Ende nicht wirklich. Andererseits erzählt er auch von einer selten wahrgenommenen Hilflosigkeit des Westens, der dem Treiben der Stasi eigentlich nichts entgegensetzen konnte außer Geld, mit dem er dann die Inhaftierten freikaufte, was dann die Ostdeutschen erst recht zur Geisel ihrer Regierung machte.
Umso verblüffender ist natürlich, wie eine zunehmende Zahl von Menschen im Herbst 1989 ihre Angst überwand und den Regierenden ihre Legitimation auf der Straße nahm – trotz der Prügelorgien am 7. Oktober. Es war ein Moment der Selbstermächtigung, der in allem, was auf den 9. November folgte, regelrecht unterging.
Als hätten die DDR-Bürger im Westen darum gebettelt, jetzt als Land freigekauft zu werden, und nicht selbst – in Mut und Angst und Überforderung wie Rachel und ihre Freunde – die Ereignisse ins Laufen gebracht. Und damit auch die Demokratie im Osten, die eben kein Geschenk des Westens war.
Manchmal liest sich Grohs Geschichte durchaus als eine bittere Hinterfragung der westdeutschen Arroganz, in der die Heldengestalt eines Helmut Kohl geradezu riesenhaft wirkt, während die Menschen, die den Osten tatsächlich zurückbrachten in die Geschichte, zur Fußnote geschrumpft wurden. Als könnte man sie auch weglassen, als hätte das alles auch ohne sie geschehen können.
Aber ohne sie wäre das alles nicht geschehen. Auch wenn es selbst dieser Ludger nicht wirklich begreift, obwohl er mitten hineingerät in die Ereignisse, nicht mal ahnend, wie er die Menschen um sich herum in Gefahr bringt.
Wer die Zeit noch erinnert, wird mit dem durch und durch naiven Helden Blut und Wasser schwitzen. Und wer sie nicht kennt, weil er zu jung ist, kann hier ein wenig von dem erspüren, was im Sommer und Herbst 1989 tatsächlich geschah – aus der Sicht eines naiven Kolumbus (alias Colón), der die DDR betritt wie einen fremden Kontinent und eigentlich bis zum Schluss nicht aus seiner anerzogenen Naivität herausfindet, die ihn logischerweise zum Spielball macht.
Unfähig zu erkennen, wie er missbraucht und manipuliert wird. Aber immer mit einem fertigen Urteil über alles, was er sieht. Das verblüfft schon. Das kennt man irgendwie. Aber da schließt sich auch der Kreis. Denn wenn am Ende die Ludgers die ganze Geschichte erzählen, wird sie so seltsam wie die Reiseberichte des Kolumbus und all der Leute, die nach ihm kamen.
Jan Groh „Colón“, Verlag Sol et Chant, Letschin 2021, 24,80 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten alle Artikel der letzten Jahre auf L-IZ.de zu entdecken. Über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
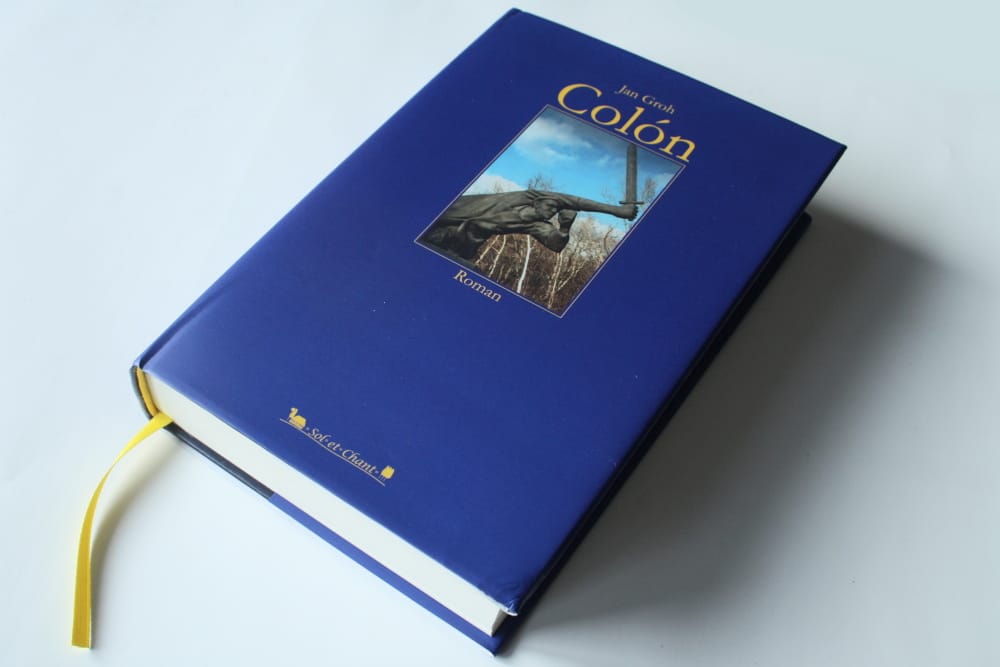





















Keine Kommentare bisher