Wie kommen eigentlich Moral und Verantwortung in die Wirtschaft? Das ist ja eine Frage, über die sich sogar schon der Urvater der klassischen Nationalökonomie, Adam Smith, intensiv Gedanken machte. Just jener Mann, auf den sich die neoliberalen Radikalen von heute immer wieder berufen, wenn sie vom „homo oeconomicus“ und der unheimlichen Fähigkeit des „Marktes“ reden, der die Welt quasi allein durch wundersame Zaubertricks immer besser macht. Dumm nur, dass genau das nicht passiert und uns ein Bündel von Katastrophen gerade die Existenzgrundlage zu entziehen droht.
Alles Katastrophen, die jede für sich Ergebnis einer entfesselten Markt-Radikalität sind, eines völlig von jeder Verantwortung entbundenen Kapitals, das nicht (mehr) der Allgemeinheit dient, sondern nur noch seinen „shareholdern“. Eine Radikalität, die auf ökonomische Vor-Denker wie Friedrich von Hayek und in seiner Nachfolge dem noch viel radikaleren Milton Friedman zurückgehen, dessen neoklassische ökonomische Schule mit Politikern wie Ronald Reagan und Margaret Thatcher auch zur politische Doktrin wurde.
Wirtschaft ist immer ein Politikum. Und so wie eine Gesellschaft über Wirtschaft denkt, werden nun einmal auch politische Entscheidungen gefällt und Gesetze gemacht. Das war auch im Corona-Jahr so – zum Entsetzen all jener, die tatsächlich versuchen, sich in einem ehrlichen Wettbewerb am Markt zu behaupten.
Und nun einmal mehr mit dem schlanken Finger gezeigt bekommen haben, welchen immensen Einfluss einige Player auf die Politik haben, die auf alle Regeln und Gesetze pfeifen. Und die logischerweise das Jahr 2020 mit immensen Gewinnen verlassen, während sie hinter sich verbrannte Erde hinterlassen.
Ein fairer Wettbewerb?
Schon lange nicht mehr. Ein richtiger Wettbewerb mit fairen Regeln für alle funktioniert nur, wenn es eine gemeinsame starke Instanz gibt, die diese Regeln auch durchsetzt und Regelverstöße bestraft – und nicht auch noch belohnt, wie das z. B. in der Finanzkrise 2008/2009 passiert ist. Mit Milliarden-Summen wurden ausgerechnet jene Banken und ihre Anteilseigner („shareholder“) belohnt, die für die Katastrophe verantwortlich waren.
Und das auch noch mit dem Argument, sie seien ja dafür letztlich nicht haftbar zu machen und eigentlich viel zu groß, um ihnen den Stecker zu ziehen. Damals waren es Bankmanager, die das Wort „systemrelevant“ in die Debatte brachten. Und harmlose Politiker/-innen eifrig nachplappern ließen: „to big to fail“.
Na holla: Da muss ein Laden nur mit kriminellen Machenschaften groß genug geworden sein und schon traut sich Politik nicht mehr, ihn für seine Regelverstöße zu bestrafen?
Wie wir heute wissen, duckt sich die deutsche Politik ja nicht nur vor den Krisenbankern weg, sondern auch vor Automanagern, Fleischfabrikanten, Agrarbaronen und was der Trickser und Regelbrecher mehr sind. Von Wettbewerb kann da schon lange keine Rede mehr sein.
Von Marktwirtschaft auch nicht, wie Stephan Bannas und Carsten Herrmann-Pillath in ihrem Manifest feststellen, in dem sie in 30 Thesen aufzeigen, wie eine wirkliche Marktwirtschaft aussehen müsste, wenn all die fest angestellten Ökonomen überhaupt noch so sattelfest wären, Marktwirtschaft in ihren Grundbedingungen zu definieren.
Sind sie aber nicht. Die meisten Lehrstühle sind mit neoklassischen Vertretern besetzt, die in ihrem scheinbar sehr theoretischen Kosmos im Grunde nur eins propagieren – das Primat des Kapitals. Oder besser: des verantwortungslosen Kapitals.
Denn die Moral und die Verantwortung, gar gesellschaftliche und soziale Ziele haben diese Theoretiker völlig aus ihrem Idealkonstrukt eines „reinen Marktes“ eliminiert. Eine Idee, auf die selbst Urvater Adam Smith nie gekommen wäre. Für ihn war die ethische Begründung einer Gesellschaft (und damit auch ihres wirtschaftlichen Handelns) Grundvoraussetzung für jede Markt-Tätigkeit.
Nur schrieb er das nicht in seinem immer wieder eng zitierten Buch „An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations“ von 1776, aus dem selbst den hartleibigsten Ökonomen meist nur das Schlagwort vom „Reichtum der Nationen“ einfällt. Damit ist dann meistens nichts als der Reichtum der Reichen gemeint ist, also unserer heutigen Feudalkaste. Dazu kommen wir noch.
Über die ethischen Grundlagen einer modernen Gesellschaft schrieb Smith schon 1759 in seinem Buch „The Theory of Moral Sentiments“. Ohne Moral kein menschliches und schon gar kein soziales Handeln. Und wenn doch – dann immer mit katastrophalen Ergebnissen. Denn ethisches Handeln akzeptiert und respektiert immer auch die Grenzen der eigenen Möglichkeiten und die Rechte und das Dasein der anderen. Es akzeptiert, dass wir Menschen in einer gemeinsamen Welt agieren, wo die Freiheit jedes einzelnen die Freiheiten aller anderen begrenzt – und umgekehrt.
Wer diese „Grenzen der Freiheit“ niederwalzt, zerstört meist nicht nur Existenzen und Hoffnungen, sondern auch Stück für Stück unsere Lebensgrundlagen. Von Wettbewerb und Markt ganz zu schweigen.
Deswegen sollte man, so Bannas und Herrmann-Pillath, bei Hayek auch nicht von Neoliberalismus sprechen, eine Bezeichnung, die eigentlich wirklich einer (neuen) liberalen Denkweise über das Wirtschaften zusteht, sondern von „Paläoliberalismus“, ein Wort, das der Sozialwissenschaftler Alexander Rüstow geprägt hat.
Denn Hayek geht mit seiner radikalisierten Markttheorie sogar noch hinter Adam Smith zurück, in ein geradezu urzeitliches Verständnis von Marktgeschehen – das aber heute dummerweise das politische Denken über den Markt dominiert.
Und wirklich nachdenkliche Ökonomen nur noch den Kopf schütteln lässt: Wie konnte ein derart primitives Denken über Wirtschaft eigentlich zum politischen Postulat werden?
2018 trafen sich Bannas und Herrmann-Pillath bei der Beisetzung des Sozialphilosophen Walter Oswalt, dessen Schüler sie beide waren, auch wenn sie sich erst auf diese Weise treffen mussten um herauszufinden, dass sie über den theoretischen Wirtschaftsunsinn, der heute an unseren Hochschulen gelehrt wird, ganz ähnlich denken. Sie trafen sich in der Tradition natürlich von Oswalt und dessen Großvaters Walter Eucken, dem Mann, den man heute wirklich als Vordenker der Sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus sieht.
Und da steht natürlich die Frage: Haben wir denn nicht die Soziale Marktwirtschaft?
Sozusagen ein richtig tolles Erbe im Gegensatz zu den angelsächsischen Ländern, wo der Neoliberalismus seit 40 Jahren seine radikalen Triumphe gefeiert hat? Die Antwort lautet schlicht: Nein.
In ihren 30 Thesen erläutern die beiden Ökonomen, wie eine Marktwirtschaft eigentlich aussehen müsste, um den Namen zu verdienen. Denn eine Wirtschaft, in der nicht alle Menschen dieselben Freiheiten und Marktzugänge haben und dieselben Regeln im Wettbewerb, hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun.
Das ist (nur) blanker oder verklärter Kapitalismus. Oder um die beiden mal wörtlich zu zitieren: „Kapitalismus ist keine Marktwirtschaft, sondern eine Form der systematischen Verschränkung staatlicher und wirtschaftlicher Macht, bei Ausnutzung der ökonomischen Organisationsform der Märkte. In diesem Sinne steht er also in der Tradition des Feudalismus …“
So viel zur Machtfrage. Was übrigens die meisten Bürger auch spüren – oder besser: Sie spüren ihre Machtlosigkeit. Sie haben keinen gleichen Zugang zum Markt, von Lebenschancen ganz zu schweigen. Und sie haben das Gefühl, keinen Einfluss auf Politik zu haben.
Wer in Deutschland wirklich Macht hat, das hat das „Manager Magazin“ am 1. Oktober wieder aufgelistet – mit einem nicht ganz verständlichen Bedauern, das irgendwie zeigt, dass man beim „Manager-Magazin“ zwar eine zutiefst untertänige Beziehung zu den Superreichen in Deutschland hat, aber nicht viel Verständnis von Markt und Marktversagen.
Natürlich „versagt“ ein Markt, wenn er der Gier und den Eitelkeiten einiger höchst Einflussreicher unterworfen wird, die ihre eigenen Regeln machen, Politiker wie Kofferträger behandeln und ihr Geld dem Gemeinwesen auf alle nur erdenklichen Arten entziehen. Nicht nur durch akrobatische „Steuerminimierung“ und Steuerflucht, sondern auch durch massiven Einfluss auf die (deutsche) Steuergesetzgebung. So handeln Leute, denen die moralischen Überlegungen eines Adam Smith zutiefst fremd sind und die auch keine Verantwortung gegenüber dem Gemeinwesen kennen.
Was auch damit zu tun hat, dass sie persönlich für die Folgen ihres Tuns nicht haftbar gemacht werden können. Was eigentlich die zentralste aller Thesen ist, die Bannas und Herrmann-Pillath formuliert haben und in einem eigenen Kommentarteil noch einmal ausführlich erläutern. Denn zentrales Kennzeichen des Kapitalismus ist die Kappung der gesellschaftlichen Verantwortung durch Firmenkonstrukte, die ihre Inhaber von jeder Haftung befreien.
Wer nicht haften muss für die Folgen seines Tuns, nimmt logischerweise auch keine Rücksicht. Der macht seine Profite nur in Sinne der Anteilseigner, der zumeist anonymen „shareholder“. Was an vielen Lehrstühlen immer noch als der Wesenskern guten Unternehmertums gepredigt wird.
Was aber zu genau den Katastrophen und Krisen führt, die wir heute erleben. Die übrigens in vielen Fällen auch Folgen rücksichtsloser Monopolisierungen sind. Noch so etwas, was es in einem fairen Wettbewerb eigentlich nicht geben darf, weil das letztlich dazu führt, dass ein einzelner Monopolist sämtliche schwächeren Marktteilnehmer aus dem Markt fegt, den Kunden und Lieferanten seine Bedingungen aufs Auge drückt (die „social media“-Giganten von heute sind ein eklatantes Beispiel dafür) und gleichzeitig eine enorme Erpressungsmacht gegenüber der Politik hat. Denn hier verwandelt sich Marktmacht in politische Macht.
Wer einen wirklich funktionierenden Markt will mit Marktteilnehmern, die sich an die Regeln halten, schafft die Haftungsbefreiung ab. Auch und gerade für die Anteilseigner. Was – da sind sich die beiden Autoren sicher – zwangsläufig dazu führen wird, dass sich die viel beschworenen Investoren dann drei Mal überlegen, ob sie ihr Geld in windige und die Welt zerstörende Geschäfte stecken oder nicht doch lieber in Unternehmen, die nachhaltig und umweltschonend arbeiten.
Was dann natürlich die Rolle der Gemeinschaft ins Spiel bringt, die politisch formulieren muss, welche Regeln gelten müssen. Und während neoklassische Ökonomen auch den Studierenden in die Köpfe hämmern, dass der Markt seine eigenen Regeln hat und sich Staat und Gemeinschaft da nicht einzumischen haben, zeigt jede nüchterne Analyse, dass selbst der Markt immer schon ein gesellschaftliches Konstrukt war, für das eine moralisch verantwortliche Instanz die Regeln festsetzen muss. Eine Instanz außerhalb des Marktes. Also letztlich genau jener Staat, den die Neoklassiker raushalten wollen aus den Märkten.
Woher sonst sollen diese Regeln auch kommen? Ein der Umwelt und der Gemeinschaft gegenüber völlig unverantwortliches Wirtschaften um jeden Preis zerstört ganz zwangsläufig alle Grundlagen, innerhalb derer es agiert. Es kennt keine Grenzen, keine Moral, keinen Respekt. Es feuert die Öfen, solange man mit Strom Kohle machen kann, fischt die Meere leer, fackelt Urwälder ab, um Sojaplantagen anzulegen, laugt die Böden aus, um den größtmöglichen Profit daraus zu schlagen.
Es plündert die Ressourcen von Staaten, die sich gegen die Ausbeutung nicht wehren können, pfeift auf die Artenvielfalt und auch auf die allerwichtigste Ressource, ohne die es eigentlich nicht arbeiten könnte: Sozial- und Humankapital, wie es in der modernem Wirtschaftslehre gern genannt wird, als würde all das nur dazu da sein, um in der Wirtschaft verwurstet, ausgenutzt und verbraucht zu werden und hinterher einfach ausgespuckt, wenn man es nicht mehr (ge-)brauchen kann.
Wem gehören Gemeingüter?
Was die beiden Autoren natürlich auch auf die Grundfrage bringt: Wem sollten eigentlich die Gemeingüter gehören? Sollten sie überhaupt jemandem gehören? Oder werden sie dann zu Erpressungspotenzial, wenn sie privatisiert werden? (Trink-)Wasser gehört dazu, die Luft, die Wälder, die Artenvielfalt, aber vor allem: der Boden. Was passiert eigentlich, wenn alle diese Dinge auf einmal einen Preis bekommen und vor allem der Profitsteigerung einiger weniger dienen?
Das natürlich, was wir auch in Deutschland erleben: Die Allgemeinheit wird immer stärker von der Nutzung dieser Güter ausgeschlossen und wird durch die so entstehende Abhängigkeit auf einmal über die simpelsten Lebensinteressen abgeschöpft – die explodierenden Mieten sind dafür das deutlichste Beispiel.
Das heißt: Im Leben der heutigen Bewohner der Bundesrepublik mehren sich die Erfahrungen, dass sie über die elementarsten Dinge in ihrem Leben keine Macht (mehr) haben. Dass immer schon ein fetter stacheliger Igel dasitzt und kichert: „Ich bin allhier!“ Und die Regeln bestimmt. Regeln für Malocher, die nicht mal genug verdienen, um später eine auskömmliche Rente zu bekommen. Dumping-Preise für Bauern. Schufa-Regeln für Selbstverständlichkeiten wie eine Wohnung. Zugangsregeln zu Bildung. Und natürlich auch die Entlohnung unersetzlicher gesellschaftlicher Arbeit, zu der die Care-Arbeit genauso gehört wie die Arbeit in den „systemrelevanten“ Berufen, die in diesem Corona-Jahr nach allen möglichen Regeln behandelt wurden, aber nicht nach Systemrelevanz.
Es wird in den Thesen dann sehr detailliert. Denn ein gründliches Nachdenken über eine wirklich funktionierende und die Welt bewahrende Marktwirtschaft führt zwangsläufig auch zu Fragen der Subsidiarität (demokratische Entscheidungen fallen möglichst dort, wo die Menschen direkt betroffen sind), der gerechten Steuern (die ohne eine ehrliche Vermögenssteuer nicht denkbar sind), der Generationengerechtigkeit (welches Einspruchsrecht haben eigentlich künftige Generationen, denen wir gerade die Existenzgrundlage verbrennen?) und selbst zur Grundsicherung, die nicht identisch ist mit dem heiß diskutierten bedingungslosen Grundeinkommen, aber einen ganz ähnlichen Sinn hat: Die Menschen endlich von der Angst zu befreien, ihre Existenz nicht mehr sichern zu können, wenn sie sich nicht dem Diktat der Vermarktung unterwerfen wollen, sondern lieber gemeinnützig arbeiten wollen.
Denn Gleichheit auf dem Markt setzt nun einmal auch voraus, dass kein Marktteilnehmer gezwungen sein darf, sich zu unzumutbaren Konditionen verkaufen zu müssen. Gut möglich – so vermuten es auch die beiden Autoren – dass viele Menschen dann auf einen Bullshitjob verzichten und Bullshit-Unternehmen dann einfach niemanden mehr finden, der für eine amoralische Arbeit seine Lebensvisionen wegschmeißt.
Man merkt schon, dass hinter den 30 Thesen tatsächlich das Bild einer Gesellschaft in Konturen sichtbar wird, die wieder Werte und Moral in den Mittelpunkt stellt und tatsächlich wieder das Wohlergehen ihrer Mitglieder wünscht, die – durch den Staat gesichert – auch wieder die gleichen Chancen haben, ihre Möglichkeiten im Leben auszuschöpfen.
Wovon im heutigen Deutschland nicht die Rede sein kann. Im Gegenteil: Selbst bis in den gehobenen Mittelstand hat sich die Angst verbreitet, eines Tages unverhofft aussortiert und abserviert zu werden, mit Verachtung gestraft zu werden, weil man im Rattenrennen um die Gunst der Mächtigen nicht mehr mithalten kann.
Gut: Und wie kommen wir da hin?
Im Teil „Der Weg zur Marktwirtschaft“ erörtern die beiden Autoren, an welchen Stellschrauben man drehen könnte, um – möglicherweise in mehreren kleinen Schritten – langsam zur Marktwirtschaft zu kommen, die sich für die beiden fundamental vom derzeit zelebrierten Kapitalismus der „shareholder“ unterscheidet. Es sind ernsthafte Vorschläge an unsere politischen Parteien, wie dieses Umdenken und Umschwenken angepackt werden kann.
Und die Bevölkerung dürften sie dabei meistens hinter sich haben, denn längst ist es in vielen Köpfen verankert, dass wir zu einem wirklich nachhaltigen und sozial verantwortlichen Wirtschaften kommen müssen, wenn wir unseren Enkeln überhaupt noch irgendeine irgendwie bewirtschaftbare Welt hinterlassen wollen.
Aber alles fängt mit dem Kern allen Wirtschaftens an: „Ein Schlüsselbereich ist die persönliche Haftung.“
Wer dort nicht ansetzt, wird das verantwortungslose Katastrophenwirtschaften von heute nicht beenden, bei dem alle Macht nicht bei den von uns gewählten Politiker/-innen liegt, sondern bei anonymen Anlegern und Anteilseignern, die nichts anderes im Sinn haben als ihren persönlichen Vorteil. Für den sie sich immer auf Adam Smith berufen, auch wenn sie dessen ethische Grundlagen einer Gesellschaft jeden Tag genüsslich mit Füßen treten.
Stephan Bannas; Carsten Herrmann-Pillath Marktwirtschaft: Zu einer neuen Wirklichkeit, Schägger Poeschel, Stuttgart 2020, 16,95 Euro.
Die Bodenfrage: Das hochaktuelle Buch zu einer Frage, die nie so brennend war wie heute
Die Bodenfrage: Das hochaktuelle Buch zu einer Frage, die nie so brennend war wie heute
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
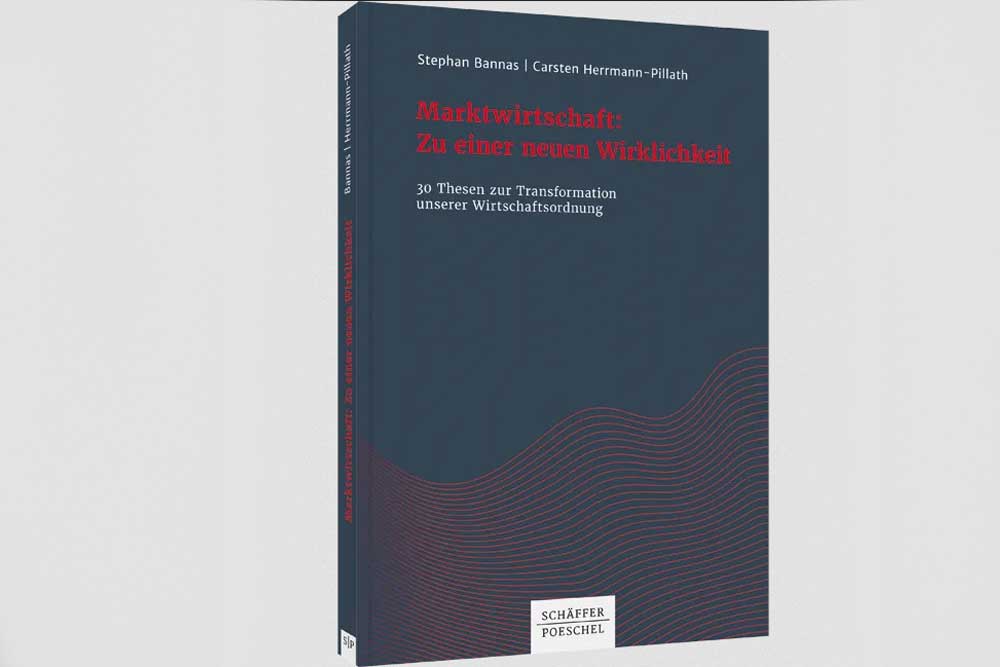
















Keine Kommentare bisher