Irgendwie fehlen die Worte für das, was 1989 geschehen ist. Selbst der Titel dieser profunden Aufarbeitung dessen, was an Initiativen von Frauen ab den 1980er Jahren in Leipzig entstand, versucht es mit Frauenbewegung, Revolte und Transformation. Was eine Menge darüber erzählt, wie schwer es noch immer fällt, die beiden disruptiven Jahre 1989 und 1990 einzuordnen. Es sind die politischen Worthülsen, die die Sicht auf die Wirklichkeit verstellen.
Dass da niemand revoltiert hat in Leipzig oder irgendeiner anderen Stadt der DDR, ist eigentlich bekannt. Nicht ohne Grund trägt gerade dieser Zeitenwechsel den Titel Friedliche Revolution. Wobei sich die Historiker selbst über das Wort Revolution streiten. Eben weil niemand revoltiert hat. Im Grunde war das Jahr 1989 nichts anderes als eine große Misstrauenserklärung der Regierten an die bis dahin Regierenden.
Quasi die logische Einlösung des Spruches, den Bertolt Brecht 1953 nach dem Aufstand vom 17. Juni schrieb, der eigentlich auch kein Aufstand war, sondern ein Ausstand, ein Streik, wie ihn sich die moskaugeschulten Regierenden nicht erwartet hatten: „Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht doch einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?“
Womit Brecht ja das ganze paternalistische Denken der eigentlich schon 1953 vergreisten Staats- und Parteiführung auf den Punkt brachte. Die ganz in diesem Sinn bis zuletzt das „Volk“ behandelte wie einen unmündigen Lümmel, dem man vorschreiben musste, was er zu machen und wie er sich zu benehmen hatte. Und der dann väterlichst bestraft wurde, wenn der Lümmel wagte, eigene Gedanken zu hegen oder gar dem Vater zu widersprechen.
Wobei selbst dieses Bild schon viel zu simpel ist. Der vormundschaftliche Staat steckte in allen Institutionen, in den Köpfen sowieso. Und er war so allgegenwärtig, dass die Regierten meist gar nicht merkten, wie er ihr Leben formte und deformierte. Deswegen war die Demontage der Zustände auch nur Angelegenheit einer Minderheit, die bereit war, das falsche Denken zu hinterfragen und damit auch die herrschenden Verhältnisse. Die durch und durch paternalistische waren. Das ist vielen Ostdeutschen bis heute nicht bewusst. Vielen Frauen schon, die 30 Jahre nach dem großen „Nein“ oft immer noch das Gefühl haben, dass der begonnene Kampf noch immer läuft und noch immer zählebig ist.
Jessica Bock hat zu diesem Thema 2018 an der TU Dresden ihre Dissertation vorgelegt, die in leichter Überarbeitung Grundlage für dieses Buch ist, das sich ganz konkret der Szene der Leipziger Fraueninitiativen widmet, die ab den frühen 1980er Jahren entstanden. Sie waren Teil der seit der Biermann-Ausbürgerung zunehmenden Emanzipation vor allem junger Menschen, die das Sprachlossein nicht mehr aushielten und nach Freiräumen suchten, in denen sie unzensiert und ehrlich über das sprechen konnten, was ihnen wichtig erschien.
Die viel beschworene Oppositionsbewegung in der DDR war zuallererst eine Selbstermächtigung zum unverstellten Sprechen. Und das betraf auch die jungen Frauen, die nicht mehr bereit waren, sich in das von der SED propagierte Bild der werktätigen Mutter und Ehefrau drängen zu lassen. Gleichberechtigung gab es auf dem Papier. Aber wie wenig die tatsächlich im Alltag der Frauen eingelöst war, brachte 1977 der Protokollband „Guten Morgen, du Schöne“ von Maxie Wander zur Sprache.
Ein Buch, das auch heute noch gern zitiert wird, um auf die Emanzipiertheit der Frauen in der DDR zu verweisen, die es durchaus gab. Aber im Alltag war davon wenig einlösbar, in der Politik schon mal gar nicht. Denn Emanzipation heißt nun einmal auch: freie Entfaltung, freies Sprechen, ehrlicher Umgang miteinander. Und natürlich: Hinterfragen der Machtstrukturen. Auch der heimischen, familiären.
Was ziemlich schnell deutlich wird, wenn Jessica Bock die frühen Ansätze Leipziger Frauen beschreibt, eigene Organisationsstrukturen abseits der staatlich vorgegebenen zu schaffen, Orte, wo Frauen sich über die Rolle verständigen konnten, die sie in der schein-egalitären Gesellschaft tatsächlich spielten. Die Zumutungen der Dreifachbelastung Arbeit, Haushalt, Familie zum Beispiel, die diskriminierende Wirkung eines paternalistischen Familienbildes, aber auch die berechtigten Ängste, die der neuen Militarisierung entsprangen.
Doch der Versuch, ein Frauenzentrum zu gründen, endete 1983 durch die massive Verhinderung durch SED und MfS. Die reagierten auf die Versuche der Frauen, sich in eigenen Strukturen zu emanzipieren, genauso rabiat wie auf alle anderen Versuche einer Emanzipation. Was letztlich zur Folge hatte, dass sich spätere Versuche in den Schutzraum der Kirche zurückzogen.
Statt die Chance zu wirklichem Dialog wahrzunehmen, versuchte die allein seligmachende Partei jeden nicht genehmigten Gedanken zu diskriminieren und zu kriminalisieren. Als die Genossen 1989 das Wort Dialog wiederentdeckten, war es nicht nur um ein paar Tage oder Monate zu spät, sondern um ein ganzes Jahrzehnt.
Denn den Menschen, die sich da artikulieren wollten, machte das stupide Vorgehen endgültig klar, dass mit diesen Männern kein Gespräch zu führen war. Das keineswegs Erstaunliche ist, dass viele der Frauen, die in den 1980er Jahren an der Gründung solcher Gesprächskreise und Initiativgruppen beteiligt waren, durch die Erfahrungen mit dem mauernden Staat erst recht bestärkt wurden, sich fortan nicht mehr anpassen und unterkriegen lassen zu wollen.
Mehr als 30 dieser Frauen hat Jessica Bock interviewt, hat mit ihnen über die Schwierigkeiten und Erfolge ihrer Initiativen gesprochen. Und je intensiver sie über etwa „Frauen für den Frieden“, den „Lila Lady Club“ oder die „Frauengruppe Grünau“ erzählt, umso deutlicher wird, dass auch die feministische Bewegung Teil der Friedlichen Revolution war. Das wird genauso gern vergessen wie die vielen anderen Strömungen in diesem Aufbruch 1989.
Aber Jessica Bock lässt die Geschichte nicht 1989 enden. Denn gerade dieses Jahr zeigte, dass die DDR selbst von den aktiv werdenden Männern nicht als der patriarchalische Staat begriffen wurde, der er bis zum Schluss war. Und darüber hinaus, darf man sagen. Denn die Frustrationen, die die engagierten Frauen im Herbst 1989, an den Runden Tischen, in den Wahlen des Jahres 1990 und den ersten parlamentarischen Erfahrungen erlebten, sollten sich auch darüber hinaus fortsetzen. Männer rissen die Redezeiten an sich, drückten ihre Themen und Ansichten durch. Und eigentlich auch wieder ihre Art, Politik zu machen, Posten zu besetzen und zu denken – zutiefst paternalistisch, mit Wohltäter- und Gönnergeste.
Was dann auch zum Teil erklärt, warum die Leipziger Fraueninitiativen nach einem kurzen Aufbäumen der Fraueninitiative Leipzig (FIL) politisch keine Rolle spielten und sich die anfangs politisch aktiven Gründungen von 1989 nach und nach in Vereinsstrukturen verwandelten, die die ersten Jahre eigentlich nur damit beschäftigt waren, Gelder und Räume zu besorgen, um überhaupt arbeiten zu können. Viele strichen dann trotzdem Ende der 1990er Jahr die Segel. Was nicht heißt, dass das Engagement ganz vergeblich war. Denn die Leipziger Frauenhäuser, das Mütterzentrum, die Frauenkultur, aber auch das Referat Gleichstellung sind Ergebnis dieses oft sehr kräftezehrenden Bemühens, das – aus Sicht amtswaltender Männer – meist nur ein unwichtiges ist. Frauenthemen eben.
Und der Blick in die Gegenwart zeigt nur zu deutlich, wie leicht es sich ein Wählervolk da 1990 gemacht hat, als es die eine paternalistische Gesellschaft einfach gegen die andere austauschte. Die Chance, den Neubeginn auch als eine gemeinsame, mutige Emanzipation von veralteten Geschlechterrollen zu begreifen, wurde gründlich vertan. Was auch die Friedliche Revolution zu einer der vielen unvollendeten Revolutionen in der deutschen Geschichte gemacht hat.
Natürlich reflektiert Jessica Bock auch immer wieder das Verhältnis der engagierten Frauen im Osten zur feministischen Bewegung im Westen. Und zumindest für die 1980er Jahre galt, dass die Differenzen sehr wohl existierten. Die feministische Bewegung im Westen hatte naturgemäß einen größeren Vorlauf und andere Rahmenbedingungen.
Zu denen aber auch die überlebenden patriarchalischen Vorstellungen und Strukturen der Gesellschaft gehörten. Mit den bekanntesten Autorinnen aber sickerte dieses Bewusstsein auch in die Initiativen im Osten, auch wenn auch die Leipziger Frauen bis 1990 durchaus mit Recht darauf beharrten, einen eigenen Weg zu gehen mit einer letztlich größeren Themenbreite.
In den 1990er Jahren freilich kamen sich die Frauenbewegungen in West und Ost zusehends näher, da sie nun ja auch unter den gleichen prekären Bedingungen arbeiteten und in derselben von Männern dominierten Welt, in der gerade die dominierenden Männer nicht einmal merken, wie sie Macht, Einfluss und Definitionsraum an sich gerissen haben und Frauen nach wie vor als schönes Beiwerk und fleißige Hausfrau betrachten, die bitteschön dafür zu sorgen haben, (mit kostenloser Heimarbeit) dass ihr Laden läuft und sie sich um Familie und Kinder nicht kümmern brauchen. Und deutlicher wurde auch, wie männliche Vorstellungen von Hierarchien und Wirtschaften dafür sorgen, dass Frauen weiter marginalisiert sind – und zwar in allen gesellschaftlichen Bereichen.
Nur dass sich auch langsam die Ahnung durchsetzt, dass diese Hierarchien in den Köpfen sitzen und letztlich dafür sorgen, dass Karrieremuster männlich gedacht und strukturiert sind und für Frauen in keiner Weise attraktiv. Dass Frauen überall dort, wo Entscheidungen getroffen werden, fehlen, hat auch damit zu tun, dass der Weg dorthin eine Zumutung ist. Für Frauen eine doppelte und dreifache, weil nach wie vor stillschweigend davon ausgegangen wird, dass sie trotzdem (nebenher) die Sache mit Haushalt und Kindern im Griff haben.
Insofern ist natürlich das, was den Leipziger Frauen passiert ist, symptomatisch für die Frauenbewegung im ganzen Osten, mit der die Leipziger Initiativen teilweise über intensive Netzwerke verbunden war. Aber man kann auch regelrecht zuschauen, wie sich die engagierten Frauen zerrieben haben in diesem Kampf um Wahrnehmung und Anerkennung und letztlich dem Versuch, auch politisch Gehör zu bekommen. Was wohl mit dem Wort Marathon heillos untertrieben beschrieben wäre.
Dass viele sich dann in den 1990er Jahren lieber entschlossen, jetzt die Chancen auf ein Studium oder eine neue Berufsperspektive wahrzunehmen, ist nur zu verständlich. Andere wurden von dem voll erwischt, was im Titel als Transformation auftaucht – oft wurden nämlich gerade die Betriebe besonders schnell geschlossen, in denen vorher besonders viele Frauen beschäftigt waren. Viele Frauen zeigten dann zwar erstaunlich viel Bereitschaft, sich völlig neu zu orientieren. Aber auch das kostete Kraft und veränderte Biografien dramatisch. Da hatten manche, ohne die die Diskussionen von 1989 und 1909 nicht denkbar gewesen wären, schlicht nicht mehr die Kraft und die Zeit, sich weiter in zumeist unhonorierten Ehrenämtern einzubringen.
Aber gerade weil Jessica Bock diese Schwierigkeiten zeigt, macht ihr Buch sehr deutlich, dass etwas Wichtiges fehlt, wenn man die Friedliche Revolution ohne die Fraueninitiativen erzählt und ohne das überhaupt nicht unwichtige Element des Feminismus. Das Wort vermieden die Frauen zwar zumeist, weil es durch SED-Propaganda vorbelastet war. Aber letztlich handelten sie dennoch genau in diesem Sinne: der selbstbewussten Frau, die ihre Rolle nicht mehr länger durch Männer definiert sehen möchte.
Dass die Emanzipation freilich im Schlamm stecken bleibt, wenn sich nicht auch die Männer von den falschen Männermustern emanzipieren, wissen wir heute. Die Themen – die z. B. auch die ambitionierte Zeitschrift „Zaunreiterin“ oder Petra Lux in ihren DAZ-Kolumnen anschnitten – sind so aktuell wie vor 30 Jahren. Und gehen weiter, oft ungesehen von der breiten Öffentlichkeit, die nach wie vor mit männlichen dominierten Schauspielen der Macht gefüttert wird.
Nur gelingt es den Herren im grauen Anzug schwerer, die Wortmeldungen der Frauen zu ignorieren und wegzudrücken. Der Harnisch hat Kratzer und Dellen bekommen. Und so recht vertrauenswürdig sind die alten patriarchalischen Vorstellungen vom Zurichten der Welt auch nicht mehr.
Nur sorgt die Tatsache, dass Frauen in unserer Welt systematisch überbeansprucht werden, auch dafür, dass sie nach wie vor nicht die Freiräume der Männer haben, sich Gehör zu verschaffen.
Aber da bin ich schon weit über das Jahr 2000 hinausgeschossen, mit dem Jessica Bock ihre Untersuchung beendet. Ein Jahr, mit dem im Grunde auch das spezifisch Ostdeutsche in der ostdeutschen Frauenbewegung endet und viele spannende Projekte, mit denen die Leipziger Frauen in die neue Zeit gestartet sind, beendet wurden, weil sie in den neuen Strukturen einfach nicht die nötige Unterstützung fanden. Von der Härte dieser 1990er Jahre ganz zu schweigen, die nicht nur Frauen oft an den Rand ihrer Kräfte und ihrer Zuversicht gebracht hat – das, was so schön technisch „Transformation“ genannt wird, obwohl Transformation für die Transformer etwas völlig anderes ist als für die Transformierten.
Aber auch das geht natürlich über diese sehr detaillierte Untersuchung hinaus, in der die befragten Frauen auch sehr emotional werden. Denn all das, was vor 1990 die staatlichen „Organe“ zu verbissener Tätigkeit herausforderte, haben sie immer mit Herzblut betrieben. Genauso, wie sie sich 1989/1990 mit aller Kraft in die Politik warfen, nicht ahnend, dass sie hier wieder Niederlagen erleben würden, die davon erzählen, wie zäh das alte Denken in männlichen Verantwortungsstrukturen ist. Was zuweilen den Eindruck erweckt, dass der Feminismus glücklich erlegt wurde von tollkühnen Jägern, die die Wortmeldungen von Frauen immer für eine Störung in ihrem Verwaltungshandeln empfunden haben.
Sind also die Töchter und Enkelinnen weniger feministisch? Wahrscheinlich nicht. Sie setzen wohl eher ohne viel Aufhebens die Kämpfe ihrer Mütter und Großmütter fort und erobern sich durch Beharrlichkeit Räume, die sture Männer nie im Leben freiwillig hergeben würden.
Ein überfälliges Buch eigentlich, das in komprimierter Fülle zeigt, dass auch die Friedliche Revolution in Leipzig ohne engagierte Frauen und eine gehörige Prise Feminismus nicht denkbar war. Und ist.
Jessica Bock Frauenbewegung in Ostdeutschland, Mitteldeutscher Verlag, Halle 2020, 48 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
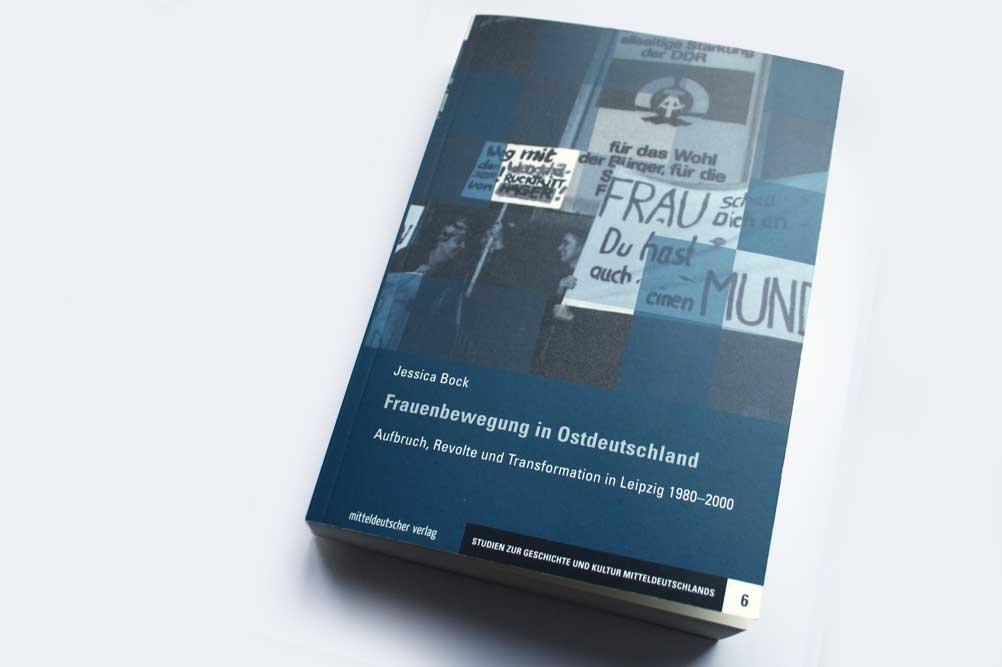















Keine Kommentare bisher