Manch einer – nicht nur in ostdeutschen Wohnzimmern – wird sich dieser Tage wieder eine Schallplatte auflegen, ohne die das Weihnachten hierzulande kaum mehr denkbar ist: das „Weihnachtsoratorium“ von Johann Sebastian Bach, eingespielt 1974 mit Peter Schreier. Zu diesem Weihnachtsfest wohl erst recht. Denn vor einem Jahr starb der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Tenor am ersten Weihnachtsfeiertag. Da trauerte nicht nur Dresden.
Und es trauerten auch nicht nur die Musikliebhaber. Davon erzählt dieses Buch. Denn der Musikwissenschaftler Mattthias Herrmann hat dafür nicht einfach alle möglichen berühmten Leute angefragt, die durchaus auch aus ganz persönlicher Sicht hätten erzählen können, was sie mit Peter Schreier und seinem Musikschaffen verbindet, sondern vor allem musikalische Weggefährten, die den einstigen Kruzianer und wohl berühmtesten Tenor der DDR auch in der täglichen Arbeit kennengelernt haben.
Also die Leute, die freche Journalisten auch gern fragen, wenn sie mal ein paar Kollegenbosheiten und Insider-Karamellen über einen berühmten Künstler haben möchten. Und die Erfahrung sagt ja, dass die Stars in der Manege nicht immer übereinstimmen mit dem Menschen hinter den Kulissen. Über manch berühmten Musiker gibt es durchaus belegte deftige Anekdoten.
Aber Peter Schreier unterschied sich selbst da von manchen Kollegen. Und es sieht ganz so aus, als wäre genau das auch ein Teil der stillen Verehrung, die die Bewohner/-innen der DDR für diesen Weltstar hatten – über sein besonderes Können als Tenor hinaus. Herrmann lässt zwar auch den japanischen Musikwissenschaftler Kazuo Fujino zu Wort kommen, der sich ernsthaft darüber wundert, warum Peter Schreier im Herbst 1989 so stumm blieb, während Kurt Masur in Leipzig ein „heroisches Verhalten“ zeigte.
Es ist schon erstaunlich, wie Medienberichte die Wirklichkeit verzerren. Masur selbst hätte sein Agieren – zum Beispiel beim „Aufruf der Sechs“ oder bei den Gewandhausgesprächen – wohl nimmer „heroisch“ genannt. Dazu war er zu sehr Pragmatiker und kannte die verantwortlichen Parteifunktionäre zu gut. Und so viele andere klassische Musiker, die sich persönlich in die Friedliche Revolution einbrachten, wird man nicht finden. Musiker machen für gewöhnlich keine Revolutionen. Das können andere besser.
Und sie haben ein anderes Verhältnis zum Volk, das ja nun einmal als Publikum in ihren Konzerten sitzt und durchaus dankbar ist dafür, wenn vorn auf der Bühne und im Orchester wirklich eine Glanzleistung geboten wird und die Solisten es wirklich schaffen, die Herzen der Zuhörer/-innen zu ergreifen.
Das erlebt so mancher selbst als sehr persönliche Revolution. Und Schreier gehörte zu denen, die diese Saiten in ihrem Publikum zum Erklingen bringen konnten – weshalb er auch in Japan so bedingungslos geliebt und verehrt wurde und tatsächlich über 30 Mal zu Auftritten in seine „zweite Heimat“ Japan flog.
Was übrigens auch das Herz der Japaner für dieses winzige Ländchen DDR aufschloss. Was wieder die Funktionäre in Ostberlin nur zu gut wussten: Sie schickten die besten Musiker und Orchester ganz bewusst als Botschafter für ihr Ländchen in die Welt. Das war sogar einer ihrer vernünftigsten Gedanken, denn wer Musiker schickt statt Flugzeugträger oder Handelssanktionen, der sendet eine durchaus friedliche Botschaft.
Das steht so zwar nicht im Buch. Dazu hätte es vielleicht einen politischen Kopf gebraucht, das einmal mehr zu formulieren in einer Zeit, in der die Bundesregierung stur an der Erhöhung des Bundeswehretats arbeitet und immer neue Rüstungsexporte genehmigt.
Die vielen Dirigenten-, Sänger- und anderen Musikerkolleg/-innen, die auf Herrmanns Anfrage hin ihre Erinnerungen an den berühmten Tenor niederschrieben, erzählen nun von etwas anderem, was die Bewohner des Ländchens DDR ebenso beeindruckte: Schreiers hohe Professionalität, seine Kollegialität und seine Fähigkeit, auch die Fähigkeiten seiner Mitschaffenden zu respektieren.
So wünscht man sich eigentlich immer zu arbeiten mit jemandem, dem sein Ruhm nicht zu Kopf steigt und der sich immer als Gleichgesinnten und Gleichen betrachtet. Und der vor allem auch das Publikum achtete wie selten jemand, der von Routine und ziselierter Kunstfertigkeit überhaupt nichts hielt, sondern selbst dann, wenn er gesundheitlich schlecht drauf war, trotzdem versuchte, das Beste zu geben.
Und Musiker hören das ja sogar heraus, wo Zuhörer/-innen oft einfach nur das Gefühl haben, zutiefst ergriffen zu sein. Und Schreiers Rolle als Evangelist im Weihnachtsoratorium scheint für viele, die es live erlebten, ein Schlüsselerlebnis beim Begreifen dieses grandiosen Werks gewesen zu sein. Was nicht nur an seiner klaren Aussprache und Intonation lag, sondern auch daran, dass er die Rolle selbst ausfüllte, eben nicht nur kunstfertig darbot, sondern sich ganz einfühlte in die Rolle des Erzählers, der eine unerhörte Geschichte erzählen will.
Und auch als Dirigent scheint Schreier dieses Talent besessen zu haben, aus den versammelten Musiker/-innen das herauszuholen, zu was sie fähig waren. Was meist viel mehr ist, als es vielen Dirigenten gelingt, die unbedingt Chören und Orchestern ihre eigene Spielart aufzunötigen versuchen. In gewisser Weise lebte ja Peter Schreier künstlerisch vor, wie dieses Land DDR eigentlich hätte sein können, wenn die verängstigten Funktionäre auch nur ein einziges Mal den Mut besessen hätten, „ihre Menschen“ so zu behandeln: als Könner, Begabungen, Hochtalentierte, die eigentlich nur entfalten wollten, was alles in ihnen steckte.
Aber den Allerwenigsten war eine Karriere möglich, wie sie Peter Schreier erlebte, der schon frühzeitig Förderung und Anerkennung bekam – im Kreuzchor genauso wie später im Studium. Und natürlich hatte er das Glück, dass es auf den Opernbühnen Europas immer nur ganz wenige Sänger gibt, die ihre Stimme so professionell beherrschen wie Peter Schreier.
Der damals schon berühmte Fritz Wunderlich sah in dem jungen Mann aus Dresden einen echten Nachfolger. Und da solche hochkarätigen Sänger auf den Opernbühnen immer gefragt sind, sang Schreier ab den 1960er Jahren auf den wichtigsten Opernbühnen Westdeutschlands und Österreichs. Und so mancher Kollege trägt sich mit der Frage: Warum ist er dann nicht im Westen geblieben?
Schreier verwies an solchen Stellen immer darauf, dass er eigentlich nicht weg wollte aus seiner Dresdner Heimat. Wozu ja noch kommt, dass er in Berlin, Dresden und Leipzig mit hochkarätigen Klangkörpern zusammenarbeitete und im Lauf der Zeit Dutzende Schallplatten einspielte, die auch heute noch immer wieder aufgelegt werden, weil es kaum Besseres an Aufnahmen zu den einzelnen Musikstücken gibt. Und das betrifft nicht nur Bach. Er hat ja auch Mozart, Schumann, Beethoven, Schubert und Wolf auf höchstem Niveau gesungen. Sogar mit Wagner-Rollen hat er brilliert.
Und ganz bestimmt war er ein Phänomen, manchmal auch ein omnipräsentes, denn zur Weihnachtszeit war er eigentlich aus allen Radios zu hören. Von etlichen seiner Konzerte gibt es eindrucksvolle Fernsehaufzeichnungen, die sich so mancher wieder in der Ausstrahlung wünscht, denn in den Mediatheken der Sender findet man diese Aufzeichnungen nicht.
Da findet man eher eine mediale Flut von lauter Trauerbekundungen zu Schreiers Tod vor einem Jahr. Eine Trauerflut, die man nicht recht ernst nehmen kann, wenn das Schaffen des Verstorbenen selbst so völlig im Unsichtbaren versinkt oder – wie auf Youtube – nur auf lauter dubiosen Drittkanälen weiterlebt.
So gesehen ist das Buch eine Würdigung, die die großen Sendeanstalten einfach nicht hinbekommen haben. Es versammelt nicht nur die persönlichen Würdigungen von Dirigenten, Sängern, Pianisten, Musikforschern und anderen Wegbegleitern des begnadeten Tenors, sondern auch vier Reden zu Preisverleihungen an Peter Schreier, die wieder auf eigene Weise die Arbeit und die Besonderheit des Sänger-Dirigenten würdigen.
Drei Beiträge beschäftigen sich dann eher theoretisch (und trotzdem begeistert) mit der Art, wie Peter Schreier seine Lieder und Rollen interpretierte und damit Maßstabsetzendes schuf. Und neben zwei Ansprachen zur Trauerfeier im Januar 2020 gibt es auch noch einen Bildteil, der den Berühmten noch einmal in einigen der immer wieder erwähnten Projekte zeigt.
Es ist ein Buch geworden, das eine vielstimmige Verehrung für den über 60 Jahre auf der Bühne stehenden Musiker bündelt, gespickt mit Erinnerungen an echte Höhepunkte der jüngeren europäischen Musikgeschichte – mit eindrucksvollen Opernrollen und eindringlichen Liedprogrammen, die vor allem die beteiligten Musiker/-innen natürlich auch und gerade vom Fachlichen her würdigen können. Oft mit dem durchaus lesbaren Wunsch, es wäre ihnen im Leben dieselbe souveräne Gelassenheit gegeben gewesen.
Denn manche Glanzvorstellung scheitert ja daran, dass man sich viel zu sehr bemüht und dabei verpasst, sich ganz in den Dienst der Musik zu stellen. Und dieses Der-Musik-Dienen war bei Schreier immer spürbar und erlebbar. Wozu man natürlich auch das Grundvertrauen in die eigenen Möglichkeiten braucht. Etwas, was dem Neuzeit-Menschen immer seltener gegeben zu sein scheint. Was eben auch das Ergebnis einer Gesellschaft ist, die mit Fähigkeiten und Begabungen eigentlich nicht umgehen kann. Und sie deshalb auch nicht wertschätzt. Und sogar meint, auf sie verzichten zu können in einer Zeit wie dieser.
Was sehr wesentlich dazu beiträgt, dass es in unserer Gesellschaft kälter, ruppiger und gleichgültiger zugeht. Dabei geht es in jedem einzelnen Menschenleben immer darum, das Beste aus den eigenen Anlagen zu machen. Und damit sind nicht Geldanlagen gemeint, sondern all die Befähigungen, die eine Gesellschaft erst wirklich reich und lebendig machen und Menschen auch wieder so souverän, wie es Peter Schreier war.
So ist das Buch ganz in der Stille auch ein Widerspruch zu einer Gesellschaft, die sich nicht mehr wirklich für etwas erwärmen und begeistern kann. Und die nicht mal weiß, warum einem beim Weihnachtsoratorium, wenn es von Könnern vorgetragen wird, das Herz aufgeht. Als dürfte man einmal im Jahr wieder Mensch sein. Was eigentlich ein bisschen wenig ist, um es einmal so zu formulieren.
Matthias Herrmann Begegnungen mit Peter Schreier, Sax Verlag, Beucha und Markkleeberg 2020, 24,80 Euro.
Frohe Weihnacht mit der neuen „Leipziger Zeitung“ oder: Träume sind dazu da, sie mit Leben zu erfüllen
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
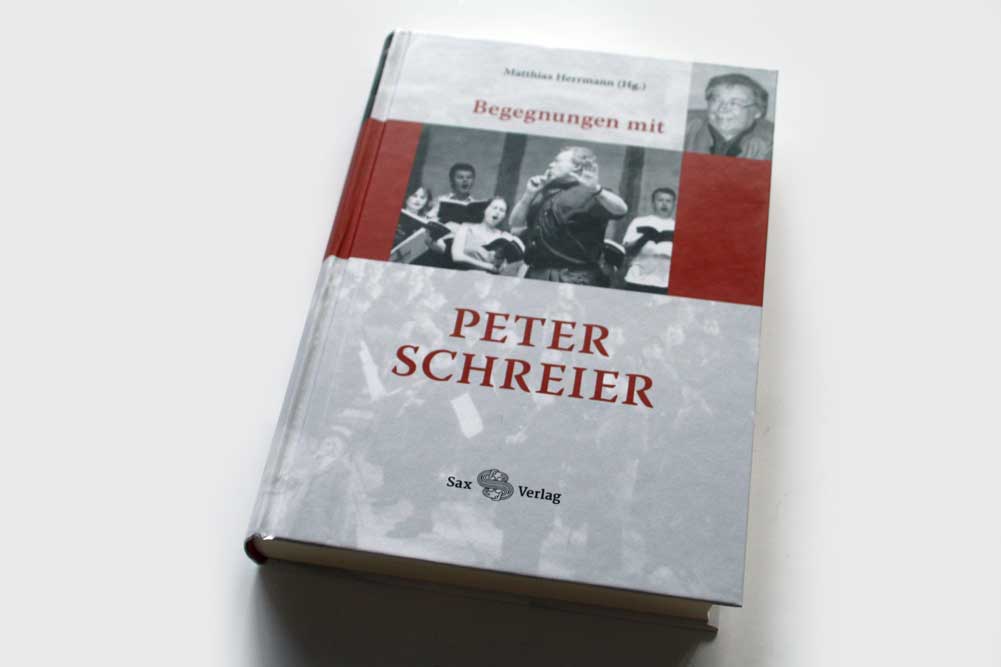











Keine Kommentare bisher