Nein, ein Roman ist das eigentlich nicht, auch wenn es draufsteht und der Münchner Autor Andreas M. Bräu hier sein Debüt im längeren Genre vorlegt. Eher ist es eine Studie, so etwas, was Autoren wie Balzac und Flaubert dereinst als Stilübung veröffentlichten. In diesem Fall: eine Studie über die Partnerwahl junger Münchner in Zeiten der radikalen Erwartungen an den perfekten Partner. Eigentlich die ideale Voraussetzung dafür, dass überhaupt niemand mehr einen Partner zum Leben findet.
Wobei Bräu ja nichts Unrealistisches schildert, wenn er Tim und Marianne in parallelen Handlungen auf die Suche gehen lässt. Ganz ähnlich läuft das ja heute tatsächlich ab in allen deutschen Universitätsstädten. Oder vielleicht doch vorsichtiger formuliert: So lief es vor Corona ab, als alle Szenekneipen noch ohne Einschränkungen geöffnet waren, sich die jungen Leute in Bars, Freisitzen und Tanzlokalen treffen konnten, um andere junge Leute kennenlernen, sich verabredeten und dabei Unmengen von Alkohol in sich hineinschütten konnten.
Und manch Leserin und Leser wird sich wiedererkennen in dieser frühen Not, die sich gerade in Tims Kopf abspielt wie eine ununterbrochene Prüfung mit Fragen, die kein Mensch wirklich beantworten kann. Die aber zu unserer Gegenwart gehören, in der auch die Partnersuche der Menschen sichtlich zum Spielfeld einer gnadenlosen Be- und Verwertungslogik geworden ist. Und das nicht nur in Online-Portalen. Wer das glaubt, wäre naiv.
Die Matrix steckt in der Werbung mit völlig überzogenen Schönheitsidealen, in verlogenen Filmserien, auch in Medien – und zwar nicht nur Boulevardmedien. Stapelweise erklären Ratgeberbücher, wie man den idealen Partner findet, wie man richtig auf Partnerfang geht, wie man sich kleiden, schminken und fit machen muss für einen gnadenlosen Wettbewerb um Mister Right oder das Superweib. Wie man seine (Wettbewerbs-)Chancen, seine Flirt-Qualitäten und Bettkünste verbessert. Das Gespenst sitzt in den Köpfen der jungen Menschen. Und das Ergebnis ist: In diesem Buch ist niemand gelassen.
Auch Marianne nicht, obwohl sie gerade ihre lange Partnerschaft mit Hannes beendet hat, den sie aus ihrer Heimatgemeinde mitgebracht hat nach München zum Studium. Aber irgendwie ist aus dieser Partnerschaft die Luft raus. Marianne ist also da, wo ihre Freundinnen schon lange sind: solo und auf der Suche nach dem Burschen, der sie wirklich glücklich macht. Oder wenigstens die Anlagen dazu hat. Auch wenn das Marianne eigentlich nicht liegt.
Sie erwartet von den Männern wirklich mehr als eine gute Leistung im Bett, auch wenn sie nach dem Zusammenleben mit Hannes nicht so recht weiß, was es eigentlich ist. Nur eins merkt man schnell: Sie zieht Grenzen, ist schnippisch, fordert heraus und liebt es, auch Männern die Wahrheit ins Gesicht zu sagen.
Wenn alle Frauen so wären …
Es wäre anders. Und wohl auch weniger rührselig, weniger von all diesen abgesehenen und angelernten Rollenspielen geprägt, in denen die beiden Geschlechter irgendwie versuchen, irgendwelchen falschen Erwartungen aus verlogenen Filmen zu genügen. Und am Ende dann doch bei den Falschen landen, in unaushaltbaren Leben, in denen man dann schlecht kaschiert, wie unwohl man sich darin befindet.
Und Tim? Der liegt auch noch mit seinem Studium über Kreuz, er möchte ja gern ein guter Pianist werden, aber nicht so ein klassisch durchtrainierter, wie es sich sein Prof. vorstellt, um dann mit anderen hochtrainierten Mitbewerbern um die raren Stellen in der klassischen Musik zu buhlen. Er spielt schon längst in Münchner Bars, wo er seiner Freude am Jazz freien Lauf lassen kann. Und seine Vorstellungen von der richtigen Frau hat er ausgerechnet aus der Oper: Keine hat ihn je so beeindruckt wie die Marschallin im „Rosenkavalier“.
Entsprechend misstrauisch geht er mit all den Begegnungen mit den jungen Frauen um, denen er bei den nächtlichen Streifzügen durch Schwabing mit seinem Freund Beni begegnet, Frauen, die augenscheinlich nur zu gern bereit sind, mit dem Burschen etwas anzufangen. Doch selbst wenn er sich mit ihnen trifft, stellt sich schnell das Gefühl ein, dass er diese Beziehung nicht wird durchhalten können. Selbst sein Lieblingscafé riskiert er auf diese Weise.
Man wundert sich nur, dass Geld für ihn scheinbar überhaupt kein Problem zu sein scheint. Augenscheinlich nimmt uns Bräu hier mit in die Welt der gut versorgten Kinder eines wohlhabenden Mittelstandes, die sich auch leisten können, ein Studium in einem Fach aufzunehmen, das später nicht wirklich einen handfesten Broterwerb verspricht.
Die sich auch um die Preise für die Getränke in den angesagten Bars nicht kümmern müssen, die auch nicht in WGs leben müssen. Zeichen, die man nicht übersehen darf: Dieser ganz spezielle Partnersuch-Stress ist der Stress der oberen Mittelklasse, die gern so tut, als wären ihre Maßstäbe die Maßstäbe für alle. Obwohl es keine Maßstäbe sind, sondern Preisschilder.
Uneingestandene Preisschilder.
Natürlich hat jeder Mensch seine Vorstellungen von dem Menschen, den er im Leben gern an seiner Seite hat.
Das ist aber nur das eine.
Fast alle stolpern wir irgendwann darüber, dass es bei Liebe, Sex und Vertrauen munter durcheinandergeht, dass man sich gerade in den hormonbefeuerten Jahren oft in die oder den Falsche/-n verliebt und trotzdem gar nicht anders kann, weil die Natur das so eingerichtet hat. Der sind unsere gesellschaftlichen und kulturellen Standards völlig egal. Die lässt Weibchen und Männchen geradezu blind agieren in dieser Zeit.
Und wer sich wirklich erinnert, wie das war, der weiß das auch. Und ist, wenn er ehrlich ist, froh, wenn er oder sie heil aus diesem Schlamassel herausgekommen ist und irgendwann so wach war, die anderen auch noch nach etwas anderem einzuschätzen als nur dem Feuerwerk im Bett, im Heu oder auf der Rückbank des Autos.
Ein wenig davon glimmt in diesem Tim, den man stellenweise zum Mond schießen könnte, wenn er die nächtlichen Ausflüge nur zum Besaufen nutzt und dann Marianne auch noch besoffene Tweets schickt.
Aber anders als selbst seinem Freund Beni geht es ihm nicht um „Eroberungen“. Er hat tatsächlich den Wunsch, dass die Frau, die er sucht, ihm erwachsen begegnet, ihn ernst nimmt und ihn fordert. Dass er ausgerechnet die Marschallin als Vorbild sieht, verwundert einen vielleicht nur, wenn man kein Richard-Strauß-Verehrer ist. Bei Tim hat das auch mit der Musik zu tun. Man möchte nicht sein Wohnungsnachbar sein, wenn er die Musik voll aufdreht.
Und natürlich treffen sich die beiden irgendwann. So, wie sich Menschen treffen, wenn sie tatsächlich offen für diesen Moment sind, in dem einem das Gesuchte und Vertraute unverhofft doch noch begegnet. Das, was einen am anderen Geschlecht wirklich immer fasziniert hat und was mit „verwandte Seele“ so schlecht beschrieben ist.
Mit „auf gleicher Wellenlänge“ eigentlich auch. Denn für Tim hören ja die Irritationen nicht auf, obwohl er sich mit der schlagfertigen Marianne so wohl und herausgefordert gefühlt hat wie mit noch keiner Frau. Auch nicht mit der tapferen Gloria, die so vollkommen das Bild von der passiv Erwartungsvollen erfüllt hat.
Mensch, Mädchen, möchte man dazwischenrufen: Mach dich doch nicht so abhängig von den Kerlen! Es ist dein eigenes Leben!
Aber da würde man wohl verleugnen, wie verlogen unsere Gesellschaft nach wie vor ist und dass die alten Stereotype und Machtverhältnisse immer noch weiterwirken, trotz #metoo und aller Emanzipation: Frauen haben keine Chance, ein gleichberechtigtes Leben zu leben, wenn sich die Kerle mit den dicken Hosen und Portemonnaies nicht endlich emanzipieren. Wobei ich wieder bei den oben skizzierten Bildern aus Film und Fernsehen bin: Es ist das anschmiegsame Weibchen, das dort promotet wird, die (blonde) Schöne, die alles tut, um dem Affenmännchen zu gefallen.
Deswegen kann man Tim am Ende eigentlich nicht wirklich böse sein, weil er in seinem Fall ehrlich ist – und auch ehrlich leidet, als Marianne sich tagelang nicht meldet. Das stürzt jeden Mann in tiefste Verzweiflung, der sich wirklich verliebt hat. Erst recht, wenn er weiß, dass solche Frauen wie Marianne selten sind. Und noch viel seltener ausgerechnet dort, wo man nach ihnen sucht.
In gewisser Weise ist es also eine Liebesnovelle, die diesmal nicht – wie man das von Flaubert oder Maupassant kennt – tragisch scheitert. Und die auch nicht so ausgeht wie in Balzacs sarkastischen Analysen des Ehelebens. Die beiden bekommen ihre Chance, die Studie geht optimistisch aus. Ob sie es danach auch noch schaffen, wissen wir nicht. Da gilt auch in diesem Fall das Resümee aus Kurt Tucholskys Gedicht „Danach“: „Und darum wird beim happy end / im Film jewöhnlich abjeblendt.“
Und nicht nur im Film.
Andreas M. Bräu Kavalier, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2020, 14,40 Euro.
Zwölf kleine Geschichten über die Schwierigkeit, Nähe überhaupt noch auszuhalten
Zwölf kleine Geschichten über die Schwierigkeit, Nähe überhaupt noch auszuhalten
Hinweis der Redaktion in eigener Sache
Seit der „Coronakrise“ haben wir unser Archiv für alle Leser geöffnet. Es gibt also seither auch für Nichtabonnenten unter anderem alle Artikel der LEIPZIGER ZEITUNG aus den letzten Jahren zusätzlich auf L-IZ.de über die tagesaktuellen Berichte hinaus ganz ohne Paywall zu entdecken.
Unterstützen Sie lokalen/regionalen Journalismus und so unsere tägliche Arbeit vor Ort in Leipzig. Mit dem Abschluss eines Freikäufer-Abonnements (zur Abonnentenseite) sichern Sie den täglichen, frei verfügbaren Zugang zu wichtigen Informationen in Leipzig und unsere Arbeit für Sie.
Vielen Dank dafür.
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
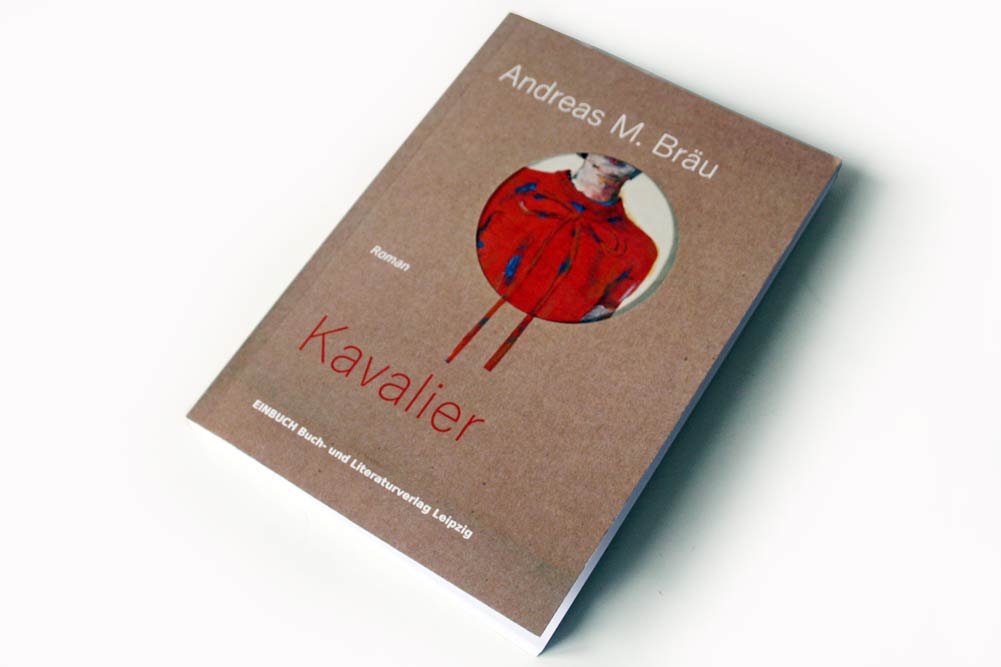








Keine Kommentare bisher