Ich hätte mich ja gern korrigiert und geschrieben: Das Leipziger Großbürgertum war gar nicht so. Es war kunstaffin und weltaufgeschlossen und hatte auch ein Herz für moderne Kunst. Doch dieser Begleitband zur Ausstellung „Impressionismus in Leipzig“, die seit Sonntag, 24. November, im Museum der bildenden Künste zu sehen ist, öffnet zwar einen neuen, viel breiteren Blick auf die Zeit zwischen 1900 und 1914. Aber er zeigt auch, wie damals die Bruchlinien verliefen.
Der ganze Band ist sowieso Ergebnis emsiger Recherchen, die so umfassend bislang noch niemand zur Ankaufpolitik des Museums der bildenden Künste und seines Trägervereins, des Kunstvereins Leipzig, angestellt hat.
Vier profunde Beiträge im Band beschäftigen sich einerseits mit der Leipziger Rezeption der drei großen deutschen Impressionisten Liebermann, Slevogt und Corinth in den Jahren 1900 bis 1914, mit der Ankaufpolitik des Museums selbst zwischen 1896 und 1916, aber auch mit dem Nachweis von Bildern impressionistischer Künstler in den Leipziger Privatsammlungen dieser Zeit und zuletzt auch noch der Etablierung der Leipziger Jahresausstellungen, in deren Umfeld die Interessen der verschiedenen Leipziger Kunst- und Künstlervereinigungen aufeinanderprallten und die Kräfteverteilung zwischen Traditionalisten und Modernen erst so richtig offenlegten.
Zwischengeschaltet sind farbige Bilderstecken, die den vielen (eher kleinen) Impressionismus-Ausstellungen im Bildermuseum am Augustusplatz ein Gesicht geben. Man kann also quasi 100 Jahre zeitversetzt noch einmal durch diese Ausstellungen spazieren, die zum Großteil auch Verkaufsausstellungen waren. Und das Museum unter der Leitung von Theodor Schreiber kaufte tatsächlich einige wenige Bilder an – darunter zwei große Werke von Max Liebermann, der unter den drei großen deutschen Malern, die hier dem Impressionismus zugeordnet werden, in Leipzig auch den größten Anklang fand.
Wie diese Ausstellungen genau organisiert wurden und welche Rolle dabei große Galeristen (wie Cassirer in Berlin) spielten, erzählt Marcus Andrew Hurttig erstmals recht anschaulich und mit Quellen gespickt, berührt auch die Frage, warum das Museum nicht einfach zuschlug und ankaufte, was da wie von allein nach Leipzig gelangt war. Aber es war damals wie heute: Der Ankaufetat war denkbar klein. Für große Neuanschaffungen reichte er eigentlich nicht, sodass Schreiber immer wieder auf die Hilfe des Kunstvereins und seiner zumeist reichen Mitglieder zurückgreifen musste, wenn er wirklich einmal ein bedeutendes Werk für die Sammlung erwerben wollte.
Aber gerade in dieser Zeit stand ein anderer Name ganz oben bei den Anschaffungsprioritäten des Hauses: Max Klinger, von dem gleich zwei große Kunstwerke mit emsiger Sammlung unter den Mitgliedern des Kunstvereins angeschafft wurden: die berühmte Beethoven-Skulptur, die über Jahre andere Anschaffungswünsche des Museumsdirektors blockierte, und „Die blaue Stunde“.
Denn dass Schreiber kein Verständnis für die modernen Kunstströmungen gehabt hätte, kann Birgit Brunk in ihrem Beitrag zur Ankaufspolitik so nicht bestätigen. Aber er war auf das Verständnis der Mitglieder des Kunstvereins angewiesen und ihre Bereitschaft, bei den vielen kleinen Ausstellungen im Bildermuseum zuzuschlagen und wichtige Bilder zu erwerben. Doch genau das passierte wohl eher nicht. Mit dem Leipziger Max Klinger konnten sie sich noch anfreunden. Die Ausstellungen der Impressionisten (später auch der französischen Vorbilder) besichtigten sie wohl mit demselben Interesse wie Sachsens König Albert. Aber sie kauften nichts.
Sodass eigentlich nur ein Weg blieb: Dass die Bilder der Impressionisten über Spenden und Nachlässe ins Museum kamen. Auch damals kamen die meisten Neuerwerbungen nicht über Ankäufe, sondern über solche Spenden ins Haus. Und das ist dann das Thema von Dietulf Sander, der sich intensiver mit den bürgerlichen Privatsammlungen dieser Zeit beschäftigt hat.
Denn wer in Leipzig Rang und Namen hatte als erfolgreicher Unternehmer, der legte sich in der Regel auch eine private und vor allem präsentable Kunstsammlung an. Oder kaufte mit Beginn des 1. Weltkrieges ganze Kataloge leer wie die Bleichert-Brüder. Da hing dann Corinths „Homerisches Gelächter“ tatsächlich im Wohnzimmer der Bleicherts in ihrem Landhaus in Klinga.
Und auch der Kaufhausgründer Moritz Ury, der Musikverleger Henri Hinrichsen und Verlagsbuchhändler Gustav Kirstein sammelten und in diesem Fall auch ganz bewusst moderne Kunst. Sie wollten nicht nur zeigen, dass sie das Geld dazu hatten, sie wollen auch zeigen, dass sie in Sachen Kunst auf der Höhe der Zeit waren. Aber praktisch für alle großen Privatsammlungen dieser Zeit muss Sander feststellen, dass sie Leipzig wieder verloren gegangen sind – entweder in der Weltwirtschaftskrise (wie bei den Bleicherts) oder dann durch die Enteignungspolitik der Nationalsozialisten (wie bei den genannten jüdischen Unternehmen). Das heißt: Sie sammelten sehr wohl impressionistische Kunst, aber das eben abseits des am Ende doch eher konservativ eingestellten Kunstvereins.
Der Riss ging also mitten durch das Leipziger Großbürgertum, machte einerseits ein modern eingestelltes und weltoffenes Bürgertum sichtbar, das sehr wohl auch für moderne Kunst ein Auge hatte, und gleichzeitig ein eher verschlossenes, sehr traditionelles Bürgertum, das auch zum Träger eines Konflikts werden konnte, wenn ihm eine Entwicklung auf dem Kunstmarkt zu weit ging.
Und das war in den Jahren 1910 bis 1913 der Fall, über die Conny Dietrich schreibt, die zwar vom Leipziger „Künstlerkrieg“ schreibt, weil vor allem die Interessen der Leipziger Künstlerverbände aufeinanderprallten, die um ihren Einfluss auf die zunehmend erfolgreicheren Leipziger Jahresausstellungen kämpfen.
Aber in Wirklichkeit waren die Leipziger Streitigkeiten kein Einzelfall, wie Dietrich schreibt: „Vielmehr spiegeln sie den seit Ende des 19. Jahrhunderts überall im Kaiserreich mehr oder weniger heftig ausgetragenen ,Kampf um die Moderne‘ wider, dem künstlerisch-ästhetische Konflikte, aber auch die Verteidigung wirtschaftlicher Interessen, die Durchsetzung von Mitspracherechten, Ängste vor ausländischer, vor allem französischer Konkurrenz und damit Fragen von Liberalität und Abschottung zugrunde lagen.“
Und während die Jahresausstellungen zunehmend auch überregional Aufmerksamkeit und Erfolg fanden, spitzte sich der Konflikt bis in den Leipziger Rat zu, wo sich quasi stellvertretend in der Frage der Kunst der Konflikt zwischen konservativem und fortschrittlichem Bürgertum entlud, oder mit Conny Dietrichs Worten, es „eskalierten die Auseinandersetzungen zwischen den konservativen, lokalpatriotischen und den modern orientierten, weltoffenen Kräften abermals.“
Sodass Leipzig – neben Berlin und Dresden – zwar durchaus ein Ort war, der den impressionistischen Malern eine gute Plattform für die Vermarktung darstellte, einige private Sammler kauften auch ihre Bilder. Aber letztlich sorgte das „lokalpatriotische“ Bürgertum dafür, dass die Spielräume für die modernen Kunstströmungen eher begrenzt blieben und die Konflikte auch in der Nachkriegszeit nie beigelegt wurden. Und eben auch entsprechend wenige Bilder der Impressionisten in den Bestand des Bildermuseums fanden. In der NS-Zeit wurden sogar wieder welche verkauft, weil sie jetzt als „nicht sammelwürdig“ bezeichnet wurden.
Wobei wir im Wesentlichen nur etwas über die drei Großen – Liebermann, Slevogt und Corinth – erfahren, nur da und dort fallen dann die Namen jüngerer und unbekannterer Impressionisten aus ihrer Zeit. Was natürlich das nächste Forschungsfeld eröffnet: Gab es denn damals in Leipzig bzw. Sachsen auch eine impressionistische Malerszene? Und wenn ja: Wo sind ihre Arbeiten und Nachlässe abgeblieben? Oder hatten sie gar keine Chance, weil sich in dieser Zeit ausgerechnet der Expressionismus in Sachsen vehement zu Wort meldete? Eine Strömung, in die sich ja bald auch der Leipziger Max Beckmann einreihen würde, der 1909 noch sehr konventionell und ein bisschen impressionistisch malte.
Marcus Andrew Hurttig; Alfred Weidinger Impressionismus in Leipzig, E.A. Seemann Verlag, Leipzig 2019, 30 Euro.
Wie ging das Leipziger Bildermuseum eigentlich mit den deutschen Impressionisten um?
Wie ging das Leipziger Bildermuseum eigentlich mit den deutschen Impressionisten um?
Hinweis der Redaktion in eigener Sache (Stand 1. Oktober 2019): Eine steigende Zahl von Artikeln auf unserer L-IZ.de ist leider nicht mehr für alle Leser frei verfügbar. Trotz der hohen Relevanz vieler unter dem Label „Freikäufer“ erscheinender Artikel, Interviews und Betrachtungen in unserem „Leserclub“ (also durch eine Paywall geschützt) können wir diese leider nicht allen online zugänglich machen.
Trotz aller Bemühungen seit nun 15 Jahren und seit 2015 verstärkt haben sich im Rahmen der „Freikäufer“-Kampagne der L-IZ.de nicht genügend Abonnenten gefunden, welche lokalen/regionalen Journalismus und somit auch diese aufwendig vor Ort und meist bei Privatpersonen, Angehörigen, Vereinen, Behörden und in Rechtstexten sowie Statistiken recherchierten Geschichten finanziell unterstützen und ein Freikäufer-Abonnement abschließen.
Wir bitten demnach darum, uns weiterhin bei der Erreichung einer nicht-prekären Situation unserer Arbeit zu unterstützen. Und weitere Bekannte und Freunde anzusprechen, es ebenfalls zu tun. Denn eigentlich wollen wir keine „Paywall“, bemühen uns also im Interesse aller, diese zu vermeiden (wieder abzustellen). Auch für diejenigen, die sich einen Beitrag zu unserer Arbeit nicht leisten können und dennoch mehr als Fakenews und Nachrichten-Fastfood über Leipzig und Sachsen im Netz erhalten sollten.
Vielen Dank dafür und in der Hoffnung, dass unser Modell, bei Erreichen von 1.500 Abonnenten oder Abonnentenvereinigungen (ein Zugang/Login ist von mehreren Menschen nutzbar) zu 99 Euro jährlich (8,25 Euro im Monat) allen Lesern frei verfügbare Texte zu präsentieren, aufgehen wird. Von diesem Ziel trennen uns aktuell 450 Abonnenten.
Alle Artikel & Erklärungen zur Aktion „Freikäufer“
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
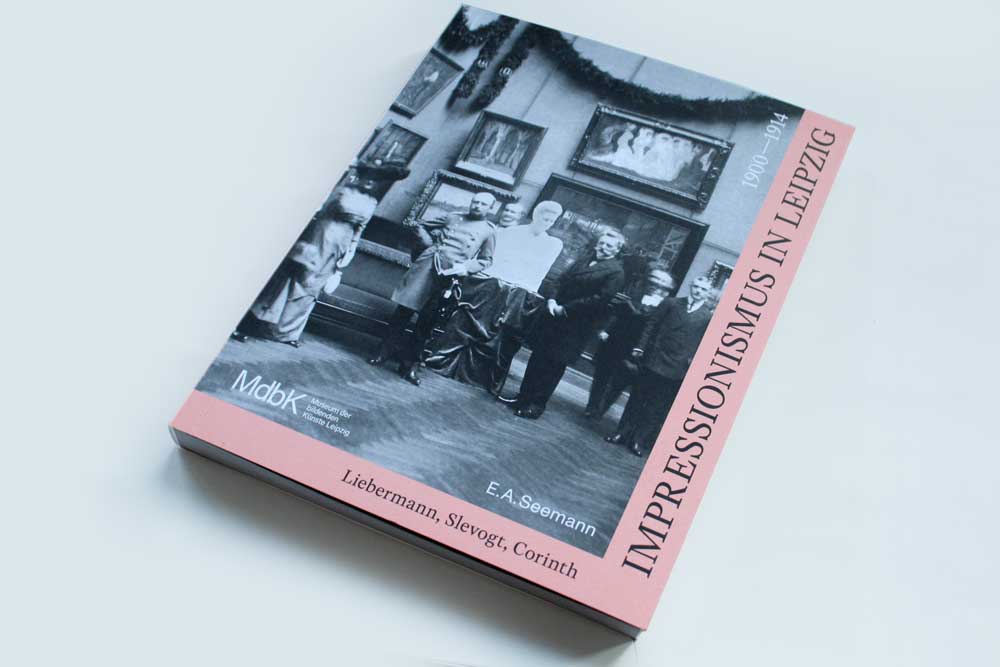










Keine Kommentare bisher