Vielleicht hätten wir es gleich so machen sollen: Alles zu rezensieren, was an Biografien und Autobiografien von Ostdeutschen erscheint. Alles. Und nur von Ostdeutschen: von Bürgerrechtlern, Pfarrern, Malern, Schriftstellern, SED-Politikern, Rebellen, Opportunisten, Angepassten und Schelmen. Eine ganze Bibliothek wäre entstanden, die eins gezeigt hätte: Wie platt, dumm, voreingenommen und bildungsfern fast alles ist, was über den Osten und die Ostdeutschen heute mediale Schablone ist. Rainer Groh hätte natürlich auch ins Regal gehört.
Bekannte ostdeutsche Bürgerrechtler haben sich ja gerade erst ausgerechnet in der konservativen FAZ gegenseitig befehdet über die Frage, wer denn eigentlich (und wie viele) die Friedliche Revolution 1989 bewirkt und ins Rollen gebracht hat. Das Volk? Eine Handvoll Engagierter? Gar die Kirche an der Spitze? Ja, der Zungenschlag kam auch wieder. Hätte man im Osten auf die Kirche warten wollen, wäre gar nichts passiert. Eine Handvoll mutiger Pfarrer haben sich engagiert. Das stimmt.
Aber schon die Fragestellung war falsch. Denn Revolutionen werden eben nicht von kleinen Gruppen ausgelöst, sondern entstehen wie eine Lawine – genau dann, wenn die Zeit für sie reif ist, wenn eine zunehmend größere Gruppe von Menschen nicht mehr bereit ist, die Verhältnisse zu ertragen. Dann greifen die Ideen all jener, die die Änderung geistig vorweggedacht haben. Aber dann werden sie auch meist von den Ereignissen überrollt.
Wer das nicht sieht, begreift nicht, was 1989 nicht nur in der DDR, sondern im ganzen Ostblock passiert ist. Und der versteht auch den Osten nicht wirklich, die Unzufriedenheit, die so viele Menschen erfasst hat.
Rainer Groh ist Professor für Mediengestaltung an der TU Dresden. Studiert hat er in den 1970er Jahren an der TH Ilmenau auf Ingenieur für Gerätetechnik, danach an der Burg Giebichenstein in Halle ein Studium für Industrial Design angehängt, womit er in den illustren Kreis der diplomierten Formgestalter in der DDR aufstieg. Er hätte durchaus eine Karriere in einem der großen Industriekombinate der DDR beginnen können – aber da kam nicht nur der übliche Wohnungsmangel dazwischen, sondern auch der Herbst 1989, den er in Halle erlebte.
Die berühmte Halle-Rede von Hans Dietrich Genscher bietet quasi den Einstieg in das Buch, das Groh vorsichtshalber eine Essay-Sammlung nennt, obwohl es eigentlich eine Sammlung autobiografischer Skizzen ist. Denn als Vielleser weiß er, dass das mit einer Autobiografie so seine Tücken hat. Um sie „spannend“ zu machen, neigen viele Autoren zum Glätten, Zuspitzen, Übertreiben. Man möchte ja gern als der Held des eigenen Lebens dastehen. Aber so ist das Leben nicht. Meist landet man auf Lebenswegen, die man so gar nicht geplant hat, wird zurechtgestaucht, hingeschubst, genötigt oder weicht aus, verweigert sich, scheitert oder findet auf Umwegen zu dem, was einen am am Ende ausmacht.
Deswegen betont Groh die Zwischenräume und zitiert Adorno, der mit seinem Satz „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ ab 1989 geradezu inflationär zitiert wurde. Und fast immer falsch. Wie das meist so ist mit verkürzten Zitaten, die dann gern als Keule benutzt werden. Obwohl es bei Adorno zuallererst darum geht, das Falsche überhaupt erst einmal zu erkennen. Und damit den Widerspruch zwischen Umständen, die einem ein falsches Leben aufzwingen (und damit meint er nicht den real existierenden Sozialismus, sondern den real existierenden Kapitalismus), und dem Wunsch, trotzdem ein richtiges Leben zu leben.
Der Widerspruch wird bei Adorno nicht aufgehoben. Er macht unser Leben aus. Mit allen Konsequenzen. Weshalb es in der DDR natürlich eine Menge Leute gab, die sich lieber krümmten und verbogen, um im Falschen Karriere zu machen. Und es gab viele, die gegen diese Nötigung aufbegehrten und dafür in der Regel hart bestraft wurden und zum Teil bis heute leiden.
Und es gab die große Mehrheit, die es in vielen Facetten dazwischen gab. Halb angepasst, halb willig, halb widerspenstig oder einfach bemüht, unter diesen Umständen ein halbwegs anständiger Mensch zu bleiben und sich nicht zu verbiegen. Also ungefähr dieselbe Mischung wie im Westen Deutschlands.
Die meisten Menschen leben in solchen Zwischenräumen. Und wahrscheinlich gehen sie mit falschen Zuständen ganz ähnlich um wie Rainer Groh, dessen Familiengeschichte nach Leipzig führt, in die Welt künstlerisch begabter Eltern, die ihn augenscheinlich sensibel erzogen und sensibel machten für die Zwiesprache des Landes, in dem er aufwuchs: Was zuhause gesagt wurde, gehörte nicht in die Schule. Es gibt ein öffentliches Sprechen und ein privates. Und über die wirklich wichtigen Dinge spricht man nur in geschützten Räumen, in denen man zumindest davon ausgehen kann, dass keiner aus der Runde ein Zuträger ist. Auch Groh kannte das Misstrauen und staunte doch sehr, dass tatsächlich niemand über ihn eine Akte anlegte.
Er erzählt von seiner Immunisierung, die er beim Versuch erlebte, vorzeitliche Gräberfelder bei Grevesmühlen zu besichtigen. Er liebe alte Hügelgräber, erzählt er, alte Burgen sowieso. Nur lag das Gräberfeld nahe der Grenze. Die berüchtigte Transportpolizei (TraPo) fischte ihn aus dem Zug, verhörte ihn stundenlang und erniedrigte ihn sogar, als wäre der junge Wanderer ein krimineller Grenzbrecher. Das habe ihn wohl von allen Illusionen über den Staat geheilt, in dem er lebte. Es kommen später noch mehrere solcher Szenen – bis hin zum Wehrdienst bei der Asche.
Ein Wort, das heute kaum noch jemand benutzt, weil man selbst mit dem Dienst bei der Bundeswehr nicht diese Tristesse, Hohlheit und Erniedrigung verbindet, wie sie Millionen junger Ostdeutscher bei der NVA erlebten. Und Grohs Schilderungen werden schon genau so stimmen: Wer dort landete, kam mit anderen jungen Menschen zusammen, die genauso wenig vom SED-Staat und seinen Bonzen und Generälen hielten und aus ihrer Verachtung keinen Hehl machten, erst recht, wenn sie aus der viel gefeierten „Arbeiterklasse“ stammten.
Dabei erzählt Groh mit Witz und Wissen. Er hat nicht nur das damals übliche Jugendweihebuch „Weltall Erde Mensch“ gelesen. Sein Text ist gespickt mit offenen und versteckten Zitaten aus Büchern, die damals auch zum Standardrepertoire im Schulunterricht der DDR gehörten. Und weil er wohl zu Recht damit rechnet, dass jüngere Leser oder solche aus den ältlichen Bundesländern weder die spezifischen DDR-Begriffe noch die Zitate und die zugehörigen Bücher kennen, hat Groh jedem Kapitel ein eigenes Stichwortverzeichnis angehängt, in dem er die Worte erklärt.
Dazu kommen dann noch einige „Zwischenspiele“, in denen er kleine Listen aufmacht mit Dingen, die damals fehlten, die ihm heute fehlen, oder auf die er auch gern verzichten konnte. Ihm ist auch sehr bewusst, dass er als Kind noch Dinge erlebt hat, die man erst recht erklären muss, weil sie in unserer Wirklichkeit nicht mehr vorkommen – Gaslaternenanzünder (die er in Halle noch bis in die 1970er Jahre erlebte), Milchfrauen (die einem die Milch aus großen Kübeln in die mitgebrachte Milchkanne abfüllten), Dampflokomotiven im Reiseverkehr der Deutschen Reichsbahn, kleine Bahnhofsgaststätten an Nebenstrecken, wo man als Wanderer einkehren und sich stärken konnte.
Gerade weil er seine Erinnerungen in kleine Essays packt, entsteht ein Mosaik aus Bildern, Erlebnissen, Assoziationen und Zitaten. Denn auch wenn man das Land nur ostwärts ab und zu verlassen konnte (den Westen hatte er vor 1961 nur als ganz kleiner Junge erlebt), musste man nicht zum weltlosen Kleinbürger werden. Einer wie Groh hat seine Klassiker gelesen und mitgenommen auf Wanderschaft – Goethe und Eichendorff zum Beispiel. Welt kam durch Bücher ins Land (Solschenizyn und Loest heimlich lesen), durchs Fernsehen (selbst bei der Asche) und Rundfunk, sodass auch Groh, wie so viele Jugendliche im Osten, mit den berühmten Bands des westlichen Rock und Pop und Blues aufwuchs. So darin eingetaucht, dass ihm der Ostrock ziemlich egal war, bevor er in den 1970er Jahren dann über Renft und Veronika Fischer stolperte, die ihm aus der Seele sangen.
So etwas prägt. Und macht trotzdem nicht alle gleich. Wer im Osten lebte, lebte immer in mindestens zwei Welten, wohl eher in drei oder vier. Und wo man aufpassen musste, das wusste oder ahnte man zumindest. Was nicht ausschloss, dass an den Hochschulen des Landes auf Spitzenniveau ausgebildet wurde. Groh kennt es für seine Studienrichtungen. Und da er heute auf demselben Gebiet lehrt, kennt er auch die westlichen Lehrbücher und Materialien. Er kann vergleichen. Und der Vergleich fällt nicht immer gut für den Westen aus. Auch wenn er sich mit klaren Wertungen für all das, was ab 1990 geschah, zurückhält – oder besser: Er wägt ab, geht auf das Pro und Contra der großen Bereinigung in den ostdeutschen Hochschulen ab 1990 ein, lässt auch die Spitzen gegen die Leute nicht weg, die ihn fünf Mal auf Spitzeltätigkeit hin prüften.
War dieser große Elitentausch wirklich in der Form nötig? Die Antwort ist so eindeutig nicht. Welche Folgen hat das bis heute (da gibt es dann einen hübschen kleinen Essay über Seilschaften und Netzwerke)? Was macht das übrigens mit den Ostdeutschen? Kann es sein, dass dieses Fehlen von Ostdeutschen in wichtigen Entscheidungspositionen eben auch dazu führt, dass selbst familiäre Netzwerke nicht (mehr) funktionieren? Eine ganz spannende Frage, die Groh einbettet in den Versuch, die seltsamen politischen Entwicklungen im Osten einzuordnen. Denn dass es ihnen schlecht geht, können die meisten Ostdeutschen nicht sagen, den meisten geht es deutlich besser als vor 1990.
Wird da diese verrauchte, graue und zukunftslose DDR tatsächlich für viele zu einer Art Sehnsuchtsraum, weil sie damit lauter heimelige Erinnerungen verbinden? Dass es solche Erinnerungen gibt, ist ja nicht wegzureden. Auch Groh kann viele Geschichten aus seiner Jugend erzählen, in denen er ganz emotional die Schönheit und den Reichtum der Welt erlebte, so klein und abgeschnitten diese Welt auch war. Das lebt er bis heute aus, wenn er seine Farben und seine (in der Sowjetunion erworbene) Staffelei schnappt und zum Malen in die freie Natur radelt, wo er sich stundenlang in die vorgefundene Landschaft vertieft.
Was ihn übrigens am Ende auch zu einer sehr deutlichen Kritik an der Schnelllebigkeit und Oberflächlichkeit heutiger Medien bringt, die einem suggerieren, dass man jede Situation und jeden Moment mit einem Knopfdruck festhalten kann. Aber eigentlich erlebt man nichts mehr, weil man sich gar nicht mehr intensiv mit den Dingen beschäftigt.
In der DDR aber musste man sich zwangsläufig mit vielen Dingen sehr intensiv beschäftigen – etwa auf stundenlangen Zugfahrten, die zuweilen mitten in der Landschaft endeten, ohne dass zu erfahren war, was den ganzen Laden aufhielt. Man pilgerte auch noch in Ausstellungen, um Kunstwerke wirklich einmal selbst zu sehen. Und Halle muss bis 1989 eine ganze Landschaft von Kneipen gewesen sein, in die man auch mal in Hausschlappen und Schlumperhose eilen konnte, bevor um Mitternacht Zapfschluss war. Gerade weil man nicht alles kaufen konnte, musste man sich oft intensiv mit Dingen beschäftigen – etwa baufälligen Wohnungen, die man selbst irgendwie ein bisschen reparieren und in Schuss halten musste.
Deshalb wirken Grohs Essays eben eher nicht wie (meist übliche) philosophische Abschweife, sondern eben wie farbige Alben voller Erinnerungen, die Groh in vielen Fällen mit vielen anderen teilt. Die DDR-Wirklichkeit war ja durchdrungen von Symbolen, Alltagswaren und Alltagserfahrungen, die alle gemacht haben. Von der billigen Rückfahrkarte (aus Pappe) bei der Bahn über die Bockwurst an Bahnhofskiosken bis hin zu den legendären Ritter-Runkel-Geschichten im „Mosaik“, die nicht nur den jungen Rainer Groh mit der fernen, unerreichbaren Welt bekannt machten.
Einerseits. Andererseits aber auch mit jenem feinen, stets unterschwellig mitlaufenden Humor, mit dem diese Bildergeschichten auch das Dasein im wohlgeordneten realen Sozialismus aufs Korn nahmen. Aber um die Doppelbödigkeit zu erkennen, muss man wohl in diesem fein verriegelten Land aufgewachsen sein und gelernt haben, auch „zwischen den Zeilen“ zu denken.
Am Ende, als es darum geht, welch ein Glücksumstand es war, dass Groh auf eine Professur nach Dresden berufen wurde, spricht der Autor etwas an, was er damals schon beobachtete – jenen feinen Unterschied zwischen West- und Ostdeutschen, der sich augenscheinlich bis heute nicht ausgewachsen hat. Es ist das zur Schau getragene und ungebrochene Selbstvertrauen, mit denen Westdeutsche ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen, auf die besten Posten berufen zu werden, während Ostdeutsche oft sogar tiefstapeln und sich unter Wert anpreisen oder gar nicht erst auf bestimmte Stellen bewerben. Eine ja recht junge Diskussion. Ostdeutschen geht es da augenscheinlich wie Frauen.
Und noch etwas sah Groh schon früh. Im Zusammenhang mit den Bildbänden ostdeutscher Fotografen haben wir darüber berichtet: Ostdeutsche Arbeiter waren nicht nur stolz, sie strahlten es auch aus. Sie hatten sichere Arbeitsplätze und wussten, dass ohne sie der Laden nicht läuft. Während die ersten Arbeitenden, die Groh im Westen sah, nichts davon ausstrahlten. Dafür begegnete er stolzgeschwellten Anzugträgern. Im Westen traten ganz andere Leute stolz auf als im Osten. Und so wird das Buch dann doch zu einem kleinen Versuch herauszufinden, warum der Unmut im Osten so groß ist.
Einer Wertung enthält sich Groh. Aber seine farbenreichen Erinnerungsstücke laden regelrecht dazu ein, über das wirkliche Leben im Osten doch etwas länger nachzudenken als bis „Bautzen II“ oder „Parteihochschule“. Denn kaum ein Ostdeutscher wird sein Leben als ein falsches im falschen bezeichnen. Die meisten teilen eher Erfahrungen des Zwischenraums, bemüht, sich von den staatlichen Zumutungen möglichst fernzuhalten, aber auch nicht so wagemutig, das System gar herauszufordern. Und trotzdem bemüht, aus dem Vorhandenen das Bestmögliche zu machen. Und dabei möglichst anständig zu bleiben. Aber erzählen kann man das nur, wenn man sich mit Geduld auf die inneren Erinnerungslandschaften einlässt. So wie Groh, der durchaus auch die Menschen in seinem Leben zu würdigen weiß, die ihn gestärkt und bereichert haben, darunter auch kluge Lehrer und Dozenten.
So wird sein Buch zu einer wichtigen Facette in der ostdeutschen Erinnerungskultur, ein Puzzle-Stein unter vielen, der freilich auch zeigt, dass die üblichen Stereotype über die DDR und das Leben darin einfach zu billig sind, um das Land und seine Bewohner zu erklären.
Rainer Groh Weltall Erde Ich, Thelem Universitätsverlag, Dresden 2019, 16,80 Euro.
Hinweis der Redaktion in eigener Sache: Eine steigende Zahl von Artikeln auf unserer L-IZ.de ist leider nicht mehr für alle Leser frei verfügbar. Trotz der hohen Relevanz vieler unter dem Label „Freikäufer“ erscheinender Artikel, Interviews und Betrachtungen in unserem „Leserclub“ (also durch eine Paywall geschützt) können wir diese leider nicht allen online zugänglich machen.
Trotz aller Bemühungen seit nun 15 Jahren und seit 2015 verstärkt haben sich im Rahmen der „Freikäufer“-Kampagne der L-IZ.de nicht genügend Abonnenten gefunden, welche lokalen/regionalen Journalismus und somit auch diese aufwendig vor Ort und meist bei Privatpersonen, Angehörigen, Vereinen, Behörden und in Rechtstexten sowie Statistiken recherchierten Geschichten finanziell unterstützen.
Wir bitten demnach darum, uns weiterhin bei der Erreichung einer nicht-prekären Situation unserer Arbeit zu unterstützen. Und weitere Bekannte und Freunde anzusprechen, es ebenfalls zu tun. Denn eigentlich wollen wir keine „Paywall“, bemühen uns also im Interesse aller, diese zu vermeiden (wieder abzustellen). Auch für diejenigen, die sich einen Beitrag zu unserer Arbeit nicht leisten können und dennoch mehr als Fakenews und Nachrichten-Fastfood über Leipzig und Sachsen im Netz erhalten sollten.
Vielen Dank dafür und in der Hoffnung, dass unser Modell, bei Erreichen von 1.500 Abonnenten oder Abonnentenvereinigungen (ein Zugang/Login ist von mehreren Menschen nutzbar) zu 99 Euro jährlich (8,25 Euro im Monat) allen Lesern frei verfügbare Texte zu präsentieren, aufgehen wird. Von diesem Ziel trennen uns aktuell 500 Abonnenten.
Alle Artikel & Erklärungen zur Aktion „Freikäufer“
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
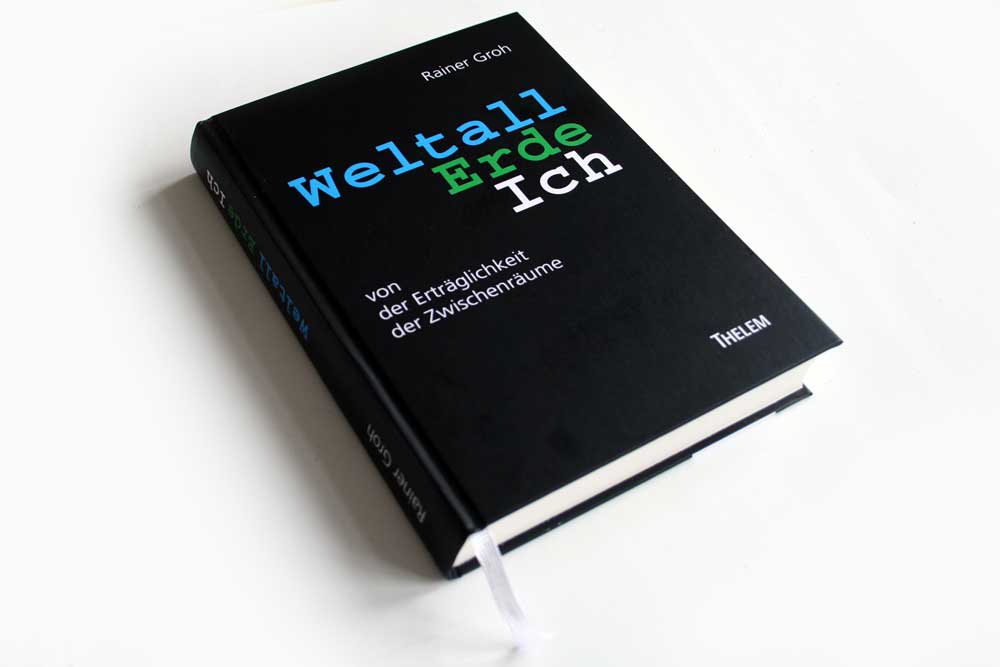


















Keine Kommentare bisher