Natürlich geht es um Heimat. Und zwar nicht in der jämmerlichen romantischen Variante, sondern in der harten. Die Demokraten in den USA haben es im Präsidentschaftswahlkampf 2016 erleben können, was für eine Wucht Heimat entfalten kann, wenn Millionen Menschen das Gefühl haben, dass ihre Region „die da oben“ überhaupt nicht mehr interessiert. Pete Buttegieg kommt mitten aus so einer Region. Er ist dort Bürgermeister.
Seine Stadt heißt South Bend, liegt mitten im Bundesstaat Indiana. Und der liegt im Mittleren Westen, jenem Gebiet, in dem Donald Trump 2016 besonders punkten konnte, weil er den Bewohnern dieser Region versprach, er würde ihre Arbeitsplätze zurückholen. Hier lag mal der einstige Industriegürtel der USA. Hier war – und ist teilweise noch – die Autoindustrie zu Hause. Doch als das große Sterben der Industrie hier begann, wurde aus einst reichen Bundesstaaten der viel beschworene „Rust Belt“, der Rostgürtel. Die Demokraten verloren ihre einstige Arbeiter- und Gewerkschaftsbasis. Es erging ihnen genauso wie der SPD in Deutschland. Und aus den Staaten des Mittleren Westens wurden sogenannte „Fly Over States“: Aus der Perspektive der Ostküste und des dortigen Establishment flog man über diese Bundesstaaten nur noch drüber, um zum Beispiel in aufstrebende Bundestaaten wie Kalifornien zu kommen.
Aus einstigen sicheren Demokraten-Staaten wurde Trump-Land. Oder im Fall von Indiana auch: Mike-Pence-Land. Denn mitten in die Bürgermeisterzeit von Pete Buttigieg fiel auch die Wahl von Mike Pence zum neuen Gouverneur von Indiana, fiel auch die Unterzeichnung der Religious Freedom Bill, die eben das Gegenteil von der sowieso durch die amerikanische Verfassung garantierten Religionsfreiheit war – sie legalisierte die Diskriminierung von Homosexuellen mit Verweis auf Glaubensfreiheit. Etwas, was man so auch aus Indiana noch nicht gekannt hatte, solche Art religiöser Fanatismus war bis dahin eher in den Südstaaten zu finden. 2016 war Pence im Grunde schon auf der Verliererstrecke. Eine weitere Gouverneurswahl hätte er in Indiana nicht gewonnen. Aber er passte mit dieser Einstellung genau in Trumps Team.
***
2020 sind jetzt die nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA und die Demokraten suchen noch einen aussichtsreichen Kandidaten, der Trump schlagen könnte. Über 20 hatten sich für den Vorausscheid gemeldet – unter ihnen neben Schwergewichten wie Joe Biden und Bernie Sanders auch der 38-jährige Pete Buttigieg. Schon einmal hat er versucht, das Establishment der Demokraten herauszufordern, als er für den Parteivorsitz kandidierte. Wie man Wahlkämpfe bestreitet, das weiß er. Gewonnen hat er seinen ersten 2011, den ersten bestritten hat er schon 2010, als er für das Amt des Indiana State Treasurer antrat. Und dafür hatte er sogar seinen deutlich besser bezahlten Job bei McKinsey aufgegeben.
Ein Schritt ins Risiko. Der aber so abwegig nicht war, denn politisch engagiert hatte er sich schon vorher. Nachdem er Geschichte und Literatur in Harvard und dann in Oxford auch noch Wirtschaft studiert hatte, hatte er das dumme Gefühl, über Wirtschaft eigentlich gar nichts zu wissen. Deswegen nahm er das Angebot von McKinsey dankend an und war regelrecht begeistert, als er mit modernen Analysemethoden lernte, komplexe Unternehmen und ihre Warenumsätze optimieren zu können. So lernt man auch, wie Unternehmen ticken, wie man Dinge besser macht, aber auch, wie Netzwerke und Gemeinschaften funktionieren. Nur war er nicht der Typ, der das für immer und ewig machen wollte.
Und als sich 2011 die Chance ergab, für den Bürgermeisterposten in South Bend, seiner Heimatstadt, zu kandidieren, nutzte er sein Wissen, um in einem Moment Bürgermeister einer Stadt zu werden, als die überregionalen Medien South Bend mit unter die sterbenden Städte im Rust Belt einreihten.
***
Deswegen ist seine Geschichte auch für Ostdeutschland interessant. Es ist dasselbe Grundproblem, vor dem hier die meisten Städte stehen. Und Buttigieg, der den Zustand seiner Stadt schon vor dem Einstieg in den Wahlkampf analysiert hatte, stieg in diesen Wahlkampf ein mit dem Versprechen, South Bend aus der Abwärtsspirale zu holen.
Und wer meint, darüber ließe sich nicht farbenreich und anschaulich schreiben, der wird in diesem Buch das Gegenteil finden. Denn Buttigieg beschreibt die zentralen Projekte seiner Bürgermeisterzeit sehr anschaulich. Auch seine Probleme, seinen Umgang mit den Bürgern, mit politischen Konkurrenten und Mitarbeitern. Als er Bürgermeister wurde, lebte South Bend noch von seinem alten Mythos. Bis zum Ende des Konzerns 1967 war South Bend Studebaker-Stadt. Der Autokonzern gab Tausenden einen Job, sicherte Einkommen und die Blüte der Stadt. Als die Fabrik ihre Tore schloss, begann der schleichende Niedergang, begannen Häuser leerzustehen, repräsentative Gebäude zu verfallen. Die steinernen Fabrikgebäude verwandelten sich in entkernte Denkmale der Vergangenheit. Drogen und Kriminalität begannen ihren Vormarsch.
Und trotzdem sah Buttigieg Chancen, der Stadt einen neuen Glanz zu geben. Und zwar durch ganz simple städebauliche Eingriffe – von einer Modernisierung des Kanalnetzes über den Rückbau der vierspurigen Schnellstraßen durchs Stadtzentrum bis zu seinem 1.000-Häuser-Programm, das er zum Schwerpunkt seiner ersten Amtszeit gemacht hatte. Gerade dieses Signal war wichtig: 1.000 leerstehende Häuser wollte die Verwaltung anfassen (was nicht immer Abriss bedeutete), um dieses Gefühl der Ödnis aus dem Stadtbild verschwinden zu lassen.
Und es ist Buttigieg augenscheinlich gelungen, binnen vier Jahren die Stimmung in der Stadt zu drehen, ihr wieder eine moderne Aura zu verpassen und Investoren zu animieren, in die leerstehenden Gebäude und Areale zu investieren. Es wird trotzdem kein trockenes städtebauliches Buch, auch wenn man sich die ganze Zeit beim Lesen fragt: Wo nahm der Bursche überhaupt die Kraft und die Zeit her, das alles zu bewerkstelligen?
Denn einige der Wahlkämpfe hat er noch neben seiner Arbeit als Bürgermeister abgewickelt, zum siebenmonatigen Einsatz als Offizier in Afghanistan ließ er sich auch noch schicken. Auch das ein eigenes Kapitel, das manches thematisiert, was in Deutschland auch gern vergessen wird – angefangen von der Fähigkeit von Politikern, die Folgen der von ihnen ausgelösten Kriege zu erfassen, bis hin zum Umgang mit den heimkehrenden Soldaten, die in ihrem Kriegseinsatz nicht nur traumatische Situationen erleben, sondern nach ihrer Rückkehr oft auch noch in ein tiefes Loch fallen, weil sie weder Dankbarkeit erfahren, noch dieses kleine, aber wichtige Gefühl, in der Bürgerschaft wieder willkommen zu sein.
Es ist ein kleiner emotionaler Moment, in dem sich aber eine ganze Gesellschaft spiegelt. Eine Gesellschaft, die Leute wie Trump immer weiter spalten und mit Zwietracht erfüllen wollen. Trump und Pence werden im hinteren Teil des Buches auch noch Thema. Umschiffen kann es Buttigieg nicht, auch wenn ihm seine Erfahrung als lokaler Politiker immer wieder sagt, dass man Sinnvolles nur gemeinsam mit anderen schafft – auch mit dem politischen Gegner. Dann steckt man seine unterschiedlichen Ansichten einfach mal weg und sucht die Gemeinsamkeiten. Denn gerade als Bürgermeister hat man die Verantwortung für alle. Und man erreicht mehr, wenn man die Bürger von einem wichtigen Projekt überzeugt, auch wenn die üblichen Bedenkenträger gleich bei der ersten Verlautbarung losschreien. Es gibt sie auch in South Bend. Und sie ähneln sich alle überall auf Erden, wie es scheint. Gerade sie wollen abgeholt werden.
***
Man merkt es an mehreren Stellen im Buch, wie sehr so manches in South Bend dem ähnelt, was auch in Ostdeutschland passiert ist. Nur dass es hier eher selten Typen wie Pete Buttigieg gab, die wussten, dass man die Zukunft erst einmal in die Köpfe der Leute pflanzen muss. Wer keine Träume und Visionen hat, der wird so wie die eigentlich zutiefst bedauernswerten „besorgten Bürger“. In ihrer Sorge steckt ja schon alles, die ganze Sehnsucht, dass einer ihnen sagt, was jetzt werden soll.
Oder mal Buttigieg selbst zitiert, der auch dieses Buch noch parallel zu seiner Arbeit als Bürgermeister geschrieben hat: „Der Fortschritt konnte erst einsetzen, nachdem der Verlust verarbeitet war. Nichts ist menschlicher, als sich gegen einen Verlust zu sträuben, daher kommen zynische Politiker ziemlich weit mit dem Versprechen, ein Verlust könne rückgängig gemacht werden, anstatt zu erklären, dass man ihn mühevoll überwinden muss.“
An anderer Stelle erzählt er recht ausführlich, wie er die Bürger von South Bend dahin brachte, sich endlich vom Traum der alten Studebaker-Stadt zu lösen und von der Vorstellung, man könne den alten Glanz und das alte Gewimmel auf der Main Street mit irgendwelchen Mitteln wieder zum Leben erwecken. Städte leben von den Visionen ihre Bewohner genauso wie vom Bild, das sie nach außen abgeben. Deswegen war der Diskriminierungs-Erlass von Mike Pence so verheerend. Er kam genau zu dem Zeitpunkt, als die Städte im „Rust Belt“ gerade darangingen, sich ein neues, weltoffeneres Außenbild zuzulegen. Und er führte über kurz oder lang auch dazu, das Buttigieg sich entschloss, sich in einem Zeitungsartikel selbst zu outen, hoffend, das würde ihm nicht sämtliche Chancen bei der Wiederwahl als Bürgermeister zerstören. Das Gegenteil war der Fall: Augenscheinlich wählten die Bürger von South Bend den Mann wieder, der die Stimmung in der Stadt in den vier Jahren gründlich umgekrempelt hatte, aus einer depressiven eine zuversichtliche Stadt gemacht hatte, die wieder wuchs und Investoren anzog. Die auch nicht nur wegen der neuen Atmosphäre kamen, sondern auch wegen des – selbst aus Leipziger Sicht – sehr radikalen Umbaus der Innenstadt.
Keine der Prophezeiungen, mit dem rasenden Autoverkehr würden auch die Geschäftsleute wegbleiben, hat sich erfüllt. Stattdessen sahen reiche Investoren die Entwicklung gerade als positives Zeichen, dass man in South Band wieder investieren konnte.
***
Was Buttigieg so lernte, war auch etwas, was er jetzt in den Präsidentschaftswahlkampf einbringen will: Dass es bei erfolgreicher Politik nicht um Macht geht oder gar die Behauptung, man sei mit seinen Positionen unanfechtbar auf der guten Seite. Das interessiert die Wähler in abgehängten Regionen nicht. Politik, so betont Buttigieg immer wieder, wird für jeden Menschen in seinem privaten Umfeld greifbar. Dort muss erlebbar werden, ob sich ein gewählter Politiker wirklich anstrengt, persönlich ansprechbar ist und auch erklärt, was er tut, um die Dinge zu ändern. Und genau die Ebene beackern, so stellt er fest, die Republikaner seit Jahren systematisch – und sie formen damit Politikwahrnehmung. Und dort muss auch ein Bürgermeister ackern. Gerade dort. Und diese Ebene fehlte den Demokraten, diese Sorge gerade um die Leute aus den vom Abstieg bedrohten Regionen. Trump hat daraus Wahlstimmen gemacht. Er hat den Arbeitern aus dem Rust Belt die Rückkehr ihrer alten Industrien versprochen. Was so nie passieren wird.
Es gibt keine Rückkehr in eine als märchenhaft verklärte Vergangenheit, schreibt Buttigieg mehrmals. Aber man kann diesen Regionen eine neue Zukunft geben. Was Arbeit kostet. Aber auch – da ist Buttigieg ganz Analyst – eine klare Analyse der Probleme. Die man dann auch anpacken muss, systematisch und auch mit der Gefahr, dass man seine gesteckten Ziele nicht ganz erreicht, dass man sich als verletzlich zeigt. Transparenz durch Information. So fremd sind uns die USA gar nicht. Auch wenn wohl der Name Buttigieg erst einmal den wenigsten etwas sagt. Manchmal wird er tatsächlich sogar schon als echter Herausforderer für Donald Trump gehandelt, weil er Visionen anbietet für all die Staaten, die so schnell aus dem Fokus der großen Politik verschwinden, wenn dort keine großen Konzerne mehr sitzen.
Auch das kennt man ja aus Deutschland. Mitsamt diesem wilden Kampf um Ansiedlungen. Statt sich zusammenzutun und alle Unternehmen in der Region gemeinsam zu sichern und zu stärken, haben auch die Städte um South Bend lange versucht, sich gegenseitig die Unternehmen in einem Unterbietungswettbewerb abzujagen. Auch das kennt man aus Deutschland.
Am Ende bleibt natürlich die Frage: Haben deutsche Parteien überhaupt solche Typen, die von der Pike auf gelernt haben, wie man einer Stadt wieder Mut und Zuversicht beibringt? Die Politik nicht als Streiten, Balzen und Niedermachen begreifen, sondern als einen Wettstreit um kluge Lösungen für alle?
Da wird man dann inwendig ganz still. Das Thema, das Buttigieg hier aufmacht und in vielen Beispielen sehr lebendig erzählt, ist eins, das uns genauso betrifft. Weil wir mit denselben Problemen zu kämpfen haben und dieselben Großmäuler aus dieser Stimmung des Abgehängtseins ihren Profit schlagen. Vielleicht wird er nicht der nächste Präsidentschaftskandidat der Demokraten. Aber man lernt mit diesem Bürgermeister auch eine Stadt kennen, die sich auf den ersten Blick ganz gewaltig von einer Stadt wie Leipzig unterscheidet, im Kern aber doch sehr vertraut wirkt.
Und natürlich lernt man den analytischen Kopf des Autors kennen, der nicht mal sein eigenes Familienleben ausspart bei der gründlichen Untersuchung, wie es in Ordnung zu bringen wäre und welche Wege zum Ziel führen. Und trotzdem ist es kein Buch ohne Emotionen. Das deutet selbst der Titel an. Denn kurz wundert sich auch Buttigieg darüber, dass er – nachdem er als McKinsey-Mann praktisch die halbe Welt bereist hat – dann doch als Bürgermeister in seiner Heimatstadt landete. Auch seine Studien waren nicht umsonst. Irgendwie führt einen das Leben dann doch mit gewisser Konsequenz an den Punkt, an dem die eigenen Talente und Fähigkeiten den Ort finden, an dem sie sich richtig entfalten können und an dem man das in Taten umsetzen kann, was in einem selbst schon immer angelegt war. So gesehen also der „kürzeste Weg nach Hause“.
Pete Buttigieg Shortest Way Home, Ullstein, Berlin 2019, 24 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
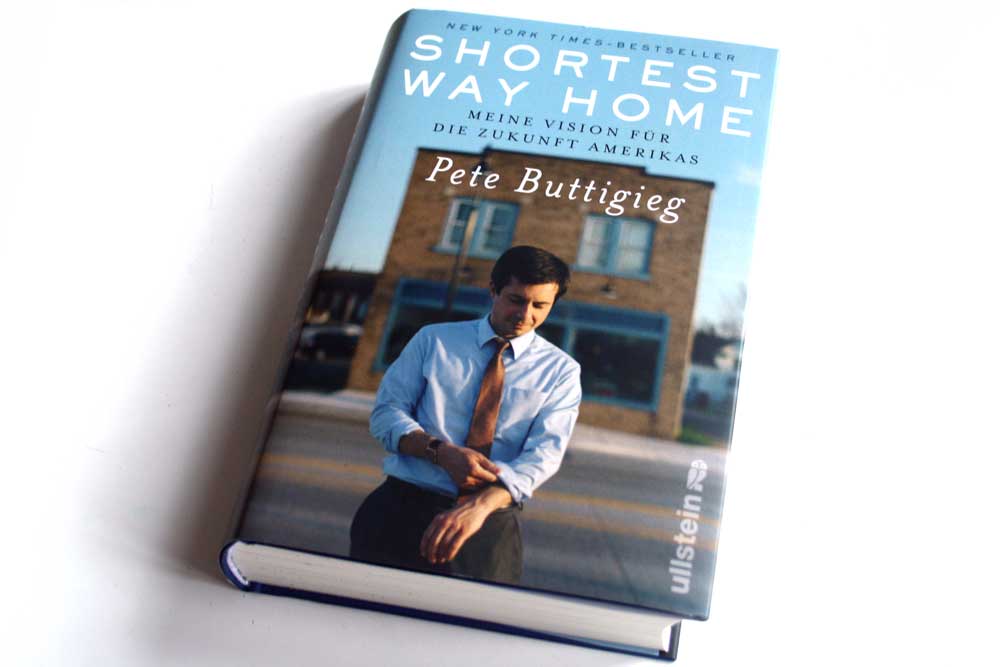









Keine Kommentare bisher