Was passiert, wenn man zwei streitbare Leute zu einem Streitgespräch über Demokratie, Migration, Volk und Nation einlädt? Immerhin alles fette Brocken, an denen man sich richtig Beulen holen kann. In diesem Fall hat es der F.A.Z.-Redakteur Reinhard Bingener versucht und Michael Bröning und Michael Wolffsohn zum Streitgespräch gebeten.
„Brillante politische Denker“ nennt sie der Buchumschlag. Schön wär’s. Aber zur Brillanz gehört etwas, was heute in Deutschland selten geworden ist. Unter anderem die Fähigkeit, Neues zu denken und zwar konsequent und faktenbasiert, klug und mutig. Und offen für die Denkansätze der anderen, der Linken, Rechten, Modernen und Konservativen. Egal, von welcher Position aus.
Michael Bröning, Leiter des Referats „Internationale Politikanalyse“ bei der Friedrich-Ebert-Stiftung, ist 2018 dadurch aufgefallen, dass er sein Buch mit dem Titel „Lob der Nation“ veröffentlichte. Immerhin ein echter Kontrapunkt zu vielen linken Positionen, die mit Nation und Nationalismus ihre Schwierigkeiten haben. Natürlich wurde er dazu angeregt, weil auch dieser Begriff seit 2015, seit dem Erfolgsmarsch der Neuen Rechten, wieder in der Diskussion ist – neben anderen Begriffen wie Heimat und Volk, die in diesem Buch auch angeschnitten werden.
Es hätte besser „Nation, Heimat, Volk“ heißen müssen. Aber irgendwie stand der Titel des Buches schon vor dem Treffen der drei fest. Leider, denn Stadt und Land werden gar nicht diskutiert, nur stellenweise berührt, wenn es um das Thema Demographie geht, aber nur sachte. Denn Michael Wolffsohn begreift unter Demographie fast ausschließlich Migration, Zuwanderung, Wachsen des Ausländeranteils.
Vielleicht diskutiert er anderswo anders, hier jedenfalls fokussiert er sich darauf, auch weil Bingener ganze Fragenkomplexe zu allein diesem Thema aufgelegt hat. Drei Kapitel drehen sich fast ausschließlich darum: „Epochenfrage Migration“, „Der Staat und seine Grenzen“ und „Völker, Nationen, Minderheiten“.
Oh, ich bin immer noch bei der Brillanz. Das alles sind Themen, die man brillant denken und diskutieren kann. Könnte. Können dürfte, wenn man wöllte oder wollen dürfte. Wir sind mittendrin im deutschen Dilemma. Für das gerade der langjährige Geschichtsdozent an der Universität der Bundeswehr in München, Michael Wolffsohn steht. Im Buch stellt er sich als Liberalen dar. Aber das stimmt nicht. In den Diskussionen der Republik vertritt er eindeutig konservative Positionen. Was erst einmal nicht schlimm ist, auch das lässt Raum für sehr kluge Diskussionen zum Beispiel darüber, wie man einen Sozialstaat sichert, wie sich eine Nation definiert und ob Menschen nun eine Nation als Gemeinschaftsraum brauchen oder doch eher in föderalen Bundesstaaten gut aufgehoben sind, wofür Wolffsohn plädiert.
Worin natürlich auch die Frage steckt, wie die EU künftig aussehen wird und wie sie besser werden kann. Vielleicht durch eine föderalere Struktur, die auch den Mitgliedsländern das Gefühl zurückgibt, innerhalb der Gemeinschaft ihre Eigenständigkeit bewahren zu können. Etliche Seiten kreisen um das Thema Identität und Staatsbürgerschaft. Auch so ein durch die Diskurse der Rechten forciertes Thema. Ein nicht unwichtiges, das auch den Topos Heimat berührt. Wolffsohn: „Die Rückwendung zum Begriff Heimat ist kein Politikersatz. Sie ist Ausdruck dafür, dass Menschen Schutz und Geborgenheit wollen.“
Das ist eine Position, der Bröning widerspricht. Nicht die einzige übrigens, auch wenn Bröning wie Wolffsohn die Form waren. Sie bleiben respektvoll, nehmen die Argumente des anderen dann und wann auch auf, formulieren ihre Gegenposition. Das Problem ist dann eher, dass das dann einfach so stehenbleibt. Als wäre gar nichts passiert. Als hätten beide wirklich hier nur gepflegt ihre Positionen ausgetauscht. So, wie das in der heutigen Diskussionskultur so üblich ist. Man tauscht die Positionen aus, nicht einmal die Argumente. Und mittendrin sitzt ein braver Moderator als Stichwortgeber, der zwei kühnen Eigenbrötlern den Raum gibt, sich aneinander zu reiben.
Das Problem, das man leider immer wieder erlebt: Es fließt nichts zusammen. Das Gespräch wird nicht wesentlich. Und gerade an den spannendsten Stellen hakt Bingener nicht nach, das Duett plätschert einfach weiter.
Ich lese so ein Buch ja auch als Journalist, schaue: Wie macht das der Journalist in diesem Fall? Denn es sind ja hunderte hochbezahlte Kollegen, die alleweil durchs Land fahren und sich als Moderatoren solcher Diskussionen anbieten. Es sind so viele Diskussionen, dass man eigentlich denkt: Da müsste doch mal was bei rauskommen, irgendein Geistesblitz, ein Gespräch, das sich tatsächlich hochschaukelt bis alle Beteiligten das Gefühl haben: Jetzt haben wir die Katze am Schwanz gepackt, jetzt haben wir wirklich mal des Pudels Kern erwischt und ein Dilemma geklärt.
Aber wer zu solchen Diskussionsveranstaltungen tingelt, der weiß: Genau das passiert fast nie. Und leider betätigen sich die eingekauften Journalisten meist nur als Stichwortgeber und beherrschen auch ihr Handwerkszeug nicht, nämlich in den Situationen, in denen verquere Behauptungen im Raum stehen, einzuhaken und nachzufragen.
Ein Beispiel ist Wolffsohns geradezu tollkühner Ausflug beim Thema Migration und Überbevölkerung. Das Wort Überbevölkerung stammt von Bingener, sodass die nächsten Äußerungen natürlich sofort wieder in die Malthussche Denkfalle geraten. Denn wenn man allein die Bevölkerungsentwicklung in Afrika sieht und darin den Hauptgrund für die Migrationsbewegung Richtung Europa sieht, kommt man ganz bestimmt nicht zu einer brillanten Antwort. Und landet – leider – wie Wolffsohn wieder in einer obskuren Denkschleife: „Sowohl der Nationalsozialismus als auch der Kolonialismus sind abgeschlossen, trotzdem hält sich ein völlig ahistorisches Kollektivschuldverständnis. Das ist zwar sympathisch, löst aber die heutigen Weltprobleme nicht, im Gegenteil. Hier liegt ein falsches, irrationales Verständnis von Humanität vor.“
Auch Bröning reagiert hier übrigens nicht, sondern bringt wieder nur seine Position vor, die durchaus einen klugen Denkansatz bietet: „Vor allem, weil uns die Migrationsforschung auch sagt und zeigt, dass globale Migration globale Ungleichheit eben gar nicht deutlich verringert. Sie kann also nicht die Antwort auf globale Ungerechtigkeit sein.“
Worauf dann wieder Bingener hätte eingehen können, ist das ja nun wirklich die zentrale Frage unserer Zeit: Wie kann man die Weltgemeinschaft so stabilisieren, dass Menschen nicht mehr zu Millionen zur Flucht gezwungen sind? Wo wären die Lösungsansätze? Und wie sollte man es anpacken, sodass nicht wieder nur die Reichen im Norden so tun, als würden sie den Naiven da unten im Süden sagen müssen, wo es langgeht?
Denn mit seiner hingeworfenen Behauptung, Nationalsozialismus und Kolonialismus seien „abgeschlossen“, liegt Wolffsohn ja nun wirklich komplett daneben. Beides verzerrt heute als Neo-Faschismus und Neo-Kolonialismus unsere Gegenwart. Und auch in dem, was gern so flapsig als Globalisierung bezeichnet wird, steckt jede Menge moderner Neokolonialismus. Dass die Länder der ärmeren Welt derart ausgeplündert werden, hat mit unseren Wirtschaftsstrukturen zu tun. Worauf zumindest Bröning eingeht, der zumindest die fatalen Folgen der neoliberalen Wirtschafts- und Politikreformen sieht, wo Wolffsohn lieber von einer „Wir“-Krise redet und dem hohen Wert der Freiheit. Die Formel vom ständig wachsenden Sozialstaat hat er auch parat und die von der ständig steigenden Staatsquote. Die Staatsquote bezeichnet das Verhältnis der Staatsausgaben zum Bruttoinlandsprodukt.
Selbst Wikipedia diskutiert ja das Phänomen der „ständig steigenden Staatsquote“, obwohl die Zahlen, die Wikipedia ebenso fleißig sammelt, zeigen, dass Deutschland erstens gar nicht zu den Ländern mit der höchsten Staatsquote gehört und dass die Staatsquote vor allem in Krisenzeiten steigt, dann nämlich, wenn die Wirtschaft kriselt und weniger beisteuern kann zu den Staatsausgaben.
Wolffsohn redet gern – ganz Hochschullehrer – von Evidenz. An manchen Stellen so oft, dass augenscheinlich auch Bröning das zu viel wird, sodass er dem Mann, der selbst im Neoliberalismus Liberalität zu entdecken glaubt, erklärt, wie Margaret Thatchers Slogan „There is no Alternative“ als politisch manifestierte Alternativlosigkeit zur absoluten Marktkonformität die Demokratie regelrecht zerstört. „Alternativen sind nicht denkbar, weil es nur den einen, nämlich den der marktkonformen Demokratie gibt, wie Angela Merkel das genannt hat. Wo aber jede vernünftige Alternative als utopisch hingestellt wird, entwickeln sich radikale Antworten.“
Wenig später führt er es noch weiter aus. Denn wenn Politik so agiert, dass Menschen nicht mehr wichtig sind – denn so agiert Neoliberalismus nun einmal – dann bekommen Menschen natürlich ganz fundamentale Ängste um ihr eigenes Dasein. Was ja derzeit noch durch die Werbekampagne zur Digitalisierung befeuert wird: „Aber jetzt, wo Technologie Arbeit zunehmend überflüssig machen könnte, wandelt sich der Kampf gegen Ausbeutung zum Kampf gegen die eigene Bedeutungslosigkeit“, sagt Bröning. „Das ist etwas fundamental anderes. Es ist ein Kampf gegen die Ersetzbarkeit von Menschen, die fürchten, dass sie ökonomisch nicht mehr gebraucht werden.“
Was dann zumindest im Weiteren zur Diskussion über die Rolle des Nationalstaats führt und die Frage – wie Bröning es ausdrückt – ob die „Menschen das Gefühl haben, dass sie Gestalter ihres Schicksals sind und selbst entscheiden können, wie sie leben wollen.“ Da sieht er auch die Wurzeln für den heutigen Nationalismus und die Abwehrreflexe eines Großteils der westlichen Gesellschaften.
Oder mal so formuliert, weil die beiden im Gespräch leider nicht dazu kommen: Wie wollen die Europäer sich anmaßen, die Welt in Ordnung zu bringen, wenn sie nicht mal bei sich zu Hause schaffen, Menschen das Gefühl echter demokratischer Teilhabe und größtmöglicher Selbstbestimmung zu geben? Sie deuten es beide zumindest an, wenn sie auf den Placebo-Charakter solcher Begriffe wie Heimat, Nation und Volk zu sprechen kommen. Denn dahintersteckt natürlich auch die Frage, die gerade Ostdeutschland bewegt: Wer integriert eigentlich uns?
Und es sind ja nicht nur die Ostdeutschen, die das Gefühl haben, am Katzentisch zu sitzen. Europa ist voller solcher abgehängter Regionen. Und die beiden Gesprächspartner stellen das natürlich auch und gerade für die osteuropäischen Staaten fest, wo eine Reihe autokratischer Regierungen an die Macht gekommen sind, die den Diskurs in der EU sichtbar verschärfen.
Was dann tatsächlich auf Seite 155 erstmals zu einem echten Schlagabtausch über die Differenzen unter den Europäern zwischen den beiden führt.
Wolffsohn: „Aber die führen nicht Krieg, das ist ein entscheidender Punkt.“
Bröning: „Noch nicht, aber …“
Wolffsohn: „Nein, sie werden auch nicht.“
Bröning: „… würden Sie die Hand ins Feuer legen, dass das in zwanzig Jahren auch noch so ist?“
Wolffsohn: „So weit geht der Todestrieb nicht. Der interessegebundene Überlebenstrieb ist stärker, da bin ich sicher.“
Ein Dialog, der jetzt eigentlich den zwischenfragenden Journalisten gebraucht hätte. Aber leider geht Bingener auch hier leichterhand zum nächsten Thema über, lässt auch das in der Luft hängen. So, wie wir es in der deutschen medialen Diskussion immer wieder erleben. Da, wo es spannend wird, wird einfach nicht weitergefragt, weichen auch die Kontrahenten einander aus, als ginge es nur darum, ihre Position in den Raum zu stellen, aber nicht über deren Grundlagen und Hintergründe und mögliche Schwachstellen zu reden. Es wird also – anders als Wolffsohn so gern sagt – nie wirklich evident. Woran er nicht ganz unschuldig ist. Ganz am Schluss, als Bröning noch einmal aufs Grundgesetz zu sprechen kommt, sagt Bröning auch noch einen Satz, der das Thema der Alternativlos-Debatte noch einmal aufgreift: „Es geht darum, den Menschen nie als bloßes Mittel zum Zweck zu betrachten – auch nicht für einen vermeintlich besonders guten.“
Und darauf reagiert Wolffsohn mit einem „symbolische Amen“, alle „Demokratie(n) haben erhebliche demokratische, wirtschaftliche, kulturelle, rechtliche oder ethische Defizite. Auch unsere. Aber gibt es bessere? Ich kenne keine.“
Mit solchen Sätzen lässt man die Luft raus und die Aussage des Gegenspielers einfach in der Luft hängen. Wer beide Aussagen zusammendenkt merkt, was für eine Schlucht Wolffsohn hier aufgerissen hat, denn eine Demokratie, die „den Menschen … als bloßes Mittel zum Zweck“ betrachtet, hat gravierende und grundlegende Probleme. Darüber sollte geredet werden. Denn genau das ist es, was vielen Menschen das dumme Gefühl gibt, nicht mehr wichtig zu sein, überflüssig oder gar lästig. Dieses Gefühl macht sie anfällig für die Verheißungen der Rechten.
Schade eigentlich. Oder: Wann lernen wir eigentlich, uns richtig zu streiten?
Michael Bröning, Michael Wolffsohn Stadt, Land, Volk, Edition Chrismon, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2019, 14 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
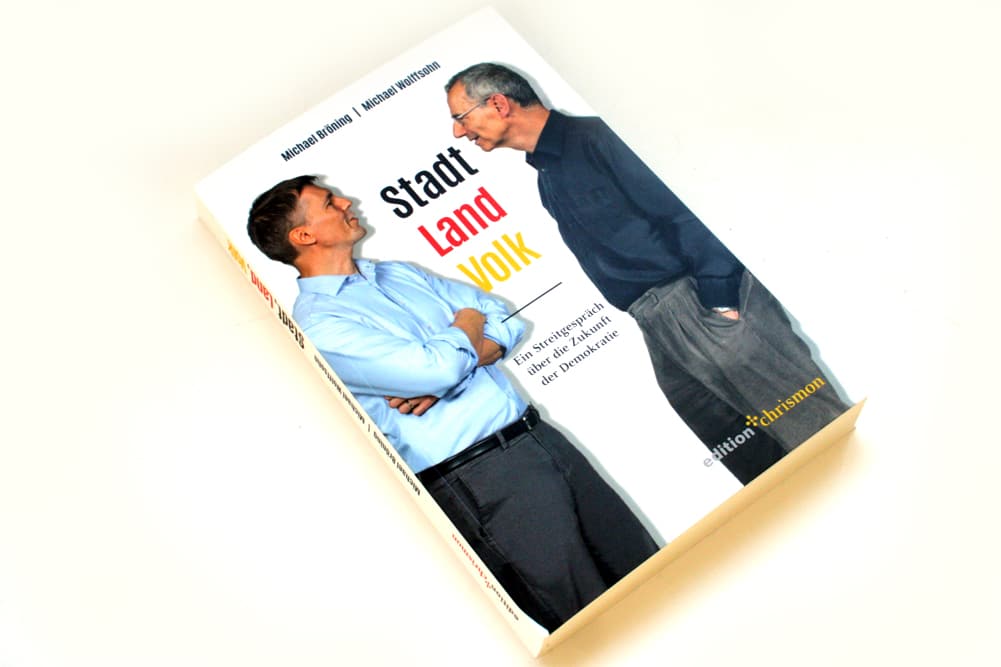









Keine Kommentare bisher