Es gab mal eine Zeit, da wuchsen Jungen nicht mit Ballerspielen am PC auf, sondern mit Western. Ganz zu Anfang mit Wild-West-Romanen in gedruckter Form. Da durften Karl May und James Fenimore Cooper im Regal nicht fehlen. Später dann mit Westernfilmen im Kino. So etwas prägt. Auch einen Mann wie Dieter Döhrel, der seinen Ruhestand dazu nutzt, jene Western zu schreiben, die er im Buchladen schon lange nicht mehr findet.
Der Verlag preist seine mittlerweile drei Bücher der Shane-Calhoun-Serie gleich mal als „neue Western-Generation“ an. Und es steckt etwas darin, was man nicht überlesen kann, wenn man mit dem in den wilden Nordwesten aufgebrochenen Shane Calhoun nun zum Stamm der Nardic kommt, die dort – abseits der vordringenden weißen „Zivilisation“ – ihr Leben im Einklang mit der Natur führen. Etwas, was man in den Westernfilmen der letzten Jahrzehnte nicht mehr findet, wo es in der Regel zusehends brutaler zuging, dreckiger und machohafter.
Ganz so, als hätten die genialen Western-Parodien von Sergio Leone der Legende von der „edlen Rothaut“ endgültig den Garaus gemacht und das Genre nun ganz zum Schauplatz egoistischer Banditen und rabiater Ordnungsmacher werden lassen, die nur noch mit schnellem Colt alles niedermähen, was irgendwie nach Verbrecher und Ganove aussieht.
Was danach kam, hat mit dem Ursprung des Genres, wie man es in Coopers Lederstrumpf-Erzählungen findet, nichts mehr zu tun. Das ist im Grunde eine bittere Ernüchterung, denn gerade diese rabiaten Showdown-Filme zeigen eine Menge von heutigem Wettbewerbsdenken, das immer unfähiger wird, die anderen als Kooperationspartner zu begreifen. Kaum ein Filmgenre zeigt die Denkart entfesselter „Kämpfer für Recht und Ordnung“ oder auch wahlweise „Freiheit“ besser als diese blutigen Aufräum-Filme, die das Störende nicht als akzeptabel erscheinen lassen, sondern „aufräumen“, eben alles niederballern, was da eben noch frech in die Kamera gegrinst hat.
Der edle Held? Wo ist er geblieben?
Wahrscheinlich war er nie Teil der Realität, sondern immer – wie bei Cooper und May – eine Konstruktion. Und zwar nicht für etwas, was man glaubt, entdeckt zu haben, sondern gegen etwas: nämlich gegen die frustrierenden Erfahrungen einer neuen, auf nichts mehr Rücksicht nehmenden Konkurrenz-Gesellschaft, in der Gier und Rücksichtslosigkeit die Regeln machen. Einer Gesellschaft, die noch als Gegenbild auftaucht – bei Cooper schon, der ja unübersehbar das romantische Ideal vom „edlen Wilden“ übernahm, das in Europa damals im Schwange war.
Selbst die Mantel-und-Degen-Romane von Alexandre Dumas erzeugen lauter edle Außenseiter-Gestalten, mit denen sich eine zutiefst verunsicherte Gesellschaft identifizieren konnte. Nicht die Action, die heute sämtliche Remakes alter Verfilmungen so ungenießbar macht, war das eigentlich Attraktive an diesen Romanen, sondern der Entwurf von neuen Helden, die ihre besonderen Fähigkeiten nicht dazu nutzten, sich rücksichtslos durchzusetzen, sondern um dem Guten zu seinem Recht zu verhelfen.
Und solche Bücher prägen – fürs Leben. Sie geben gerade Jungen eine Botschaft mit, die sie anderswo kaum noch finden, ganz im Goetheschen Sinn: „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut …“
Und der vielbegabte junge Shane Calhoun verkörpert genau das idealtypisch, ganz zu schweigen davon, dass er ein Held wirklich ohne Fehl und Tadel ist, aufgewachsen mit Menschen, die den Willen zum Guten in ihn einpflanzten und von denen er all die Fähigkeiten erlernte, mit denen er in der Wildnis überleben kann. Und nicht nur das: Er hat auch verinnerlicht, wie man mit Tieren respektvoll umgeht, dass man Schwächeren hilft mit aller seiner verfügbaren Kraft, und dass man echte Freunde gewinnt, wenn man mit den Menschen respektvoll und achtungsvoll umgeht, auch dann noch, wenn man ihre Schwächen und Unvollkommenheiten kennt.
Und auch der Stil, in dem Döhrel seine imaginierte Welt im wilden Nordwesten kurz vor Ende des 19. Jahrhunderts beschreibt, erinnert an die Zeit der Scott, Dumas und Cooper, an ihre ausführlichen Beschreibungen edlen Handelns, fairer Kämpfe und des Respekts unendlicher Bescheidenheit, mit der sich ihre hochbegabten Helden in den Dienst der guten Sache stellen.
Und nicht nur Dieter Döhrel sehnt sich augenscheinlich danach, dass es das in unserer mobbenden, trollenden und hatenden Gegenwart doch irgendwo geben möge. Denn die Helden unserer Gegenwart sind ganz unübersehbar brachiale Kraftmeier, die ein Männlichkeitsideal verkörpern, das eher an Räuber, Banditen und Mafiosi erinnert – eigentlich eine Art kraftmeierndes Schlappschwanz-Ideal für Dummköpfe, die nicht wissen wohin mit ihrer Kraft. Von Emotionen ganz zu schweigen. Oder gar Mitgefühl mit einer zutiefst verletzten und gefährdeten Welt.
Dass sie so wie bestimmt Döhrel in seiner Jugend die Lederstrumpf-Romane verschlungen haben könnten, darf man wohl bezweifeln. Und dass sie wie dieser Shane Calhoun auf sich allein gestellt in der Wildnis überleben könnten, wohl auch. Die Konfrontation mit der unerbittlichen Natur ist auch ein Idealbild für etwas, was es in unseren aufgeräumten Landschaften nicht mehr gibt: Shane musste lernen, sich Nahrung, Obdach und Wärme selbst zu verschaffen, sich also allein auf sich gestellt behaupten lernen.
Und eben nicht nur das. Sonst wäre er wohl nur ein grimmiger Trapper geworden. Aber Döhrel lässt ihn immer wieder in typische Situationen geraten, in denen er beweisen muss, dass er andere Menschen zu respektieren weiß – und es auch kommunizieren kann. Was ja beinah ein zentrales Element all der großen Indianergeschichten ist, in denen die Helden sich mit vielen Worten herantasten und eine gemeinsame Ebene des Verstehens aufbauen. In schönster „Indianersprache“, wie man sie von Karl May kennt.
Und die auch bei Döhrel Seiten füllen kann, denn diesmal kommt der junge Abenteuersucher tatsächlich in Kontakt mit den Nardic, rettet dem Häuptling das Leben und wird zum Blutsbruder des Geretteten, was ihm den Weg eröffnet, Teil des Stamms zu werden und mit den Nardic zu leben, zu jagen, zu feiern. Augenscheinlich hat er das Ende des Regenbogens gefunden, das ihm sein Vater vor Jahren verhieß, als er es in der Halbzivilisation der elterlichen Farm nicht mehr aushielt, weil ihn die Unruhe hinaustrieb in die noch nicht von der „Zivilisation“ überrannten wilden Berggegenden.
Und in dieser Sehnsucht steckte auch der Wunsch nach einem Ort, an dem er sich wirklich heimisch fühlen könnte. Und man stellt sich genau dann, wenn es angesprochen wird, immer wieder diesen hochbetagten Autor in Göttingen an seinem Schreibtisch vor, wie er (wahrscheinlich am PC) seinen Träumen von einem richtigen Leben versucht eine Ideal-Gestalt zu geben. Denn solche Geschichten fassen ja nicht zuerst unsere Lust am lesbaren Abenteuer, sondern den Wunsch des Autors, selbst so zu sein.
Oder so gelebt zu haben: auf ein Ideal hin vom richtigen Leben auf dieser Erde. Ein Ideal, das augenscheinlich nur in eine noch nicht dem Machbarkeitswahn unterworfene Wildnis zu projizieren ist, wo es immer ums Ganze geht. Ein Ideal, das aber auch den Wunsch einschließt, dass man mit solch respektvollem Verhalten allen Menschen und jeder Kreatur gegenüber auch wieder Respekt, Dankbarkeit und Vertrauen erwirbt. Und die Welt ein bisschen besser macht.
Was freilich den nachdenklichen Helden braucht, der über das Einssein mit der Welt genauso reflektiert wie über die anspruchsvollen Sitten der Nardic, die den Schwarzen Panther, wie er sich nennt, aufnehmen bei sich und teilhaben lassen. Und die Liebe zur Häuptlingstochter gibt es quasi noch extra obendrauf und sehr ausführlich, weil auch hier spürbar wird, dass Döhrel von wirklicher Liebe erzählen möchte, nicht von dem heute in der Regel üblichen „seinen Leidenschaften verfallen“ oder „seinen Trieben nachgeben“.
Also das Gegenteil von „Fifty Shades“ von Irgendwas, sondern eher hundert Farben von Werben, Flüchten, Vortasten, Annähern und Vertrauen gewinnen. Was bei Shane und der schönen Häuptlingstochter Naima tatsächlich Zeit braucht. So viel Zeit, wie sich wahrscheinlich die meisten heute Partnerwählenden gar nicht mehr nehmen – oder auch nie genommen haben, weil alles schnell gehen muss, und dabei am Ende husch-husch.
Döhrels Bücher sind also echte Widersprüche gegen eine vom Galopp besessene Zeit mit all ihren falschen Ansprüchen an Marktwert und Perfektion. Er setzt nicht nur die stille und werbende Aufmerksamkeit als Kontra, sondern auch die Rücksicht auf den jeweils anderen, in dem sich ja – wie bei Shane und Naima – die eigenen Unsicherheiten spiegeln. Ein Held, der nicht so tut, als wäre er schon in allen Dingen erfahren. Kaum noch vorstellbar in einer Zeit, in der junge Großmäuler davon rappen, wie sie die Bitches flachgelegt haben. Kann es sein, dass unsere Gesellschaftsvorbilder mittlerweile Gangster, Lügner, Diebe und Dummköpfe sind, die uns Lebensideale vorgaukeln, die an Flachheit und Bosheit nicht mehr zu überbieten sind?
Kann es sein, dass es nicht nur Dieter Döhrel so geht, dass er sich von dieser allgegenwärtigen Aggressivität nicht nur frustriert fühlt, sondern regelrecht abgewertet? Sodass er diesem Stumpfsinn ein nun schon fast verschüttetes Ideal entgegensetzt – und auch ein anderes Männerbild, eines, das Respekt, Einfühlung und Ratlosigkeit zulässt, gerade da, wo es um menschliche Beziehungen geht?
Ich denke mal: Ja. Genau so ist es.
Ganz zu schweigen davon, dass man beim Lesen dieser oft sehr ausführlichen Schilderungen von Natur, Sitten, dem Umgang mit Tieren, den Festen und Gesprächen zu zweit immer so eine vage Sorge im Hinterkopf hat. Denn in den großen Romanen und Filmen bricht gerade an so einer Stelle, wo alles im Einklang zu sein scheint, meist eine Horde brutaler weißer Männer in die Idylle und verwandelt sie mit bösem Lachen in die Hölle auf Erden. Aber es geschieht nicht. Im Gegenteil: Das Buch klingt aus mit einer großen Erfüllung, in der Shane gefunden zu haben scheint, was er gesucht hat. Sozusagen stellvertretend für den Autor, der ja in so einem Fall selbst Gott spielen darf und einmal, nur einmal so schreiben darf, als hätte er verkündet: „Alles wird gut!“
So, wie man es im realen Leben hienieden in deutschen Landen eher selten sagen kann, weil es doch meist immer einen gibt, der meint, es einem so richtig beweisen zu müssen, eine fette Rechnung präsentiert oder vor den Kadi zerrt. Der Riss geht durch unser eigenes Land. Und was Döhrel mit so viel Aufmerksamkeit für jede Gefühlsregung schreibt, ist im Grunde ein zwar romantischer, aber sehr farbenreicher Protest gegen all dieses Kraftmeiertum, das unsere Gegenwart so schmierig und schäbig aussehen lässt.
Dieter Döhrel „Shane Calhoun. Im Reich der Nardic“, Einbuch Buch- und Literaturverlag, Leipzig 2018, 13,90 Euro.
Die neue Leipziger Zeitung Nr. 63: Protest, Vertrauen und eine gute Frage
Die neue Leipziger Zeitung Nr. 63: Protest, Vertrauen und eine gute Frage
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
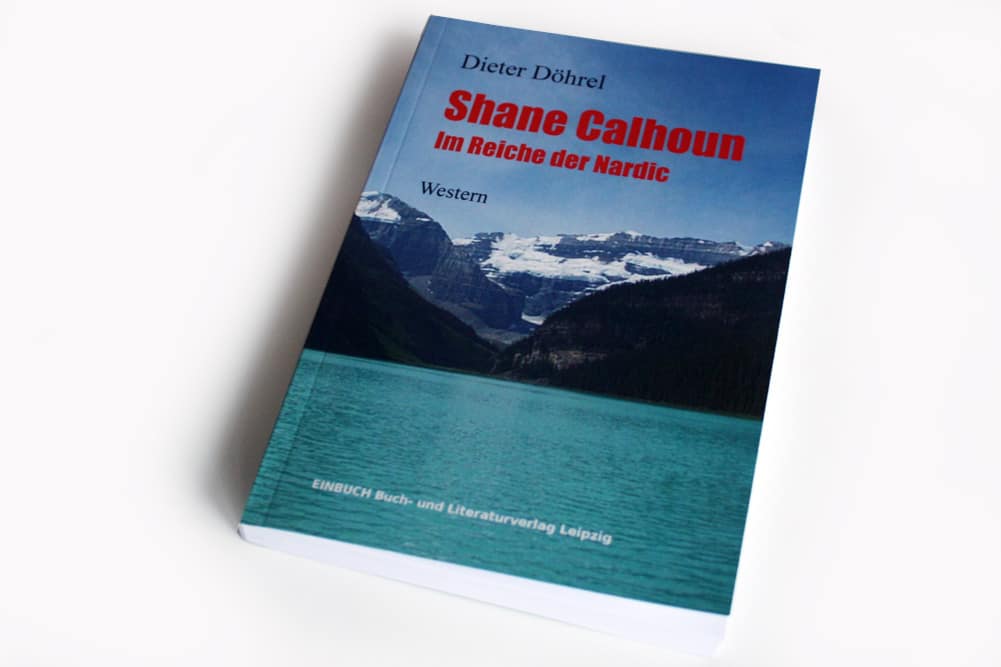








Keine Kommentare bisher