Die Engländer waren bezaubert, als der Verlag Old Street Publishing Ltd. 2017 „The shortest History of Germany“ von James Hawes herausbrachte. Einen Vorgängerband hatte es 2010 schon mit „The shortest History of Europe“ von John Hirst gegeben. Es passiert Erstaunliches, wenn man eine Geschichte von 2.000 Jahren tatsächlich versucht, in 300 Seiten zu packen.
Denn dann braucht man einen roten Faden oder einen blauen, mit dem die Logik in der Entwicklung so seltsamer Gebilde wie Europa bzw. Deutschland sichtbar wird. Eine Logik, die mit den üblichen Fürsten-, Kriegs- und Nationalerzählungen wenig zu tun hat, die ja bekanntlich eher 1.000-seitige Schwarten füllen und den Leser erschlagen mit Namen, Titeln, Schlachten und anderem Mumpitz, der die Köpfe verkleistert.
Denn das ist alles Staffage, der ganze Bühnenfirlefanz von ruhmsüchtigen Leuten, der sie größer und wichtiger dastehen lässt, als sie tatsächlich waren. Es überblendet die großen Muster, die tatsächlich eine Rolle gespielt haben bei der Entstehung einer Nation. Obwohl das ein moderner Begriff ist. In der Geschichte changiert ja alles, sucht aber trotzdem die gemäßigte, nachhaltige Form.
Und das macht James Hawes, der deutschen Lesern auch als Autor eigenwilliger Romane bekannt ist, mit dem Kunstgriff deutlich, seine deutsche Geschichte praktisch mit Cäsar beginnen zu lassen. Denn Cäsar war es ja, der den Bewohnern der Landstriche jenseits des Rheins erstmals den Namen Germanen verpasste, obwohl die sich selbst nicht so nannten. Am großen Fluss, der für Jahrhunderte die Grenze zwischen dem Römischen Reich und dem Land der dann von Tacitus zu „edlen Wilden“ gemachten Germanen bildete, war alles im Fluss.
Germanen lebten hüben wie drüben. Wer westlich des Rheins lebte, wurde romanisiert. Davon erzählen heute noch die eindrucksvollen Funde von Trier bis Xanten. Und die wichtigste These von Hawes dabei: Die beiden großen Ströme, die den Vormarsch der Römer stoppten, bilden bis in die Gegenwart auch die markanten Bruchstellen innerhalb Deutschlands – mit einem unstreitig westlich orientierten Deutschland westlich des Rheins, einem sich ebenfalls westlich einsortierenden klassischen Lebensraum der Deutschen zwischen Rhein und Elbe (bis wohin es die Römer auf ihren Expeditionen schafften). Und dem unheimlichen Rest östlich der Elbe: Ostelbien, das irgendwie immer nicht richtig dazugehörte und sich im Lauf der Geschichte auch immer eher nach Osten orientierte.
Aus nachvollziehbaren Gründen, was aber anfangs nichts mit Moskau und Ulbricht zu tun hatte, sondern bis weit ins 13. Jahrhundert hinein natürlich damit, dass das alles eigentlich slawisches Siedlungsgebiet war, das ab Karl dem Großen in den Fokus der westlichen Eroberer geriet und auch zu Kaiser Ottos Zeiten, als eigentlich das deutsche Reich tatsächlich entstand, nur eine aufrührerische Provinz war, eher Kolonie, von Markgrafen mit fester Hand befriedet, aber erst spät wirklich ins Reich integriert.
Nur gehen die Slawen auch Hawes irgendwann verloren, nur die Unsicheren, in ihrer Existenz sich immerfort unsicher fühlenden Bewohner des Landstrichs bleiben in seiner Geschichte. Was für ihn auch die Wahlerfolge der AfD im Osten erklärt.
Eine schöne These, die scheinbar vieles erklärt, was in der deutschen Geschichte schiefgegangen ist. Wobei Hawes natürlich in einem recht hat: Deutschland ist tatsächlich die Mitte Europas. Kein Land ist schon aufgrund seiner Lage und Größe zwangsläufig so hin- und hergerissen zwischen dem Westen und dem Osten wie Deutschland.
Da ist es schön, mit Hawes über die ganzen zwei Jahrtausende zu verfolgen, wie aus dem von Cäsar definierten Siedlungsgebiet der Germanen erst das Ostfränkische Reich wird, dann der Kern dessen, was sich immer als Deutschland verstanden hat und was nach 1945 dann zur BRD wurde. Keine Überraschung also, wenn der Rheinländer Adenauer dieses westliche Deutschland immer als das eigentliche betrachtete und von allem jenseits der Elbe gern als „Asien“ sprach.
Was nicht mit der russischen Besatzungsmacht allein zu tun hatte, sondern mit seiner langen Erfahrung als Politiker aus dem katholischen Rheinland, der im Lauf seines Lebens immer wieder erlebte, wie aus dem preußischen Osten des Reiches erst zwei Kriege angezettelt wurden und auch noch eine wilde Junkerdiktatur geboren wurde, die es ohne den erzkonservativen Osten nie gegeben hätte. Denn nichts anderes war das Nazi-Reich, was einem natürlich wie Schuppen von den Augen fällt.
Denn aus der seit 1990 geschriebenen Geschichtsbetrachtung ist es fast verschwunden. Da musste man sich wieder mit dem ganzen verlogenen Ehrenquark der Wehrmacht beschäftigen, mit dem hochbezahlte Historiker das Nazi-Reich und seine wilden Heere weißzuwaschen versuchten. Da war selbst die DDR-Geschichtsschreibung weiter. Vielleicht gerade deshalb, weil man einerseits die kritische linke Geschichtsbetrachtung eines Franz Mehring fortführte (Stichwort: „Lessing-Legende“), andererseits natürlich auch ein produktives Verhältnis zu jenem Land suchte, das bis 1945 große Teile der späteren DDR umfasste: Preußen.
In der Spätzeit der DDR dominierte dann zwar eine ziemlich seltsame Preußenverehrung – nicht nur in der von preußischem Drill dominierten NVA, sondern auch in der Aneignung von echten preußischen Kommissköppen wie Friedrich Zwo und Bismarck. Aber ganz verschwand die klare und berechtigte Kritik an der fatalen Rolle des preußischen Junkertums und Militarismus aus Mehrings Analyse nie.
Und auch Hawes kommt irgendwann zwangsläufig zu Preußen und seiner fatalen Rolle als innerdeutsche Hegemonialmacht. Und sehr schön bildhaft schildert er die Funktionsweise dieses Staates, in dem die preußischen Landadeligen (die Junker) das Sagen hatten, sämtliche hohen Posten in Verwaltung und Militär besetzten und spätestens ab 1866 ihre arrogante Art, die Welt zu betrachten, zur Staatsraison erst des Norddeutschen Bundes und dann des Reiches machten.
Und sehr treffend schildert Hawes, wie das dominierende preußische Junkertum ab 1866 (und auch durch Bismarck) seine Art, die Welt zu sehen, zur deutschen Politik machte. Das Deutsche Reich zwischen 1871 und 1945 nennt Hawes deshalb auch folgerichtig eine „preußische Anomalie“. Nicht einmal in der Weimarer Republik gelang es, den preußischen Militarismus und Junkergeist zu zähmen. Im Gegenteil: Die preußischen Adelssöhne machten gleich 1919 bruchlos weiter und agierten in den Freikorps brutal und rücksichtslos.
Und sie waren auch der Grundstamm des Offizierskorps, das von Hitler die Möglichkeit bekam, sich in genau jenen widersinnigen Schlachten auszutoben, von denen die preußischen Junker schon immer geträumt hatten. So wie sie es unter den preußischen Junkern Hindenburg und Ludendorff auch schon im 1. Weltkrieg durften.
Und natürlich liest man Hawes Geschichte aus ostdeutscher Perspektive mit einem gewissen Unbehagen, aus sächsischer Perspektive erst recht, denn Sachsen gehörte bis 1866 eindeutig zu den süddeutschen Staaten, die mit dem preußischen Machtanspruch ihre echten Probleme hatten. Hinter Hawes These von Ostelbien taucht also die fatale Rolle Preußens auf, das bis 1945 auch immer Grenzland und Kolonialmacht war, was seine eigenen Ostgebiete betraf, wo in der Regel deutschsprachige Minderheiten über eine slawische Mehrheit regierten. Und sie entsprechend ausplünderten. Die Leibeigenschaft hatte Friedrich Zwo ja nur auf den königlichen Domänen abgeschafft, auf den Gütern der ostelbischen Junker blieb die Unfreiheit der meist polnischen Arbeitskräfte erhalten.
Was dann auch den Zwiespalt der deutschen Politik ab 1871 ergab, wie Hawes zu Recht feststellt: Der Westen Deutschlands war modern, nach Westen orientiert und technologischer Spitzenreiter (auch bei der Entwicklung von Kriegswaffen), der preußische Osten war rückständig und geprägt vom militaristischen Korpsgeist der Junker. Und zwar so sehr, dass die NSDAP hier schon Wahlerfolge feierte, als sie im deutschen Süden und Westen noch längst keine Chancen hatte.
Hawes liebt es, Geschichte an Karten darzustellen und zu zeigen, wie stark deutsche Politik immer wieder auch von den alten konfessionellen Grenzen zwischen Katholiken und Protestanten geprägt war. Und da rückt selbst die Gestalt eines Luther bei ihm in ein anderes Licht, denn Luthers Verhältnis zur Obrigkeit fand im Lauf der Geschichte nirgendwo so eine radikale Bejahung wie just in Preußen. Oder mit Hawes’ Worten: „Der lutherische Christ konnte sein Heil nur sichern, indem er Gott im Himmel – und dem Landesherrn auf Erden – unbedingt Glauben und Treue zollte: sola fide.“
Das wird dann der preußische Untertanengeist. Und man möchte eigentlich abbiegen mit Hawes und darauf eingehen, was dieser Untertanengeist eigentlich angerichtet hat. Denn die Elbe ist wirklich unschuldig. Aber wenn Menschen jahrhundertelang unter Verhältnissen leben (müssen), in denen „Üb immer Treu’ und Redlichkeit“ gepredigt wird, dann prägt das. Dann bildet sich schon in dem, was Kindern beigebracht wird, das Verhältnis zu „denen da oben“ ab.
Ich biege hier natürlich ab aus Hawes’ „kürzester Geschichte“. Denn dazu regt sie natürlich an. Gerade dann, wenn man in der Landschaft aufgewachsen ist, die er so kritisch sieht. Aber es ist nicht die Landschaft, die kritisch ist. Es ist die gelebte Kultur. Das fiel selbst im „Luther-Jahr“ 2017 auf, in dem der große Reformator gefeiert, sein fatales Verhältnis zur Obrigkeit und zur Gewalt aber eher nur beiläufig diskutiert wurde. Und selbst von Fontane kennt man die intensiven Schilderungen, wie sehr lutherisch-protestantische Selbstzucht immer zwei Seiten zeitigte: die Bereitschaft zum Verzicht und zur Leistungserbringung ohne Klagen und Widerspruch – und auf der anderen Seite die militärische Rücksichtslosigkeit, allen Widerspruch auch mit dem Schwert oder dem Knüppel niederzuschlagen.
Die Anomalie, die Hawes benennt, ist die schlichte Tatsache, dass schließlich selbst im Nazi-Reich das Denken der preußischen Offiziere als „deutscher Geist“ gefeiert wurde. Und die Rechtsradikalen von heute feiern nichts anderes als diese alte Überheblichkeit und Menschenverachtung der preußischen Landjunker. Aber wer sich umschaut, sieht, dass das alles immer noch da ist. Es steckt in den Köpfen, lauter Diederich-Heßling-Typen betreten die politische Bühne und benehmen sich so rücksichtslos, dreist und erpresserisch wie zu Bismarcks Zeiten die Junker aus Ostelbien.
Und sie bekommen Widerhall dafür. Ein Widerhall, der sich eigentlich nur daraus erklärt, dass die Erziehung zum (preußischen) Untertanen noch immer funktioniert. Sie wurde im Osten jedenfalls nie hinterfragt. Auch nicht, woher diese seltsame Haltung zum Staat kommt, in der der Wunsch nach einem „starken Führer“ noch genauso präsent ist wie die Verachtung für „die Politiker“. Oder noch schlimmer: „die Demokraten“.
Ich höre einfach auf an dieser Stelle. Es ist kein ganz zufälliger Abzweig aus Hawes’ Geschichte, den ich hier genommen habe. Mit dem Preußentum und einem fatalen Obrigkeitsverständnis bei Luther hat er auf jeden Fall zwei wesentliche Punkte genannt, die gerade die politischen Entwicklungen östlich der Elbe seit dem Großen Kurfürsten in ein gefährliches Fahrwasser gebracht haben. Und das steckt in den Köpfen, in der Alltagskultur und in der Erziehung. Es ist fatal, wenn man nach einer solchen Katastrophe wie dem Nazi-Reich nicht wirklich darangeht, die Ursachen solcher Fehlentwicklungen aufzudröseln.
Im Westen und im Osten hat man lieber schnell ein Mäntelchen des Verschweigens drübergelegt. Dem Westteil Deutschlands fiel es natürlich lagebedingt leichter, sich wieder in die westliche Staatengemeinschaft einzugliedern. Der Osten bekam seine nächste „preußische Herrschaft“, erzog weiter opferfreudige Protestanten (ohne Glauben) und anpassungsfähige Untertanen, die auch im Frühjahr 1990 nichts Eiligeres zu tun hatten, als den nächsten Starken Mann zu wählen. Und die jetzt untertänigst beleidigt herumlaufen und grölen „Merkel muss weg!“
Das ist ein verdammt alter Film, der da immer wieder gezeigt wird. Hoffnung zeichnet Hawes für Deutschland nur, weil dem westelbischen Deutschland „Staatsverehrung, puritanischer Eifer und schmissiger Militarismus immer völlig fremd gewesen waren“. Auf dieses Deutschland setzt er seine Hoffnung – und er erwartet von ihm auch, dass es endlich seine Rolle als „mächtiges Land im Herzen des Westens“ annimmt.
Und wir Ostdeutschen?
Tja. Da fehlt die Lösung noch. Aber vielleicht beginnt sie genau mit diesem über Jahrhunderte verkorksten Verhältnis zum Staat und zu „starken Männern“, dass es endlich zu überdenken gilt. Eigentlich – das kann man so zwischen den Zeilen lesen – fängt die Geschichte und das Erwachsenwerden des Ostens gerade erst an. Auch wenn nicht wirklich klar ist, ob wir das schaffen. Oder ob wir wieder mit unseren ostelbischen Möchtegern-Junkern versumpfen.
James Hawes Die kürzeste Geschichte Deutschlands, Propyläen, Berlin 2018, 18 Euro.
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
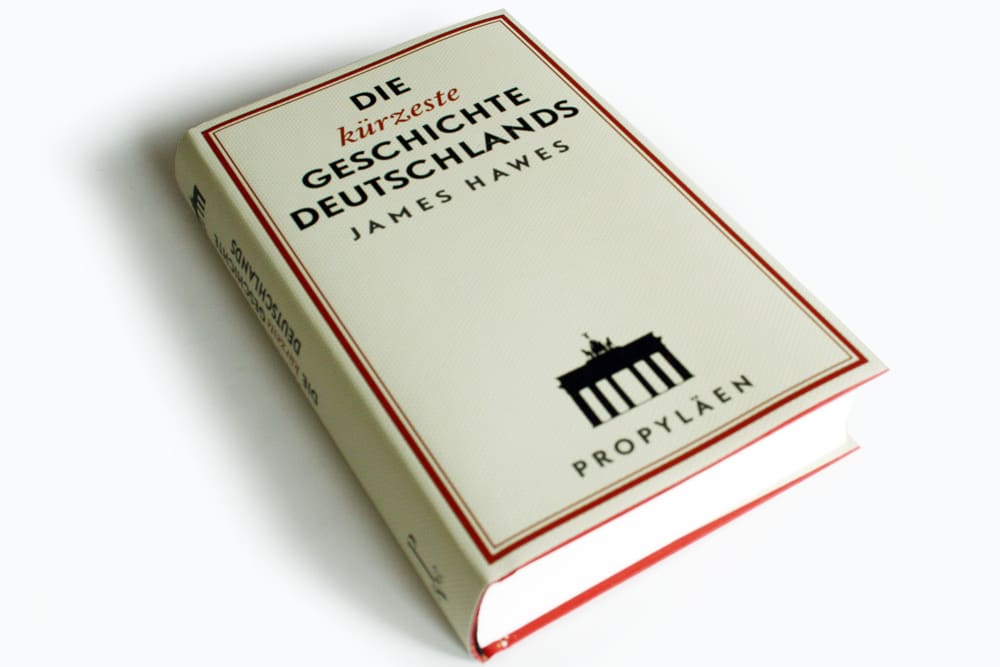










Keine Kommentare bisher