Für Freikäufer Die Potsdamer also auch? Natürlich. Was man aus Leipziger Sicht oft nicht wahrnimmt, ist die Tatsache, dass die Friedliche Revolution 1989 fast überall in der DDR gleichzeitig geschah. Die Auslöser waren ja auch überall dieselben. Nur eigneten sich Städte wie Leipzig natürlich eher dazu, auch zum Sammelpunkt der Revolution zu werden. Aber was passierte in Potsdam? Das hat Rainer Eckert nun doch mal interessiert.
Den Historiker kennen die Leipziger als langjährigen Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums. In zwei Büchern hat er sich schon ganz speziell mit der Leipziger Widerständigkeit beschäftigt, die ja auch deshalb in den Leipziger Forschungsfokus rückte, weil das Jahr 1989 ein exemplarischer Fall für gelungene Widerständigkeit war. Mit der Demonstration am 9. Oktober 1989 zeigten die Leipziger exemplarisch, wie weit man mit friedlichem Widerstand kommen kann, wenn nur genug Leute mitmachen.
Wobei es eben nicht nur Leipziger waren: Zu den großen Montagsdemonstrationen reisten 1989 auch tausende Menschen aus allen Bezirken und Ortschaften ringsum nach Leipzig. Spätestes nach dem 9. Oktober war klar, dass in Leipzig der Takt der Veränderungen angeschlagen wurde.
Aber auch in Leipzig hatte dieser Herbst einen langen Vorlauf. Es rumorte in der ganzen Republik. Spätestens die gefälschten Kommunalwahlen im Mai 1989 machten mobil. Aber war das der Anfang? Nicht unbedingt. Der Vertrauensverlust in die Politik- und Reformfähigkeit der SED-Führung begann auch in Potsdam schon früher. Der Bedarf nach dem gesellschaftlichen Dialog war spätestens nach Gorbatschows Glasnost-Politik und dem Verbot des „Sputnik“ allgegenwärtig. Ein Überdruss hatte sich über das ganze Land gelegt und auch in Potsdam stiegen die Zahlen der Ausreiseantragssteller massiv an.
Und alles ist irgendwie aktenkundig – auch in Partei- und Stasiarchiven. Man muss das ganze Zeug nur mal aufarbeiten. Was Eckert gemacht hat. Man mag ihn gar nicht beneiden darum. In seinem Buch wird auch verbal spürbar, in welcher Wolke die Möchtegern-Kommunisten und Geheimdienstler gefangen waren. Es wird noch viel spürbarer als in den jüngeren Veröffentlichungen zur Leipziger Geschichte, die sichtbar machten, wie sprachunfähig die Funktionäre schon längst waren.
Was man natürlich erst versteht, wenn man den langen Bogen schlägt zur Stalinisierung in der frühen Ulbricht-Ära und der Schauprozesspraxis, in der der gesamte SED-Apparat von aller Kritik- und Diskussionsfähigkeit bereinigt wurde. Es ist nur ein ganz kleines Blitzlicht am Rande der sehr detaillierten Aufarbeitung all der Gruppen und Strömungen in Potsdam, die im Prozess des Jahres 1989 sichtbar wurden, das auch die Ratlosigkeit der SED-Mitglieder zeigt, als sie begriffen, dass all ihre großmäuligen Funktionäre zum Dialog völlig unfähig waren. Das hatten sie sich (wenn sie es denn jemals konnten) allesamt abgewöhnt: Der Funktionsapparat der SED war ein Apparat der Ja-Sager. Ganz so weit entfernt von den verblüffenden Kotau-Bildern aus Nordkorea war die SED nicht.
Wer Kritik übte, war sein Amt schnell los. Karriere machten nur „Genossen“, die ohne Nachdenken ausführten, was angewiesen wurde, und die „nach oben“ nur meldeten, was der Parteispitze Erfolge, Erfolge, Erfolge bestätigte.
Das, was „das Volk“ mit Witzen lächerlich machte, war die nackte Realität: Wo die Stasi aus dem Material, das sie von ihren hauptamtlichen und informellen Mitarbeitern sammelte, noch ein halbwegs realitätsnahes Bild machte, wurden die Berichte aus den Bezirken auf ihrem Weg ins ZK immer mehr weichgespült. Der Potsdamer SED-Chef hatte sich augenscheinlich mit seinem Beifall-Klatschen für Honneckers Politik schon den Namen „Jubel-Jahn“ verdient.
Das straff auf „demokratischen Zentralismus“ getrimmte System, das nur notdürftig seine stalinistische Befehlshierarchie verbarg, hatte auch eine fatale Kehrseite, die die Greise in Honeckers Kabinett nicht mal mehr ahnten: Ihr eigener Apparat sorgte dafür, dass sie über die Vorgänge im Land nur noch in verwässerter, redigierter und schöngemalter Form erfuhren.
Und dazu kommt noch etwas, was Eckert in den Berichten der damaligen Staatsorgane fand: Die knallrote Brille, mit der auch die Stasi auf das schaute, was den Erwartungen der Parteiführung zuwiderlief. Seit den 1950er Jahren pflegte man den Jargon von den „feindlichen Kräften“ und dem heimlichen Wirken des Klassenfeindes, der an allem schuld sein musste, was im Osten nicht so lief, wie es sollte. Unvorstellbar war diesen Leuten, dass die eigenen Bürger eigene Gedanken haben könnten und einen eigenen Willen, bei der Gestaltung ihres Landes mitreden und mitgestalten zu wollen.
Diese nahmen die Missstände in der Umwelt, in der Versorgung, auf den Arbeitsstellen nicht einfach als gegeben hin. Aber sie merkten schnell, wie sie zu Überwachungsobjekten für die allgegenwärtige Staatssicherheit wurden, wenn sie sich aktiv mit den Problemen in ihrem Umfeld zu beschäftigen begannen, sie wurden kriminalisiert und in der Berufskarriere behindert.
Es ist kein Zufall, dass auch in Potsdam der Widerstand aus diesen Gruppen erwuchs, die letztlich – wie anderswo im Land auch – unterm Dach der Kirche Zuflucht fanden. Oder besser: einiger Kirchen. Denn auch hier waren es einige engagierte Pfarrer, die auch gegen das Murren ihrer Kirchenobrigkeit ihre Gemeinderäume zur Verfügung stellten, oft auch selbst Akteure von Friedenskreisen und Arbeitsgemeinschaften wurden, die sich exponierten und im Herbst 1989 dann auch Mitgründer der neuen Parteien wurden. Und da die Stasi auch bestrebt war, alle diese „feindlichen“ Gruppen zu unterwandern, erscheint deren Arbeit sehr detailliert in den überlieferten Berichten der Geheimdienstler an die SED-Leitungen.
Und Eckert kann mit diesem Material auch etwas nachzeichnen, was man so eigentlich selten liest über diesen Herbst: Wie der alte, von Feinddenken geprägte Sprachgebrauch des Geheimdienstes immer weniger genügte, die Rat- und Hilflosigkeit des Apparates zu überdecken. Die Wirklichkeit so zu beschreiben, wie sie wirklich war, dazu war er eh nicht geeignet. Als der von Krenz so spät angekündigte „Dialog“ tatsächlich noch möglich gewesen wäre, sahen MfS und SED-Funktionäre in all diesen kritischen Gruppen nur Feinde, Umtriebe des Westens, der irgendwie auf heimliche Art sein Unwesen trieb im Osten. Es war ihnen unvorstellbar, dass es kompetente Bürger waren, die hier ihre berechtigten Sorgen und Fragen formulierten – oft ganz im Geiste Gorbatschows, dessen Glasnost als Vorbild galt. Man kann diesen Moment der Ermutigung aus Moskau eigentlich nicht unterschätzen, weil er auch in der DDR so eine Hoffnung aufkeimen ließ, dieses erstarrte Staatsgebilde sei reformierbar. Eine Hoffnung, die bekanntlich die Sache bis zum 9. November vorantrieb und immer mehr DDR-Bürger auf die Straße trieb.
Doch selbst die wortgewaltigen Berichteschreiber des Geheimdienstes schienen mit jedem Tag, der verging, zunehmend die Hoffnung zu verlieren. Da draußen spazierte „das Volk“, das die Allmacht von Partei und MfS friedlich immer mehr infrage stellte. Und droben die Genossen reagierten erst gar nicht, waren mit der Situation sichtlich überfordert. Dass da selbst ein Geheimdienst die Zukunftshoffnung für sich selbst verlieren kann, liegt nahe, überrascht aber auch, weil es so früh einsetzte.
Letztlich bröckelte auch in Potsdam der Machtapparat aus denselben Gründen, die ihn auch in Leipzig zusammenbrechen ließen: Die zum „Dialog“ aufgeforderten Genossen hatten nichts, worüber sie reden konnten. Niemand hatte ihnen beigebracht, Dinge zu ändern. Sprachlos standen sie politischen Dilettanten gegenüber, die zwar selten die nötige Ausbildung hatten, aber sehr genau wussten, was sich alles ändern musste. Eine Parallele zu Leipzig sind zum Beispiel auch die großflächig geplanten Abrisse, die Potsdam den Großteil seiner historischen Bebauung gekostet hätten.
Eckert schildert nicht nur detailliert, welche Gruppen mit welchen Hauptakteuren in Potsdam zum Träger der Veränderungen wurden, er beschreibt auch die Sprachlosigkeit von SED und Staatssicherheit sehr umfassend – und zwar an deren eigenen Berichten, die noch vorliegen. Man schaut quasi direkt hinein in einen Machtapparat, der sich als genau das entpuppt, als was ihn die DDR-Bürger zuletzt empfanden: ein leere Hülle. Außer den kraftmeierischen Worten und den möglichen Einsatzplänen von Polizei und MfS gegen überschaubare Gruppen von „Konterrevolutionären“ gab es da nichts. Keine handlungsfähigen Arbeitsstäbe, keine Reformpläne, keine Diskussionsangebote. Nichts. Die ganze Partei war intellektuell im Jahr 1953 stehen geblieben – auch weil sie nicht einmal mehr mit ihren eigenen Mitgliedern diskutierte. Die kamen nur noch als Parteisoldaten vor, auf deren gestählten Einsatz die Funktionäre im Herbst 1989 noch hofften, in dem Irrglauben, die SED würde aus lauter Pawel Kortschagins bestehen, dem Helden aus dem Pflichtbuch „Wie der Stahl gehärtet wurde“.
Dass man so einen Duckmäuserstaat mit einer Duckmäuserpartei bekommt, das hatte ja schon Wolfgang Leonhardt in „Die Revolution entlässt ihre Kinder“ beschrieben. Das war in den 40 Jahren nach seiner Flucht zu einem einzigen potemkinschen Dorf zusammengeschmolzen, in dem eigentlich nur noch ein paar tapfere Kinder auf der Straße fehlten, die laut sagten: „Aber der Kaiser ist ja nackt!“
Genau das Phänomen beschreibt Eckert mitsamt dem langsamen und ungewollten Erkennen der Berichteschreiber, dass da etwas ins Laufen gekommen war, das sie nicht mehr begriffen und auch nicht mehr unterdrücken konnten.
Und die Sache wäre vielleicht auch bruchlos erzählbar, wenn diese unbeherrschbare Bewegung am 9. November nicht auch noch den letzten Rest von Beherrschbarkeit beiseite gefegt hätte: die Mauer. Ab da übernahmen ganz andere Gewalten die Führung in diesem Prozess, der über kurz oder lang nicht nur die SED-Funktionärsmacht hinwegfegte, sondern auch die DDR. Im Ergebnis eine Revolution, auch wenn nirgendwo Barrikaden gebaut oder Rathäuser gestürmt wurden. Im Gegenteil: Die Machtzentralen wurden von selbst verdutzten Bürgern ganz friedlich bezogen – erst mit Runden Tischen, ein Vierteljahr später schon mit gewählten Parlamenten, in denen die DDR-Bürger erst einmal übten, wie man Politik macht.
Auch diesen Prozess des Übergangs lässt Eckert nicht außen vor. So erfährt man auch, welche Wege und Karrieren einige der Protagonisten nahmen. Natürlich schaut man aus Leipziger Sicht auch: Wen kennt man da eigentlich? Hat es einer auch in die große Politik geschafft? Zumindest Namen wie Matthias Platzek und Ulrike Poppe fallen einem auf. Und natürlich spielte die Gründung der Sozialdemokratischen Partei in Potsdam eine zentrale Rolle. Im künftigen Land Brandenburg waren die meisten Akteure zu Hause, die diese Partei in der DDR neu gründeten und im März 1990 schon wie die Sieger aussahen. Aber auch das gehört zu dieser Revolution: Dass sie spätestens ab Januar längst im bundesdeutschen Fahrwasser lief und die westdeutschen Parteien ihren ostdeutschen Ablegern massiv Wahlunterstützung gaben – auch dann, wenn es echte Blockflötenparteien gewesen waren.
Aber gerade weil Potsdam bislang so gar nicht in der Betrachtung zur Friedlichen Revolution gestanden hat, wird hier umso deutlicher, wie zwingend die Veränderungsprozesse in der ganzen DDR waren, die schon weit vor dem Herbst 1989 dafür sorgten, nachdenkliche und kritische Menschen zu politisieren und mutiger zu machen in ihrer Forderung nach Veränderung. Bis zum September glaubte die Staatsmacht noch, sie könnte die kritischen Gruppen mit Polizeigewalt bändigen. Nach den großen Oktoberdemonstrationen wurde die ganze Ratlosigkeit der vergreisten Macht deutlich, die vielleicht doch – um mal den Hardliner Kurt Hager zu zitieren – ans „Tapezieren“ hätte denken sollen, um 1989 überhaupt noch mitreden zu können.
Man hatte nicht gewollt und bildete sich selbst am 7. Oktober 1989 noch ein, man hätte die Sache besser im Griff als der Genosse Gorbatschow.
Zuweilen wird man sicher in diesem Buch von Namen, Treffen, Sitzungen erschlagen. Das Material, das Eckert nutzt, ist detailreich und wird wahrscheinlich auch die Potsdamer, die das alles kennen, erschlagen. Aber so wird auch deutlich, dass es im Jahr 1989 eigentlich keinen ruhigen Moment gab. Die Menschen konnten nicht wirklich mehr stillsitzen und abwarten. Es war auch diese Ungeduld, die die Dinge im Herbst so unaufhaltbar ins Rollen brachte.
Man bekommt also quasi einen neuen Puzzle-Stein zur Revolutionsgeschichte des Jahres 1989, der sich gar nicht verstecken muss, wenn er neben Leipzig, Dresden, Berlin oder Plauen landet. Und man ahnt, das sich über andere Groß- und Mittelstädte der DDR ganz ähnlich umfassend erzählen ließe und dass jedes Mal eine ganz unverwechselbare Gesellschaft von Menschen sichtbar wird, die aus ganz ähnlichen Motivationen tätig wurden, ihre Gesellschaft ändern zu wollen. Allesamt nicht ahnend, wie dieses allgegenwärtige Wollen ab Oktober diese verblüffende Wucht entfalten würde, ohne dass der ergraute Staat dem auch nur das Mindeste entgegensetzen konnte.
Rainer Eckert Revolution in Potsdam, Evangelische Verlagsanstalt, Leipzig 2017, 25 Euro.
In eigener Sache: Abo-Sommerauktion & Spendenaktion „Zahl doch, was Du willst“
Abo-Sommerauktion & Spendenaktion „Zahl doch, was Du willst“
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
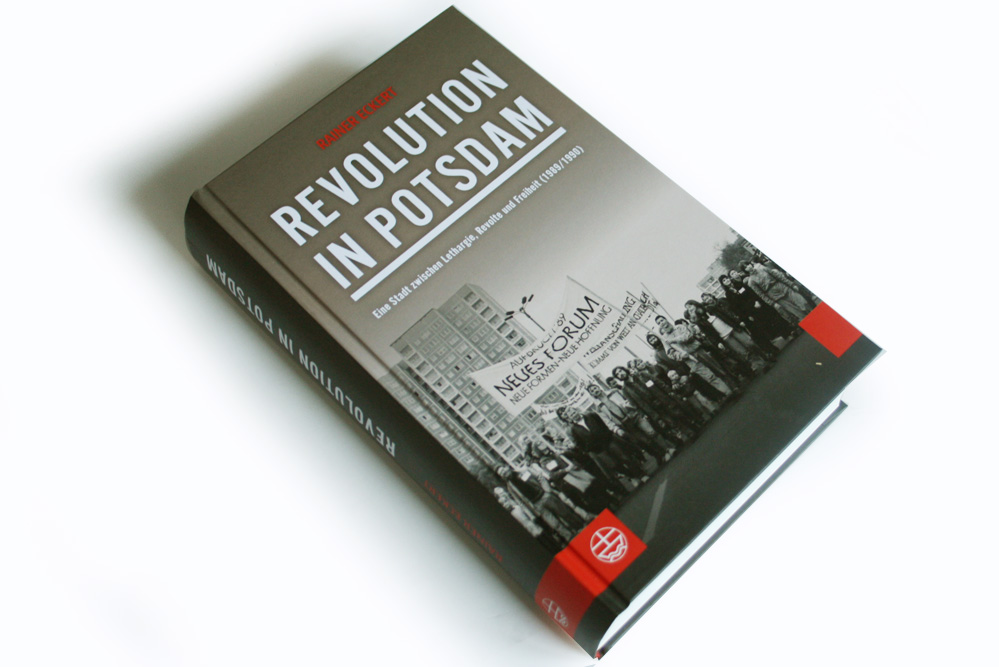








Keine Kommentare bisher