Der Titel klingt spannend, die Frage überzeugend. Denn wer sich die Weltgeschichte anschaut, der wundert sich ja tatsächlich: Warum haben ausgerechnet die Europäer mit ihren winzigen Staaten ein halbes Jahrtausend lang die Welt kolonialisiert und teils viel reichere und kulturvolle Länder erobert und beherrscht? Steckt dahinter vielleicht ein Gesetz? Dutzende Wissenschaftler haben sich darüber schon den Kopf zerbrochen.
Manche sahen im Klima den Grund, andere in der Geografie Europas, wieder andere machten Krankheiten dafür verantwortlich. Philip T. Hoffman ist Professor für Wirtschaft und Geschichte am California Institut of Technologie, dem berühmten Cal Tech. Da sieht man die Welt natürlich auf besondere Weise – sehr technologisch. Denn Fakt ist: Technologien haben immer wieder dazu beigetragen, dass Menschen immer neue Stufen von Zivilisation, Kultur und Wohlstand erreichen konnten. Die Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Technologie-Sprünge.
Und mit jedem Sprung machten sich die Menschen nicht nur unabhängiger von ihren Umgebungsbedingungen, sie traten auch in immer neue Stufen des Wettbewerbs miteinander ein: auf wirtschaftlichem, kulturellem, politischem und militärischem Gebiet. Europas Geschichte – das ist unübersehbar – ist eine Geschichte der Kriege. Aber auch das ist keine Ausnahme. Auch die Geschichte aller anderen Kontinente lässt sich als eine Geschichte der Kriege erzählen. Nur dass die Länder – und darunter richtig große und reiche wie China, Indien, Persien, die Türkei – niemals dazu ansetzten, die halbe Welt zu erobern und ganze Kontinente in Kolonien zu verwandeln.
Sie führten zwar selbst Kriege – gegen regionale Kontrahenten, einfallende Nomaden, um Gebietserweiterungen und gegen aufständische Regionen – aber sie rüsteten keine Flotten aus, um jenseits der Meere das Land anderer Völker zu erobern und die Welt zu dominieren. Das taten nur die Europäer – und einige ihrer ehemaligen Kolonien wie die USA, die Hoffman aus gutem Grund mit zur europäischen Welt rechnet.
War es ein besonders kriegerischer Geist, der die Europäer so aggressiv und herrschsüchtig machte? Oder war es die besondere europäische Konstellation der Kleinkönigreiche, die fortwährend im Krieg miteinander waren, ohne dass es – wie in China oder Russland – zur Herausbildung einer Hegemonialmacht kam, die den Kontinent befriedete? Das zumindest nimmt Hoffman an und entwickelt ein durchaus bezauberndes „Turniermodell“. Das erinnert an die alten Rittersleute, deren Handwerk dereinst ja wirklich der Krieg war. Jeder Adlige wurde bis in die Neuzeit im Kriegshandwerk ausgebildet. Man ritt nicht nur zu Turnieren, sondern der Krieg selbst war der Raum, in dem die Elite des Kontinents ihre Sporen verdiente, um Ruhm und Ehre kämpfte. Aus der Distanz sieht das durchaus wie ein funktionierendes Modell aus, das Hoffman in feste Formeln packt, vier Grundbedingungen definiert – und schon kann er die europäische Geschichte anhand des Turniermodells beschreiben.
Er gibt sich überzeugt, dass er sie damit auch erklärt. Denn im Rahmen der wirtschaftlichen Spieltheorie könnte das Modell ja tatsächlich erklären, warum große und kleine Fürsten immer wieder in Kriege zogen – der Ruhm war der Preis. Die Entscheidung über Krieg oder Nicht-Krieg unterlag – so Hoffmann – einem Abwägungsprozess, in dem die Herrscher die Kosten des Krieges gegen den möglichen Gewinn abwogen. Und wenn die Kosten niedrig waren, der mögliche Gewinn aber hoch, dann wurde zum Krieg geblasen. Und weil das jahrhundertelang so war, entstanden auch Heere bezahlter Söldner, die jederzeit bereit waren, sich für den nächsten Feldzug einkaufen zu lassen. Und es entstand eine Landschaft der Waffenproduzenten, die jederzeit das modernste Kriegsmaterial zu liefern bereit waren. Anfangs alles Handwerker, die sich immer weiter perfektionierten. Später riesige Unternehmen, die ihre Produkte jedem Staat verkauften, der sein Kriegsarsenal modernisieren wollte.
Wo der Krieg fortwährend für Nachfrage sorgte und in den Kriegszügen die besseren Waffen über Sieg und Niederlage mitentschieden, entstand logischerweise auch ein Modernisierungsdruck. Wer mithalten wollte, besorgte sich die effektivsten verfügbaren Waffen. Und da in Europa die Entfernungen immer kurz waren und kriegsentscheidende Neuerungen nicht geheim blieben, florierte die Waffenproduktion und irgendwann im Hochmittelalter fasste nicht nur die Schießpulvertechnologie Fuß in Europa, sie sorgte auch dafür, dass der Innovationsdruck in den europäischen Heeren wuchs.
Weil die Europäer aufgrund des permanenten Kriegszustandes gezwungen waren, die Kriegstechnologie immer weiter zu perfektionieren – und zwar vor allem die Schießpulvertechnologie – gelangten sie zum Ausgang des Mittelalters in eine Position, in der es auf anderen Kontinenten keinen Staat mehr gab, der ihrer Schusswaffentechnologie ernsthaft etwas entgegensetzen konnte. Da genügten kleine, nur wenige hundert Mann starke Söldnerhaufen, um riesige Reiche wie die der Inka und Azteken zu erobern. Nicht einmal Armeen mussten die Europäer losschicken, um ihre Kolonien zu erobern. Ein Haufen schusswaffenversierter Männer genügte.
Stimmt alles.
Hoffman verweist die Liebhaber ökonomischer Formelsätze immer wieder gern auf den Anhang. Da ist er ganz Professor: Er hat eine Theorie, die er mit Formeln untersetzt, und jetzt tut er alles, um sie argumentativ und mit statistischen Daten zu unterfüttern. Man fühlt sich regelrecht wie ein Student in einer Vorlesung bei ihm.
Aber man wird das Gefühl nicht los, dass seine Theorie doch eigentlich nur auf sich selbst beruht. Erst extrahiert er die vier Grundannahmen aus der europäischen Geschichte, formt seine These, die durchaus spannend ist, und dann belegt er sie wieder am realen Verlauf der europäischen und der Kolonialgeschichte.
Kann man machen. Den Leser führt es in eine Geschichtsbetrachtung ein, die viel zu selten auch in den üblichen Geschichtsbüchern auftaucht: die Weltgeschichte als eine Geschichte der Technologien zu erzählen. Und Fakt ist: Staaten mit der moderneren Technologie haben im Wettbewerb mit anderen Staaten immer die Nase vorn gehabt.
Aber: Das trifft eben nicht nur auf die Kriegstechnologien zu. Und darüber stolpert der Leser letztlich im letzten, dem siebenten Kapitel. Eher in Nebensätzen. Aber Hoffman hat auch schon in den vorhergehenden Artikeln immer wieder auch die argumentative Auseinandersetzung mit anderen Autoren gesucht. Im siebenten Kapitel versucht er weitere Interpretationen zur Entwicklung unserer Geschichte aufzunehmen. Augenscheinlich wieder aus dem bislang sehr engen Bereich der Geschichtsökonomie. Da taucht dann zum Beispiel die Frage auf: War es nicht doch das Humankapital (oh ja, da beißt man gedanklich gleich mal in eine Zitrone), das die industrielle Revolution in Gang setzte? Und wo wurde sie eigentlich in Gang gesetzt? Die üblichen Lehrbücher erzählen: in England. Irgendwann im späten 17., beginnenden 18. Jahrhundert.
England ist bei Hoffman deshalb so wichtig, weil er davon ausgeht, dass es ohne die industrielle Revolution in England auch nicht so bald eine industrielle Revolution in Europa gegeben hätte.
Und vor der industriellen Revolution kam die Revolution der Schusswaffentechnologie, die England schon in dem Moment zur militärischen Führungsmacht gemacht hat, als es noch gar nicht industrialisiert war. Dabei erzählt Hoffman selbst, wie lang die Vorgeschichte der Technologie-Entwicklung in Europa tatsächlich war.
Und gedanklich ist man da die ganze Zeit am Umschalten. Warum fallen eigentlich wichtige Stichworte bei Hoffman nicht, die man eigentlich zwingend erwarten würde? Denn die Existenz von Söldnerheeren, deren Anführer sich selbst wie freie Unternehmer gebärdeten und ihre Kampfkraft an jeden verkauften, der ein bisschen Krieg produzieren wollte, gehört genauso zu den frühkapitalistischen Entwicklungen weit vor Beginn der Industrialisierung wie die Entstehung von Börsen, Banken und – na hoppla – Kredit und Kapital.
Denn die ganze teure Waffentechnologie brauchte Kapital. Und Europas Fürsten finanzierten ihre Kriegszüge eben nicht nur aus der eigenen Schatulle oder später immer mehr aus Steuereinnahmen. Sie verschuldeten sich dafür – bei reichen Kaufleuten, Händlern und – man darf es einfach nicht vergessen – den reichen Juden, die ja im Geldgewerbe tätig waren, weil sie in bürgerlichen Berufen nicht tätig werden durften. All das fehlt bei Hoffman, so dass man spätestens im siebenten Kapitel das Gefühl hat, dass der technologiebegeisterte Professor die Geschichte eigentlich auf den Kopf gestellt hat. Oder dass da am CalTech etwas fehlt: ein Wissen um den Beginn der kapitalistischen (nämlich von Kapital getriebenen) Wirtschaftsepoche.
Genau da wird seine These nämlich spannend. Denn dann verändert sich die Frage. Da werden die politischen Ausgangsbedingungen Westeuropas nicht als mythische Ursache für den Triumph der Schießpulvertechnologie erkennbar, sondern als idealer Nährboden für die Entstehung frühkapitalistischer Handelsbeziehungen. Man denke nur an die legendäre Rolle der Kaufmannsstadt Venedig, an die großen Kreditgeber in Deutschland – die Fugger und Welser, die auch die Kriege der Kaiser bezahlten – oder an die legendären Bankiers der Medici, die selber zu einem berühmten Fürstengeschlecht wurden.
Hoffman geht auch auf die Rolle des Christentums ein, die – so seine Interpretation – darin bestand, die europäischen Staaten klein und zerstritten zu halten, und damit ebenfalls dazu beitrug, dass die Schießpulvertechnologie immer weiter vervollkommnet wurde. Aber das Argument wirkt schwach, erst recht, wenn man (nun gerade im Luther-Jahr) um die Rolle des Vatikan als Geldsammler und Großinvestor weiß.
Tatsächlich lenkt Hoffmans Idee den Blick auf eine Tatsache, die augenscheinlich den Autoren, die er so zitiert, gar nicht bewusst ist: dass der Kapitalismus viel älter ist als die industrielle Revolution in England und dass sich viele scheinbar völlig mittelalterliche Akteure (ja, auch die turnierenden Ritter) in Wirklichkeit wie waschechte Frühkapitalisten benahmen. Auch darüber stolpert man, wenn Hoffman so beiläufig von den steinernen Burgen der Ritter und den Festungen der Europäer spricht. Das waren eben nicht nur militärische Fortifikationen. Da verstellt der Militärhistoriker sich selbst den Blick. Die Dinger waren schweineteuer, also richtige Großinvestitionen. Aber sie spielten nur in zweiter Linie eine militärische Rolle. In erster Linie waren sie Sicherungen für Handelswege und Marktplätze. Romantisiert wurden sie erst im 19. Jahrhundert, genauso wie die Ritter, die zwar das Kriegshandwerk beherrschten und mit ihren Fürsten in jeden Feldzug mussten.
Aber ihre Burgen waren in erster Linie Verwaltungssitze von Rittergütern. Es ist also ein netter Gedanke, die so furiose Entwicklung der Schießpulvertechnologie in Westeuropa aus einer spieltheoretischen Notwendigkeit zu berechnen. Aber damit blendet Hoffman die eigentlich treibende Kraft aus, das, was das mittelalterliche Europa tatsächlich schon deutlich vom Rest der Welt unterschied: die Entstehung früher Formen von Kapitalgesellschaften. Auch die Kreuzzüge wurden über Kredite finanziert – aus lauter religiösem Eifer heraus wären sie nie zustande gekommen. Und die italienischen Schiffsbesitzer haben sich goldene Nasen damit verdient.
Und ohne Kredite hätte es auch nicht die rasante Entwicklung der Schusswaffentechnologie in Europa gegeben. Da hätte alles „learning by doing“ nichts genützt, von dem Hoffman glaubt, dass es vor dem 19. Jahrhundert die Entwicklung der Waffentechnologie vorantrieb. Um diese fortwährend sich entwickelnde Kriegswirtschaft am Laufen zu halten, brauchte es einen Markt mit Käufern und Kapitalgebern. Und es brauchte ein immer weiter wachsendes Kapital, um die Sache am Laufen zu halten. Denn die Pistolen und Musketen wurden zwar im Verhältnis immer billiger. Dafür blieben ganze ausgerüstete Armeen, Festungen, Schiffe und Kanonen trotzdem teure Investitionen – die immer teurer wurden, je produktiver sie wurden. Ja, das gibt es tatsächlich: Ökonomen, die berechnen, wie produktiv Kriege sind.
Und so gerät auch aus dem Blick, dass es nicht die Innovationen im Militärwesen waren, die die ökonomische Entwicklung Europas vorantrieben, sondern dass sie Teil einer ganzen breiten Entwicklung von Innovationen waren, die insgesamt die Kapitalisierung der westlichen Gesellschaft vorantrieben. Denn ohne neue Bergbau- und Verhüttungstechnologien hätte es auch keine neuen Schusswaffen gegeben. Kohle war auch in England nicht billig, wie Hoffman meint. Sie wurde erst bezahlbar, als die dafür notwendigen Technologien entwickelt wurden.
So geht man aus dem Buch mit einer hübschen Anregung – und einer gewissen Enttäuschung, dass es sich der Wirtschaftsprofessor so einfach gemacht hat. Nein, es war nicht der Glanz von Ruhm und Ehre, der die Europäer zu den Gewinnern des Wettrennens um die Weltherrschaft machte, sondern der zunehmende Druck jenes Dings, das niemals satt wird und immer mehr Wachstum und Vermehrung will: des Kapitals. Und seine Dominanz hat ganz und gar nicht aufgehört, bloß weil die Westeuropäer im 20. Jahrhundert aufhörten, die Welt als Kolonie zu betrachten.
Aber das steht in anderen Büchern.
Philip Hoffman Wie Europa die Welt eroberte, Theiss Verlag, Darmstadt 2017, 24,95 Euro.
In eigener Sache: Lokaler Journalismus in Leipzig sucht Unterstützer
https://www.l-iz.de/bildung/medien/2017/03/in-eigener-sache-wir-knacken-gemeinsam-die-250-kaufen-den-melder-frei-154108
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
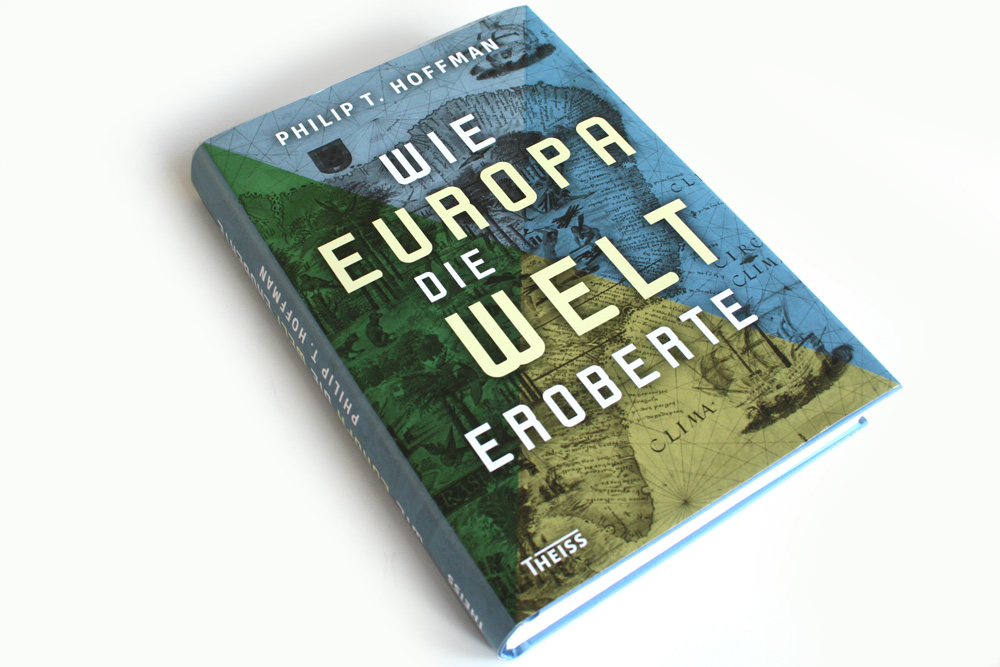









Keine Kommentare bisher