Das hier ist sozusagen ein Wunschbuch. Oder der Anfang davon: Ein Buch über das mehr oder weniger rebellische Leipzig. Denn zumindest für die vergangenen 200 Jahre gilt: Leipzig war eine rebellische Stadt. Das hat Gründe. Und 2014 wurde das von mehreren klugen Köpfen im Rahmen des Tages der Stadtgeschichte thematisiert.
Den Bogen haben die Autoren ganz weit gespannt – vom ersten urkundlich belegten Aufstand der Leipziger Bürger gegen ihren Landesherrn, Markgraf Dietrich, der nicht ohne Grund den Beinahmen „der Bedrängte“ bekam, bis in die straff regulierten Demonstrationen der letzten Jahre. So etwas wie 1215/1216 – den Landesherrn einfach auszusperren – das sollten sich die Leipziger heute mal wagen! Der würde ihnen aber einheizen. Sie können ihn ja nicht mal ausladen, wenn ihnen seine Politik nicht gefällt.
Andererseits: Was würde es bringen? Vor 800 Jahren ging es immerhin um die klitzekleine Chance, vielleicht den Kaiser als neuen Stadtherrn zu bekommen und damit Freie Reichsstadt zu werden. Wie stolz das klingt!
Und wie undankbar. Hatte doch Dietrichs Vater erst diese Stadt gegründet und mit Magdeburger Recht versehen. Ohne den eifrigen Landesausbau der Wettiner hätte Leipzig nie eine große Rolle gespielt. Sie haben die ersten Marktrechte verliehen und ihre Messestadt gepäppelt, bis sie groß war und richtig Geld abwarf. Deswegen haben die Leipziger vielleicht noch mal ab und an gemurrt wie in der Lutherzeit oder 1845, als der eitle Prinz Johann unbedingt nach Leipzig kommen musste, als erzkonservativ bekannt, völlig unbeliebt – und wissend, wie es gärte im vormärzlichen Leipzig. Aber richtig revoltiert?
Gerade das 19. Jahrhundert ist gespickt mit Daten, mit denen Leipziger Bürgerselbstbewusstsein und protestierender Eigensinn eng verbunden ist: 1830, 1845, 1848, 1863, 1865. Während die Jahrhunderte zuvor eher nur von wenigen Einsprengseln geprägt sind – dem Calvinistensturm 1593 zum Beispiel. Da tun sich selbst gestandene Historiker schwer, wirklich eine Tradition der Unruhen und Rebellionen zu zeichnen, müssen auf Handwerkerfehden und Streiks ausweichen – wie Marcel Korge in einem Beitrag, der selbst wieder unter Materialmangel leidet, weil schlicht noch niemand systematisch alle Aufstände, Ausstände und Prügeleien der Leipziger Geschichte gesammelt hat. Was nicht politisch wurde, fand auch kaum Eingang in die städtische Überlieferung. Obwohl es die Konflikte immer gab – mal religiös motiviert, oft genug aber eng mit sozialen und wirtschaftlichen Nöten verquickt. Manchmal waren es Fehden zwischen Handwerkern und Studenten, mal Fehden innerhalb der Zünfte.
Aber das gab es überall. Eine ausgesprochen rebellische Stadt war Leipzig oft genug nur im Geiste. Was die Fürsten und Zensoren oft genug in Panik versetzte. Denn Professoren mit Silberperücke fangen zwar selten einen handfesten Aufstand an, dafür gebären sie Gedanken, die die Welt in Unruhe versetzen. Wie der Herr Thomasius, dessen Charakter Martin Kühnel mal unter die Lupe nimmt. Und auch der Vormärz begann ja mit Papier, mit unruhigen Köpfen, die meinten, auch Sachsen müsse sich verändern.
Auch wenn Detlef Döring im Umfeld der Französischen Revolution zwar so manche wohlwollende Berichterstattung fand – aber kein rebellisches Feuer. Leipzig war noch nicht so weit. Oder liegt hier ein Fall vor, wo der Forscher wieder konstatiert, es müsse noch eine Menge Material aufgearbeitet werden? Eine Aufforderung, die Leipziger Historiker nur zu gern in ihre Texte schreiben – ja: Aber wen fordern sie damit eigentlich auf? Sollten sie nicht selbst …?
Denn emsig sind sie zwar in Staatsakten und da und dort (aber viel zu selten) auch in Büchern und alten Zeitschriften. Aber Gerichtsakten werden erstaunlich selten erwähnt. Gibt es keine mehr? Ist das alles verschwunden?
Denn man kommt ja zwangsläufig auch ins 20. Jahrhundert und in dieses jüngst verschwundene Land DDR, für das einige Leipziger Rebellionen ja exzellent dokumentiert sind: der Arbeiterausstand 1953 (oder war es doch ein Aufstand?) genauso wie die Friedliche Revolution, für die Rainer Eckert in diesem Band eine richtige Lanze bricht, weil mittlerweile lauter Legenden umlaufen über diesen rebellischen Herbst und seine Vorgeschichte, die eigentlich lauter Vorgeschichten sind. Aufstände kommen nicht aus dem Nichts. Sie kündigen sich an. Und sie beginnen mit anfangs individuellen Protesten, mit zunehmendem Unbehagen und – in Leipzig erlebt – kreativem Umgang mit neuen Protestformen. Und auch und gerade das ist mittlerweile gut dokumentiert, wie gerade die Reaktionen der Staatsmacht dafür sorgten, dass die Leipziger Protestierer erfindungsreich wurden und die staatliche Gewaltpolitik unterliefen.
Und da hilft, dass vorher Heidi Roth über den 17. Juni 1953 schrieb, der eigentlich bis zur Mittagsstunde ein Tag des friedlichen, fast freudigen Protestes war. Genauso friedlich wie 1989. Die Gewalt kam erst, als die Staatsmacht zuschlug und der Bezirksparteichef Paul Fröhlich den Schießbefehl erließ. Denn die Partei, die glaubte, alles im Griff zu haben, war ratlos vor dem Ausstand ihrer eigenen Arbeiter. Und hinterher war sie bis ins Mark erschrocken. Und wie sie ihren geliebten Arbeitern dann die Zähne zog und vor allem dem rebellischen sozialdemokratischen Geist das Rückgrat brach, das erzählt Michael Hofmann in seinem Beitrag „Protestierende Arbeiter in Leipzig 1968“.
Ein bisschen haben sie noch gemurrt. Aber sie sind nicht auf die Straße gegangen wegen Prag.
Es gibt da Stellen, an denen man glaubt, es habe zwischen 1953 und 1968 gar keinen Protest gegeben. Aber das stimmt nicht. Nicht alles hat ja an diesem Tag der Stadtgeschichte ins Programm oder in dieses Buch hier gepasst. Der Protest gegen die Sprengung von St. Pauli ist aber drin. Christian Winter erzählt, welch langen Atem dieser Protest hatte – denn er schwelte seit 1959, seit die SED-Führung davon geredet hatte, die Kirche „ein Stückchen zu verschieben“. Als dann die ersten Entwürfe für den Uni-Neubau ohne Kirche zu sehen waren, waren die Mächtigen überrascht von der Wucht des Unmuts. Und sorgten fortan dafür, dass das ganze Projekt still und leise unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorangetrieben wurde. Dass es neun Jahre dauerte, lag dann nur noch am fehlenden Geld.
Aber man lernt so als Leser: Eigentlich sind Mächtige sehr gelehrig, wenn es darum geht, Dinge zu verheimlichen und der Auseinandersetzung mit den Bürgern aus dem Weg zu gehen.
Deswegen enttäuscht dann der letzte Beitrag von Dieter Rink – sorry, ist aber so – der akribisch die Demonstrationen und Kundgebungen von 1990 bis 2015 auflistet und einsortiert, von den ersten Demonstrationen gegen Betriebsschließungen und Irak-Krieg bis zu dem Herumgezappel bei den Montagsmahnwachen und LEGIDA. Das Problem ist nicht, dass das alles irgendwie auch Unruhe war und ist. Das Problem ist: Es hat historisch noch kein Gewicht. Die Distanz fehlt. Was war wirklich wichtig? Was war nur politischer Klamauk? Man denke nur an die unzähligen Auftritte des Neonazis Worch mit seinen Reise-Nazis, der im Grunde nur eins vollbracht hat: dass die Leipziger Zivilgesellschaft sich im Gegenprotest professionalisiert hat.
Dass die deutschen Neonazis dasselbe wollen wie ihre Vorbildnazis aus der Weimarer Republik, ist ja unübersehbar. Die Weimarer Republik ist mit Novemberrevolution und den Leipziger Ereignissen zum Kapp-Putsch im Buch vertreten. Weil das alles mit Sozialdemokratie zu tun hat, rückt gleich in vier Beiträgen die damalige Rolle der Leipziger Volkszeitung ins Bild, die schon in den 1890er Jahren zu einer der modernsten Tageszeitungen im Portfolio der SPD wurde, gemacht nach amerikanischem Vorbild, ganz ähnlich wie die stockkonservativen Leipziger Neuesten Nachrichten.
Der Leser staunt: Das ging damals. Wenn auch mit richtigen Widerständen, denn auch damals hatte die SPD schon ihre Probleme mit der Tradition. Das, was die Redakteure da in Leipzig machten, war einfach viel zu modern. Das ging gar nicht. Aber es kam bei den Leipziger Arbeitern an. Das Blatt war nicht abhängig von Berlin und konnte praktisch bis 1933 immer eine eigene Linie fahren. Etwas, was dann Jürgen Schlimper für die Zeit des 1. Weltkrieges beschreibt, als die LVZ bis an die Grenzen der Militärzensur versuchte, einen Friedenskurs zu fahren. Das mit dem Frieden war nicht so schlimm. Aber die Kritik am verordneten Burgfrieden, dem sich die SPD gebeugt hatte, galt schon als Sabotage. Trotzdem las man in der LVZ andere Töne. Und nicht ohne Grund war der Leipziger SPD-Verband deutlich linker als die Burgfrieden-SPD in Berlin, was dann nach dem Krieg dazu führte, dass Leipzig zur USPD-Hochburg wurde und der (Mehrheits-)SPD das Regieren in Dresden fast unmöglich machte.
Am Ende war es ja freilich die Uneinigkeit der Arbeiterparteien, die 1933 der NSDAP den Weg an die Macht ermöglichte. Ein Thema, über das bis heute gerätselt wird. Warum gab es so wenig Widerstand gegen die Nazis?
Die Antwort lautet wohl schlicht: Die Frage steht so nicht. Einige Facetten des Widerstands schildert Alfons Kenkmann in seinem Beitrag – und er merkt eher beiläufig an, wie sich gerade die KPD in ihrem Widerstand gegen die neuen Machthaber schon in den ersten zwei Jahren aufrieb. Zu Tausenden wurden die Kommunisten verhaftet, ins Zuchthaus oder später ins KZ gesteckt. Die Partei blutete regelrecht aus, stellt Kenkmann fest. Und mit den aktiven Sozialdemokraten, die sich nicht wegduckten, passierte dasselbe. Gegen jede Form der Opposition gingen die neuen Machthaber mit brutaler Gewalt vor – sie hatten auch den kompletten Staatsapparat dafür zur Verfügung. Umso verblüffender ist, dass es dennoch bis zum Schluss immer wieder Formen der Widerständigkeit gab. Das Buch zum kompletten Widerstand gegen die Nazis in Leipzig ist noch lange nicht geschrieben.
Dasselbe gilt zu den Protestformen in der DDR. Die stalinsche Unterdrückung jeder Opposition setzte ja postwendend ein, kaum hatte man die Stadt Leipzig übernommen. Und bevor Michael Hofmann auf die 1968 noch einmal leicht protestierenden Facharbeiter kommt, schildert er jene Zerstörung des sozialdemokratischen Milieus, die der SED erst eine handzahme Arbeiterschaft bescherte – die zwar ab und zu rumorte, aber nie wieder ernsthaft die Machtfrage stellte. Das tat sie erst ab November 1989 wieder, als den Staatsorganen der Zahn gezogen war und mit Panzern auf der Straße nicht mehr gerechnet werden konnte. Aber dann konsequent: Wenn schon arbeiten, dann so richtig in einer tollen Marktwirtschaft.
Aber auch das erzählt ja so Manches über Widerständigkeit in Leipzig, die nie wirklich planbar war, auch nie steuerbar. Außer wenn sich – wie 1845 – ein so genialer Redner wie Robert Blum fand, der eine drohende Explosion zu verhindern wusste und die kochende Volksseele zu bändigen verstand.
Das Schöne an der Zusammenstellung ist, dass unterschiedliche Autorinnen und Autoren aus ihren Spezialgebieten berichten und damit deutlich machen, wie heterogen der Stand der Forschung überall ist. Tatsächlich gibt es keine gleichsam durchstrukturierte Stadtgeschichtsforschung. Gerade die Geschichte der Unruhen macht das deutlich: Manchmal werden alle handelnden Akteure deutlich, manchmal schwebt das Thema in der Luft. Manchmal spiegeln sich die gesellschaftlichen Kämpfe der Zeit auch in Leipzig, manchmal scheinen die Ereignisse einfach überzugreifen.
Aber gerade weil die Autoren so springen, wird auch deutlich, dass irgendwie der Unterboden fehlt. Denn Leipzig war ja nicht besonders rebellisch, weil die Leute hier besonders explosiv sind. Patrick Leitl deutet es an, wenn er über die Entstehung der Sozialdemokratie schreibt: Leipzig war als Buchstadt nun einmal auch der Ort, an dem riesige Berge an Literatur für kritische Menschen gedruckt wurden. Etwas, was Leute wie Robert Blum genauso zu nutzen wussten wie später Louise Otto Peters oder die besten Federn der Sozialdemokratie. Und diese Leute konnte man zwar erschießen (wie Blum in Wien) oder ins Zuchthaus stecken (wie Bebel und Liebknecht), aber man konnte nicht verhindern, dass ihre Schriften weiterverbreitet wurden.
Da erstaunt schon, dass es keinen Beitrag zu den mutigsten Leipziger Verlegern gibt. Oder zu den mutigsten Streit- und Zeitschriften aus Leipzig. Leipzig war auch darin nicht einzigartig. Aber es gehörte – neben Berlin – zu den wenigen deutschen Großstädten, wo das in dieser geballten Form möglich war und passierte. Bis in die DDR-Zeit hinein. Das fehlt auch diesmal wieder: Die Geschichte der geistigen und kulturellen Widerständigkeit in Leipzig, ohne die der Herbst 1989 ebenfalls nicht denkbar ist.
Wie man sieht, passt wirklich nicht alles in ein 500-Seiten-Buch. Es ist ein Anfang mit ein paar schönen roten Fäden in die noch unerforschte Dunkelheit. Und es skizziert erst vage den widerständigen Charakter der Stadt, der sich oft gar nicht auf der Straße austobte. Und nicht alles, was sich auf der Straße austobt, ist Widerstand. Aber so viel zum Thema in einem Buch gab’s eben bis dato auch noch nicht.
Ulrich Brieler; Rainer Eckert Unruhiges Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, Leipzig 2016, 62 Euro.
In eigener Sache – Wir knacken gemeinsam die 250 & kaufen den „Melder“ frei
https://www.l-iz.de/bildung/medien/2016/10/in-eigener-sache-wir-knacken-gemeinsam-die-250-kaufen-den-melder-frei-154108
Empfohlen auf LZ
So können Sie die Berichterstattung der Leipziger Zeitung unterstützen:
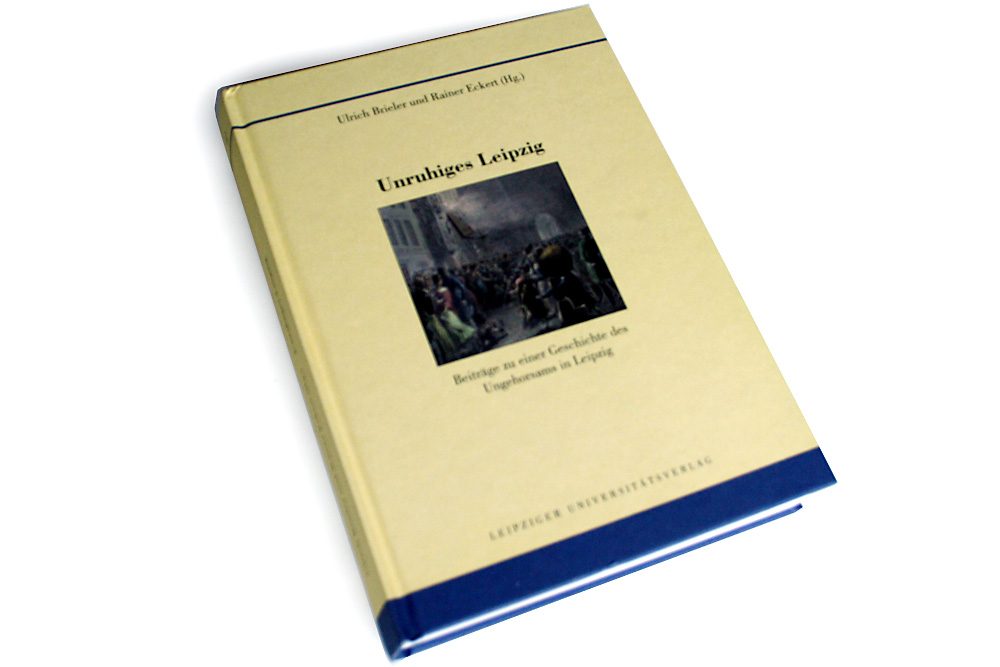









Keine Kommentare bisher